Herren Und Heilige
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Catalogue of an Exhibition of Florentine Painting Before 1500
J * THE VIRGIN AND CHILD WITH ST. ANNE AND THE INFANT ST. JOHN THE BAPTIST LEONARDO DA VINCI Burlington Fine Arts Club CATALOGUE OF AN EXHIBITION OF FLORENTINE PAINTING BEFORE 1500 LONDON PRINTED FOR THE BURLINGTON FINE ARTS CLUB 1920 CHISWICK PRESS: CHARLES WHITTINGHAM AND GRIGGS (PRINTERS), LTD. TOOKS COURT, CHANCERY LANE, LONDON. COMMITTEE FOR THIS EXHIBITION DR. TANCRED BORENIUS. H. CLIFFORD-SMITH, ESQ. HERBERT F. COOK, ESQ. ROGER E. FRY, ESQ. HENRY HARRIS, ESQ. ROBERT C. WITT, ESQ., C.B.E. LIST OF CONTRIBUTORS HIS MAJESTY THE KING. THE PRESIDENT AND COUNCIL OF THE ROYAL ACADEMY. THE MARQUESS OF BATH, K. G. *ROBERT H. BENSON, ESQ. Louis BREITMEYER, ESQ. *THE EARL BROWNLOW, P.C. J. ANNAN BRYCE, ESQ. * LORD CARMICHAEL OF SKIRLING, G. C.S.I., G.C.I. E., K.C.M.G. *W. B. CHAMBERLIN, ESQ. *H. CLIFFORD-SMITH, ESQ. SIR FREDERICK COOK, BT. *HERBERT F. COOK, ESQ. CAPTAIN R. LANGTON DOUGLAS. *ROGER E. FRY, ESQ. THE CORPORATION OF GLASGOW. *HENRY HARRIS, ESQ. J. P. HESELTINE, ESQ. *LT.-CoL. SIR GEORGE HOLFORD, K.C.V.O., C.I.E. NATIONAL GALLERY OF IRELAND. LADY JEKYLL. *VISCOUNT LASCELLES, D.S.O. MAJOR W. L. LUCAS. J. SEYMOUR LUCAS, R.A. *LT.~COLONEL L. C. R. MESSEL. *RT. HON. SIR ALFRED MONO, BT., M.P. *HENRY OPPENHEIMER, ESQ. MRS. HENRY OPPENHEIMER. UNIVERSITY OF OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM. LIST OF CONTRIBUTORS UNIVERSITY OF OXFORD, CHRIST CHURCH. C. RICKETTS, ESQ. C. SHANNON, ESQ., A. R.A. *CAPTAIN E. G. SPENCER-CHURCHILL. REV. CANON J. O. STEPHENS. RT. HON. THE LADY WANTAGE. VERNON WATNEY, ESQ. -

Visualizing Dynasty and Dissent in Jacopo Pontormo's Portrait Of
Visualizing dynasty and dissent in Jacopo Pontormo’s Portrait of Cosimo il Vecchio Mary Hogan Camp Figure 1 Pontormo, Portrait of Cosimo il Vecchio, c. 1519, oil on panel, 90 x 72 cm Uffizi Gallery (inv. 1890, n. 3574), Florence. Photograph courtesy of Wikimedia Commons (Public Domain) The Portrait of Cosimo il Vecchio, c. 1519, marked the first Medicean portrait commission for the rising young Florentine artist Jacopo Pontormo (b.1494). [Figure1] It proved pivotal in his career, garnering him the favour and patronage of the Medici, who would continue to give him commissions and eventually place him on their payroll, where he remained for over twenty-four years until his death in 1556.1 At the time this commission was given, however, there was no such future surety: the family was facing a crisis, and the survival of the Medici line was in grave doubt. In 1516, Duke Giuliano de’ Medici, the youngest son of Lorenzo the Magnificent and ruler of Florence, had died childless at the age of thirty-seven. In 1519, his twenty-six-year-old nephew and successor, Duke Lorenzo, succumbed to a combination of syphilis and tuberculosis just twenty-one days after the birth of his only daughter Catherine. Their unexpected deaths left the family with no legitimate heir to power. There was one 1 Elizabeth Pilliod, Pontormo, Bronzino, Allori: a genealogy of Florentine art, New Haven: Yale University Press, 2001, 17. Journal of Art Historiography Number 17 December 2017 Mary Hogan Camp Visualizing dynasty and dissent in Jacopo Pontormo’s Portrait of Cosimo il Vecchio glimmer of hope, and of a hoped-for change in fortune: the birth of a healthy son to Maria Salviati, granddaughter of Lorenzo the Magnificent, on 12 June 1519, only one month after Duke Lorenzo’s death. -

The Production Methods of Neri Di Bicci and the Prevalence of Cartoon Usage in Fifteenth-Century Florence
The Production Methods of Neri di Bicci and the Prevalence of Cartoon Usage in Fifteenth-Century Florence Jennifer Adrienne Diorio A thesis submitted to the Graduate Program in the Department of Art in conformity with the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada August 2013 Copyright © Jennifer Adrienne Diorio 2013 ABSTRACT Florentine artist Neri di Bicci (1418-1492) was one of the most prolific and financially successful artists of the fifteenth century. The hundreds of extant paintings from his workshop are a testament to his industry, which is further underlined by a close examination of the 798 entries he wrote between 1453 and 1475 in his account book, his Ricordanze. The purpose of this dissertation is to analyse the monetary and social history in Neri’s Ricordanze in order to provide a framework for an exploration of the way that paintings were constructed in Neri’s workshop, and a close examination of the evidence concerning collaboration between Neri and his contemporaries. This thesis determined that the repeated use of full-size paper patterns, known as cartoons, was a key aspect of Neri’s painting procedure. Cartoon usage was established by overlaying scaled images of paintings in Photoshop, which demonstrated that the outlines of many of Neri’s figures and architectural designs were identical. Analysing the price of Neri’s paintings also revealed trends which suggested that he used cartoons. Half of the 224 objects described in the Ricordanze cost 30 lire or less, and the average of the 40 paintings between two and four square meters was 151 lire, less than half the regional average for paintings of comparable size. -

The Florentine Painters of the Renaissance
Portrait of a Lady. From the Painting, possibly by Verrocchio, in the Poldi Museum at Milan. THE FLORENTINE PAINTERS OF THE RENAISSANCE WITH AN INDEX TO THEIR WORKS BY BERNHARD BERENSON AUTHOR OF “VENETIAN PAINTERS OF THE RENAISSANCE,” “LORENZO LOTTO,” “CENTRAL ITALIAN PAINTERS OF THE RENAISSANCE” THIRD EDITION, REVISED AND ENLARGED G. P. PUTNAM’S SONS NEW YORK AND LONDON The Knickerbocker Press COPYRIGHT, 1896 BY G. P. PUTNAM’S SONS Entered at Stationers’ Hall, London COPYRIGHT, 1909 BY G. P. PUTNAM’S SONS (For revised edition) Made in the United States of America iiiPREFACE TO THIRD EDITION Years have passed since the second edition of this book. But as most of this time has been taken up with the writing of my “Drawings of the Florentine Painters,” it has, in a sense, been spent in preparing me to make this new edition. Indeed, it is to that bigger work that I must refer the student who may wish to have the reasons for some of my attributions. There, for instance, he will find the intricate Carli question treated quite as fully as it deserves. Jacopo del Sellajo is inserted here for the first time. Ample accounts of this frequently entertaining tenth-rate painter may be found in articles by Hans Makowsky, Mary Logan, and Herbert Horne. The most important event of the last ten years, in the study of Italian art, has been the rediscovery of an all but forgotten great master,iv Pietro Cavallini. The study of his fresco at S. Cecilia in Rome, and of the other works that readily group themselves with it, has illuminated with an unhoped-for light the problem of Giotto’s origin and development. -

The Florentine Painters of the Renaissance / with an Index to Their Works
The Project Gutenberg EBook of The Florentine Painters of the Renaissance, by Bernhard Berenson This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: The Florentine Painters of the Renaissance With An Index To Their Works Author: Bernhard Berenson Release Date: December 28, 2005 [EBook #17408] Language: English *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK THE FLORENTINE PAINTERS *** Produced by Juliet Sutherland, Louise Pryor and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net Portrait of a Lady. From the Painting, possibly by Verrocchio, in the Poldi Museum at Milan. Portrait of a Lady. From the Painting, possibly by Verrocchio, in the Poldi Museum at Milan. THE FLORENTINE PAINTERS OF THE RENAISSANCE WITH AN INDEX TO THEIR WORKS BY BERNHARD BERENSON AUTHOR OF “VENETIAN PAINTERS OF THE RENAISSANCE,” “LORENZO LOTTO,” “CENTRAL ITALIAN PAINTERS OF THE RENAISSANCE” THIRD EDITION, REVISED AND ENLARGED G. P. PUTNAM’S SONS NEW YORK AND LONDON The Knickerbocker Press COPYRIGHT, 1896 BY G. P. PUTNAM’S SONS Entered at Stationers’ Hall, London COPYRIGHT, 1909 BY G. P. PUTNAM’S SONS (For revised edition) Made in the United States of America PREFACE TO THIRD EDITION Years have passed since the second edition of this book. But as most of this time has been taken up with the writing of my “Drawings of the Florentine Painters,” it has, in a sense, been spent in preparing me to make this new edition. -

Ars Hungarica 41. Évf. 3. Sz. (2015.)
Sonnevend Margit Pesellino oltároromzat-töredéke az esztergomi Keresztény Múzeumban Sonnevend Margit, MA művészettörténész, az ELTE BTK Művészettörténet-tudományi doktori iskola hallgatója Francesco di Stefano (Pesellino) fennmaradt műveit tekintve a Keresz- Kutatási területe: tény Múzeum Kálvária-ábrázolása1 (1. kép) azok közé tartozik, amelyek - 14–15. századi firenzei festészet ről mindeddig nem készült mélyreható művészettörténeti elemzés. Je- E-mail: [email protected] len írás ezt a hiányt igyekszik pótolni: a festő munkásságának közel azonos korú emlékei alapján egyrészt az esztergomi töredék pontos Margit Sonnevend MA art historian, PhD student, datálására tesz kísérletet, másrészt ismerteti a mű eredeti kontextusának 2 Eötvös Loránd University, rekonstruálásával kapcsolatos észrevételeket. Art History Doctoral Programme A festőt kevéssé ismerő olvasóknak jelzem, hogy Pesellino 1422 Areas of research: Florentine painting in 3 és 1457 között élt Firenzében. Egyetlen dokumentált műve a londoni the 14th–15th centuries National Galleryben található,4 eredetileg Pistoiába készült Szenthá - E-mail: [email protected] romság-oltár, amelyet a festő váratlan halála után 1458 és 1460 kö zött Filippo Lippi és mű helye fejezett be Pratóban.5 Pesellino általá nosan el fogadott,6 Vasari által 1 Pesellino (Francesco di Stefano): Keresztre feszített Krisztus, Máriával és Szent János evangélistával. Esztergom, Keresz- tény Múzeum, ltsz. 55.184; a fatábla mérete 88,7×42 cm. 2 A Budapesti Történeti Múzeum Boskovits Miklós és Magyarország című konferenciáján (2014. március 22.) elhang- zott előadás bővített változataként megjelenő szöveg az említett műtárggyal kapcsolatban egy készülő doktori disszertá ció néhány újabb eredményét foglalja össze. A kézirat átolvasásáért köszönet illeti témavezetőmet, dr. Eörsi Annát, valamint azokat a firenzei és római művészettörténészeket (Prof. -

Kanter, Laurence CV December 2014
Laurence B. Kanter Chief Curator and Lionel Goldfrank III Curator of European Art Yale University Art Gallery P. O. Box 208271 New Haven, CT 06520-8271 (203) 432-8158 Education: B.A. Oberlin College, Oberlin, Ohio - May 1976 M.A. Institute of Fine Arts, New York University, February 1980 Ph.D. Institute of Fine Arts, New York University, June 1989 Dissertation: The Late Works of Luca Signorelli and His Followers Employment: Yale University Art Gallery, New Haven, CT Chief Curator and Lionel Goldfrank III Curator of European Art July 2011 to present Yale University Art Gallery, New Haven, CT Lionel Goldfrank III Curator of European Art September 2002 to June 2011 The Metropolitan Museum of Art, New York Curator-in-Charge, Robert Lehman Collection July 1988 to July 2007 Museum of Fine Arts, Boston, MA Assistant Curator, Department of Paintings September 1985 to July 1988 Colnaghi & Co., New York Director, Old Master Paintings October 1984 to May 1985 The Metropolitan Museum of Art, New York Research Assistant, Department of European Paintings February 1977 to May 1982 Laurence B. Kanter Appointments: The Metropolitan Museum of Art, New York Consultant, July 2007 – June 2010 Center for Advanced Study in the Visual Arts, Washington Board of Advisors, 2004 – 2007 Timken Museum, San Diego Visiting Committee American Friends of the Warburg Institute Honorary Committee Teaching: University of Massachusetts, Boston “Sixteenth-century Painting in Italy” (undergraduate lecture), 1987 Museum of Fine Arts, Boston “Fourteenth- and Fifteenth-century -

Lucchese, Aretine, and Umbrian Schools Xiii Century Florentine, Venetian, Paduan, Modenese, and Sienese Schools Xiii-Xiv Century
LUCCHESE, ARETINE, AND UMBRIAN SCHOOLS XIII CENTURY FLORENTINE, VENETIAN, PADUAN, MODENESE, AND SIENESE SCHOOLS XIII-XIV CENTURY LUCCHESE SCHOOL, c. I200 MARGARITONE KI7I5 : Figure 6 Margarito d'Arezzo, called by Vasari Margaritone. School of Arezzo. Active second half of thirteenth century. There MADONNA AND CHILD. EI Paso, Tex., El Paso Museum is only one documentary reference to him, in 1262; but he of Art {1961-6/1}, since 1961.1 Transferred from wood to signed a number ofpaintings. Probably trained in Florence, masonite {1950-51}. 46kx30! in. {II8'2X78'2 cm.}, with he progressed from a very flat style to a somewhat more out moldings. Good condition; cleaned very slightly 1953. plastic manner. Lucca was the center of the most important Tuscan School KI347 : Figure I of painting during the twelfth century and well into the thirteenth. The work of the early period was varied and MADONNA AND CHILD ENTHRONED. Washington, rich; by the early thirteenth century it had become less D.C., National Gallery of Art {807}, since 1945. Wood. exuberant, more stereotyped and uniform. Though 38kx 19k in. {97X49.5 cm.}. Inscribed, with the artist's executed by a heavier hand, KI715 seems to go back for in signature, at bottom: MARGARIT' [de a] RITIO ME FECIT spiration to the figures of the holy women in scenes on the {Margaritus of Arezzo made me}.l Fair condition. earliest surviving panel from the School of Lucca, the painted cross signed by Guglielmo and dated II 38 in the The lack of perspective in this painting - only the footstool Cathedral of -

Xv Century Italian Drawings from the Robert Lehman Collection 1978 Xv Century Italian Drawings from the Robert Lehman Collection
XV CENTURY ITALIAN DRAWINGS FROM THE ROBERT LEHMAN COLLECTION 1978 XV CENTURY ITALIAN DRAWINGS FROM THE ROBERT LEHMAN COLLECTION CATALOGUE BY GEORGE SZABO THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART NEW YORK Antonio Pollaiuolo Study for an equestrian monument to Francesco Sforza Introduction Fifteenth-century Italian drawings, among the rarest and most treasured works of art in any great museum, are exception ally well represented in the Robert Lehman Collection at The Metropolitan Museum of Art. It contains forty-five drawings, all of which are shown in this exhibition. This distinguished group includes drawings by artists from many great Italian centers: Siena, Florence, Venice, and Verona. The roster of individual masters too is impressive: Stefano da Verona, Francesco del Cossa, Antonello da Messina, Ercole de'Roberti, Giovanni Bellini, Francesco di Giorgio Martini, Fra Bartolomeo, and Leonardo da Vinci are all represented by outstanding sheets. Be sides the firmly attributed drawings, there are many that may still present a challenge to connoisseurs and scholars with their problems of dating and attribution. The works in this exhibition not only represent an impor tant aspect of Robert Lehman's collecting activity, but also document an interesting phase in the history of collecting. Mr. Lehman acquired the majority of these drawings as the first American collector "to follow the lead of Pierpont Morgan" in the 1920s and 1930s. Many of the earliest drawings are from the sales of such distinguished collections as that of Luigi Grassi (1924) and Henry Oppenheimer (1936). A large number of the drawings are exhibited here in six teenth- and seventeenth- century frames, themselves works of art. -

Giovanni Di Francesco and the Master of Pratovecchio
GIOVANNI DI FRANCESCO AND THE MASTER OF PRATOVECCHIO Burton B. Fredericksen The J. Paul Getty Museum Cover: Detail of St. Michael, from wing of Getty triptych Copyright ©1974 The J. Paul Getty Museum Publication number 6 Contents 4 Acknowledgments 6 The Triptych at The J. Paul Getty Museum 16 Paintings in Other Collections 28 Appendix: Attributions Not Accepted 32 Notes 40 Plates Acknowledgments The present book has taken some three or more years to produce and the basic results have already been published in abbreviated form in the Catalogue of Paintings which appeared in 1972. As with that publication, much of the preliminary editing was done by Mrs. Ann Karlstrom whose valuable assist ance was unfortunately lost to us when she left the museum in 1973. In spite of later additions and insertions, the basic form of the finished product owes much to her kind counsel. The final editing and the design of the entire book is due to the patient work of Lilli Cristin whose firm hand has kept both myself and the book from going astray. It is through her efforts that it has not taken still longer to reach published form. Burton B. Fredericksen Malibu, September 1974 4 The Triptych at The J. Paul Getty Museum 5 Five years ago Mr. Getty purchased for the Getty origins. In itself it did not say a great deal because it Museum a large triptych depicting a Madonna and did not specify which badia was meant, nor even in Child in the center, with a saint on either wing (figs. -

A Text-Book of the History of Painting
,'.";„' l«SSl^.^#::d^K:tig 'i:'..)' 'li' vtTi '•/.'jX.'-ur;*.'! ./ NpSa St Ac ^, Slljata. JJtai ^otk COLLEGE OF ARCHITECTURE LIBRARY :,- \ Cornell University Library ND 50.V28 1915 A text-book of the history of painting, 3 1924 015 225 083 COLLEGE HISTORIES OF ART KDIIED BY JOHN C. VAN DYKE, L.H.D. HISTORY OF PAINTING JOHN C. VAN DYKE COLLEGE HISTORIES OF ART EDITED BY JOHN C. VAN DYKE, L.H.D. Professor of the History of Art in Rutgers College HISTORY OF PAINTING By John C. Van Dyke, the Editor of the Series. With Frontispiece and 152 Illustrations, Bibliographies, and Index. Crown 8vo, net, $1.50. HISTORY OF ARCHITECTURE By Alfred D. F. Hamlin, A.M., Professor of the His- tory of Architecture, Columbia University, New York. With Frontispiece and 235 Illustrations and Diagrams, BibUographies, Glossary, Index of Architects, and a General Index. Crown 8vo, net, §2.00. HISTORY OF SCULPTURE By Allan Maequand, Ph.D., L.H.D., Professor of Art and Archaeology in Princeton University, and ARTHirR L. Frothingham, Jr., Ph.D. With Frontispiece and 113 Illustrations. Crown 8vo, net, $1.50. TITIAN. LA BELLA. PITTI, FLORENCE. A TEXT-BOOK OF THE HISTORY OF PAINTING BY JOHN C. VAN DYKE, L.H.D. PROFESSOR OF THF. HISTORY OF ART IN RUTGERS COLLEGE, AND AUTHOR OF " ART FOR ARt's SAKE," "the meaning OF PICTURES," "neVV GUIDES TO OLD MASTERS," ETC. NEW EDITION LONGMANS, GREEN, AND CO. FOURTH AVENUE AND 30TH^ STREET, NEW YORK LONDON, BOMBAY, CALCUTTA AND MADRAS I915 COPYRIGHT, 1094, BY LONGMANS, GREEN, AND CO. -
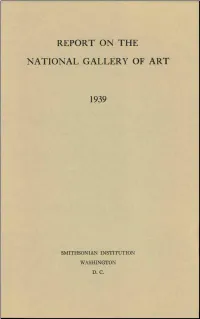
Annual Report 1939
REPORT ON THE NATIONAL GALLERY OF ART 1939 SMITHSONIAN INSTITUTION WASHINGTON D. C. REPORT ON THE NATIONAL GALLERY OF ART FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1939 From the Smithsonian Report for 1939 Pages 32-46 IPERX UNITED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE WASHINGTON : 1940 APPENDIX 2 REPORT ON THE NATIONAL GALLERY OF ART SIR : Pursuant to the provisions of section 5 (D) of Public Resolu- tion No. 14, Seventy-fifth Congress, approved March 24, 1937,1 have the honor to submit, on behalf of the Board of Trustees of the Na- tional Gallery of Art, the second annual report of the Board covering )its operations for the fiscal year ended June 30,1939. Under the aforementioned joint resolution, Congress appropriated "to the Smithsonian Institution the area bounded by Seventh Street, ^Constitution Avenue, Fourth Street, and North Mall Drive (now Madison Drive) Northwest, in the District of Columbia, as a site for a National Gallery of Art; authorized the Smithsonian Institu- tion to permit The A. Mellon Educational and Charitable Trust, a public charitable trust, established by the late Hon. Andrew W. Mellon, of Pittsburgh, Pa., to construct thereon a building to be designated the "National Gallery of Art"; and created, in the Smith- sonian Institution, a bureau to be directed by a board to be known as the "Trustees of the National Gallery of Art," charged with the maintenance and administration of the National Gallery of Art. The Board is comprised of the Chief Justice of the United States, the Secretary of State, the Secretary of the Treasury, and the Secre- tary of the Smithsonian Institution, ex officio, and five General Trustees.