Berlin Und Bonn 40 Casting
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Namu Conference 2008
NaMu IV Appropriations of Antiquity – A Diachronic Comparison of Museums and Scholarship Johannes Siapkas & Lena Sjögren Uppsala University & Stockholm University [email protected] & [email protected] Sculpture from ancient Greece and Rome is an emblematic category of high art in the western museum tradition. Accordingly, displays of ancient sculpture in museums form an instructive case study for a wide-reaching, comparative analysis of museological developments from the 18th century and onwards. Isolating a category of exhibited objects like ancient sculptures is fruitful for a comparative approach because it transcends national traditions. It is hard to pinpoint differences in displays of ancient sculptures that can be attributed to, or explained by, national traditions. The appropriation of the classical legacy in various national traditions should not be viewed as an excluding facet of a unique national identity, but is often better understood as an inclusive part of the national identity since it signals that the specific nation belongs within a wide cultural sphere. In contrast, our empirical examples suggest that there are closer similarities between the theoretical developments in academia and museums. In this paper, therefore, we aim to elaborate on the chronological development of sculpture exhibitions and identify the discursive foundations that scholarship and museum exhibitions share. Drawing on this, it can tentatively be concluded the development of displays of ancient sculpture is associated closer to the development in academia than to national museological traditions. From our perspective, museums can be viewed as an integrated part of the institutions of knowledge. 205 Introduction Museum displays of ancient sculptures are potentially an instructive case study for a wide- reaching, comparative analysis of museological developments from the 18th century onwards. -

Kassiber an Den Doktorvater Erinnerungen Zum Dritten Todestag Des Bonner Archäologen Nikolaus Himmelmann
BABESCH 91 (2016), 247-258. doi: 10.2143/BAB.91.0.3175653 Kassiber an den Doktorvater Erinnerungen zum dritten Todestag des Bonner Archäologen Nikolaus Himmelmann Stephan Lehmann Zusammenfassung Einer der bedeutendsten Klassischen Archäologen der Nachkriegszeit, Nikolaus Himmelmann, starb im Jahr 2013. Als sein Schüler versuche ich, im Lichte meiner persönlichen und fachlichen Erinnerungen dem akademischen Lehrer und berühmten Wissenschaftler hier ein kleines Denkmal zu setzen. Seit seiner Promotion im Jahre 1954 arbeitete Himmelmann - später auch als Professor an der Bonner Universität - bis zu seinem Tode für sein Fach. Die vielen internationalen Ehrungen weisen auf seine Anerkennung als Archäologe hin und die zahllosen Publikationen zeugen von der eminenten Bedeutung als Wissenschaftler. Kaum ein zentrales Thema der antiken Kunst und Kultur, zu dem er sich nicht geäußert hätte. Im Zentrum seiner Arbeit stand aber immer die Bedeu- tung der griechischen Religion für die jeweilige Kunst- und Lebenswelt, die Reflektion archäologischer Methodik und vor allem die Darstellung des Menschen von der homerischen Zeit bis zur Gegenwart. Hierbei interessierte ihn zum einen die realistische Darstellungsweise des antiken Menschen in der Kunst, etwa als Sklave und Handwerker, wie auch die idealisierende künstlerische Darstellung von Athleten, Intellektuellen und Politikern. Die Ausstellung ‘Herrscher und Athlet’ im Akademischen Kunstmuseum Bonn aus dem Jahr 1989 bedeutete für ihn, dem die Arbeit mit dem archäologischen Gegenstand von besonderer Bedeutung war, einen Höhepunkt. Zweifellos war Himmelmann von seiner fachlichen Ausstrahlung ein kosmopolitischer und zugleich deutsch- deutscher Archäologe, der auch von seiner akademischen Herkunft wie auch von seinem Selbstverständnis her, die bedeutenden Traditionen der Archäologie durch den Eisernen Vorhang nicht unterbrochen sah. -

Bonn for Beginners 2006We
Bonn for Beginners A Guide for Newcomers to the Federal City Contents Page PART 1 We Are Bonn – Bonn at its Best 4 1.1 Bonn in Brief 4 1.2 Local Self-Government in Bonn 5 1.3 History of the City 6 1.4 The Federal City of Bonn 8 1.5 Bonn's New Profile 9 1.6 Bonn, a Region of Science and Research 10 1.7 Bonn is Culture 11 1.8 From the Museum Mile to the Kunstcarré 15 1.9 Beethoven in Bonn 19 1.10 Business Location Bonn 20 1.11 Bonn is International 21 1.12 Bonn(e) Cuisine 22 1.13 Bonn City Twinnings 23 PART 2 - A Practical Guide 25 2.1 Education & Profession 25 2.1.1 Education 25 2.1.1.1 Schools and Child Care in Bonn 25 2.1.1.2 The German School System 25 2.1.1.3 Foreign and International Schools and Tuition 26 2.1.1.4 Music schools 29 2.1.1.5 Language schools 29 2.1.2 The University of Bonn 31 2.1.3 The Job Market 34 2.2 Children’s Corner 36 2.3 All about residence 38 2.3.1 Housing and rents 38 2.3.2 Real Estate Market 39 2.3.3 Cost of Living 39 2.4 Transports & Travel 40 2.4.1 Air Travel 40 2.4.2 Rail Travel 41 2 2.4.3 Buses, Trams, Underground 42 2.4.4 Taxis 43 2.4.5 Cycling 43 2.4.6 Driving in Bonn 44 2.4.7 Traffic Regulations 44 2.5 Leisure Time 45 2.5.1 Sports and Recreation 45 2.5.2 Leisure and weekend activities and excursions 45 2.5.3 Libraries 50 2.5.4 Cinema 51 2.5.5 Shopping in Bonn 52 2.5.6 Holidays in North Rhine-Westphalia 52 2.5.7 Religious Services 53 2.6 Banking 56 2.7 Who’s Who of Formalities 57 2.7.1 Registration with the Authorities 57 2.7.2 Residence Permit 58 2.7.3 Motor Vehicle Registration 58 2.7.4 Driving Licence -

Bonn for Beginners 2012 Teile 1 U2 Neu August
Bonn for Beginners A Guide for Newcomers 1 Contents Page PART 1: We Are Bonn – Bonn at its Best 1.1 Bonn in Brief 4 1.2 Local Self-Government in Bonn 5 1.3 History of the City 6 1.4 The Federal City of Bonn – Some Facts and Figures 8 1.5 Bonn's New Profile 9 1.6 Bonn, a Region of Science and Research 12 1.7 Bonn Is Culture 13 1.8 Museum Mile, Kunstcarré and More 15 1.9 Beethoven in Bonn 20 1.10 Business Location Bonn 21 1.11 City Twinning and Project Partnerships 23 1.12 Bonn Is International 25 1.13 Bonn (e) Cuisine 26 PART 2: A Practical Guide 2.1 All about Residence 28 2.1.1 Housing and Rents 28 2.1.2 Standard of Living, Security and Crime Rate 29 2.2 Transport and Travel 29 2.2.1 International Travel Connections and Local Transportation 29 2.2.2 Driving in Bonn 30 2.3 Education and Profession 31 2.3.1 The German School System 31 2.3.2 Schools in Bonn 32 2.3.3 The University of Bonn 38 2 2.3.4 Child Care in Bonn 41 2.3.5 Other Educational Offers in Bonn 44 2.3.6 The Job Market 46 2.4 Banking 47 2.5 Culture – Leisure – Sports 48 2.6 Religious Services 52 2.7 Environment and Waste Management 56 2.8 Medical Care 56 2.8.1 Emergency Telephone Numbers 56 2.8.2 Doctors and Rehabilitation 56 2.8.3 Pharmacies 57 2.8.4 Hospitals 58 2.9 Who’s Who of Formalities 58 2.9.1 Registration with the Authorities 58 2.9.2 Residence Permit 58 2.9.3 Motor Vehicle Registration 59 2.9.4 Driving License 60 2.9.5 Car Insurance 60 2.9.6 Animals 61 2.9.7 Civic Offices 61 2.9.8 Utilities 61 2.9.9 Telephone, Internet and Postal Services 62 2.9.10 Television and Radio 63 Annex Living in Germany – Some Tips and Hints 64 Living in Bonn – Some Tips and Hints 66 Imprint 3 Part 1 1.1 Bonn in Brief Geographical Location: Bonn, the gateway to the romantic Middle Rhine, is situated north of the Siebengebirge hills on the southern end of the Cologne Bight (50° 43’14’’ north, 7° 7’4’’ east). -
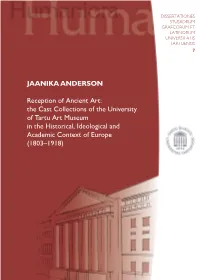
JAANIKA ANDERSON Reception of Ancient
DISSERTATIONES JAANIKA ANDERSON JAANIKA STUDIORUM GRAECORUM ET LATINORUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 7 Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum of Ancient Art: of Tartu the Cast Collections of University Reception JAANIKA ANDERSON Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum in the Historical, Ideological and Academic Context of Europe (1803–1918) Tartu 2015 ISSN 1406-8192 ISBN 978-9949-32-768-3 DISSERTATIONES STUDIORUM GRAECORUM ET LATINORUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 7 DISSERTATIONES STUDIORUM GRAECORUM ET LATINORUM UNIVERSITATIS TARTUENSIS 7 JAANIKA ANDERSON Reception of Ancient Art: the Cast Collections of the University of Tartu Art Museum in the Historical, Ideological and Academic Context of Europe (1803–1918) Faculty of Philosophy, University of Tartu This dissertation was accepted for the commencement of the decree of Doctor of Philosophy (Classical Philology) on January 30, 2015 by the Committee of the College of Foreign Languages and Cultures of the University of Tartu. Supervisors: Kristi Viiding, Professor of Classical Philology, Department of Classical Philology, University of Tartu Epi Tohvri, Associate Professor, Department of Technology, Tartu College of Tallinn University of Technology Opponents: Prof. Dr. Lorenz Winkler-Horaček, curator, Institut für Klassische Archäologie der Freien Universität Berlin und Abguss-Sammlung Antiker Plastik, Berlin Dr. Aira Võsa, researcher, Tartu University Library Commencement: on March 20, 2015 at 12.15, in the Senate room of the Uni- versity of Tartu (Ülikooli 18). ISSN 1406-8192 ISBN 978-9949-32-768-3 (print) ISBN 978-9949-32-769-0 (pdf) Copyright: Jaanika Anderson, 2015 University of Tartu Press www.tyk.ee ACKNOWLEDGEMENTS I am very grateful to the people who have directly or indirectly contributed to the completion of this dissertation. -

Authenticity and Communication
Special Volume 6 (2016): Space and Knowledge. Topoi Research Group Articles, ed. by Gerd Graßhoff and Michael Meyer, pp. 481–524. Friederike Fless – Bernhard Graf – Ortwin Dally – Ute Franke – Christine Gerbich – Dominik Lengyel – Matthias Knaut – Claudia Näser – Bénédicte Savoy – Laura Katharina Steinmüller – Katharina Steudtner – Moritz Taschner – Catherine Toulouse – Stefan Weber Authenticity and Communication Edited by Gerd Graßhoff and Michael Meyer, Excellence Cluster Topoi, Berlin eTopoi ISSN 2192-2608 http://journal.topoi.org Except where otherwise noted, content is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0 Friederike Fless – Bernhard Graf – Ortwin Dally – Ute Franke – Christine Gerbich – Dominik Lengyel – Matthias Knaut – Claudia Näser – Bénédicte Savoy – Laura Katharina Steinmüller – Katharina Steudtner – Moritz Taschner – Catherine Toulouse – Stefan Weber Authenticity and Communication Authenticity is not an absolute and constant quality inherent in an object or an experience; it is constructed in the process of research. Actors inscribe and attribute it to both material objects and subjective processes like communication and consumption. This article from the research group seeks on the one hand to reflect on the historical scope of action and action patterns among actors from various disciplines between the conflicting priorities of authentication and communication, and on the other to find ways to visualize and opera- tionalize attribution processes through joint reflection. When we look at both history and the discussions fifty years after the Venice Charter, its idea to hand on historic monuments “in the full richness of their authenticity” has turned into an abundance of vibrant action and decision-making. Authenticity; communication; actors; visualization; archaeological heritage; conservation; museum. -

Casting. Ein Analoger Weg Ins Zeitalter Der Digitalisierung?
39 CASTING_ PANEL 1 INSTRUMENTE VON WISSENSCHAFT UND BILDUNG TOOLS OF SCHOLARSHIP AND EDUCATION 40 CASTING_ BERLIN UND BONN R Graphic Recording S.305 41 CASTING_ R Abstract S.304 Nele Schröder-Griebel BERLIN UND BONN STRATEGIEN VON AUFBAU UND AUFSTELLUNG DER ABGUSS-SAMMLUNGEN IM 19. JAHRHUNDERT herrschte eine eigentümliche Konkurrenz zwischen den Abguss-Sammlungen des Aka- demischen Kunstmuseums in Bonn und der Königlichen Museen zu Berlin. Es standen sich dabei zwei bedeutende Gips-Sammlungen gegenüber: Berlin verfügte über die größte Abguss-Sammlung überhaupt, während die Bonner Sammlung als ein Hort der Wissenschaft galt. Beide Sammlungen unterscheiden sich grundlegend hinsichtlich ihrer Genese, ihrer Bedingungen und Entwicklungsmög- lichkeiten sowie ihrer Zielsetzung und Zweckbestimmung. Und sie befanden sich zum Teil auch in heftiger Auseinan- dersetzung. Daher bietet sich ein vergleichender Blick auf die beiden Sammlungen an, insbesondere bezogen auf die Zeiträume von der Gründung der jeweiligen Sammlungen bis ins späte 19. Jahrhundert.1 Welche Interessen standen hinter den Gründungen und welche Triebkräfte? 42 CASTING_ BERLIN UND BONN Figure 1 Eberjagd-Tondo des Konstantinsbogen in Rom, Abguss, erworben 1833 für die Berliner Abguss-Sammlung, Antikensammlung SMB, Inv.-Nr. I.G. 1504 © Antikensammlung SMB / Antonia Weiße 43 CASTING_ BERLIN UND BONN Wie waren die Sammlungen konzipiert, wie waren sie auf- gestellt und wie wurden sie im Laufe der Jahrzehnte erwei- tert und genutzt? BERLIN – EINE SAMMLUNG FÜR DEN AKADEMISCHEN ZEICHENUNTERRICHT In Berlin gründete Kurfürst Friedrich Wilhelm, der spätere König Friedrich I. von Preußen, 1696 die Akademie der Künste, für die eine Sammlung von Abgüssen wahrschein- lich in Rom selbst zusammengestellt wurde. Dies war nur durch die Kontakte der Monarchen zum jeweils regieren- den Papst möglich, zumal es einen regulären Markt für Abgüsse zu dieser Zeit nicht gab. -

Xixth Archaeology and Economy ICCA in the Ancient World
19th International Congress of Classical Archaeology 19TH INTERNATIONAL CONGRESS OF CLASSICAL ARCHAEOLOGY COLOGNE/BONN (GERMANY) Cologne/Bonn (Germany), 22 – 26 May 2018 PROGRAMME • Cologne/Bonn (Germany) XIXth Archaeology and Economy ICCA in the Ancient World Organising committee Martin Bentz (Bonn), Michael Heinzelmann (Cologne) Congress office Diana Wozniok (Cologne), Christian Briesack (Bonn) http://www.aiac2018.de 19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn (Germany) ARCHAEOLOGY AND ECONOMY IN THE ANCIENT WORLD Umschlag_Programmbuch_AIAC_2018.indd 1 08.05.18 12:09 PATRONAGE Under the patronage of the Minister-President of the State of North Rhine-Westphalia Armin Laschet. CO-OPERATION PARTNER aiac_stand_070518.indd 2 08.05.18 13:11 Programme of the 19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn, 22 – 26 May 2018 aiac_stand_070518.indd 3 08.05.18 13:11 4 Table of contents 1. Welcome greetings from the president of the Association for Classical Archaeology ....... 6 2. Foreword by the president of the German Archaeological Institute ................................... 8 3. Welcome to the 19th International Congress of Classical Archaeology .............................. 9 4. History of the International Congress of Classical Archaeology ......................................... 10 5. The 19. International Congress of Classical Archaeology: Archaeology and Economy in the ancient World .................................................................. 14 6. Locations .................................................................................................................................. -

Der Welcker-Ring
Harald Mielsch DerWelcker-Ring eintraditionsobjekt der Bonner Archäologie Friedrich gottlieb Welcker (*, †) war seit Professor für Philologie und Altertums- wissenschaften der neu gegründeten Universität Bonn, Direktor des Akademischen Kunstmuse- ums sowie oberbibliothekar der Universität, seit auch Direktor des museums vaterländischer Altertümer.ergalt als einer der bedeutendsten Professoren der Universität, der in der Literatur- geschichte,der mythologie und Religion und in der Archäologie wichtige Arbeiten vorlegte1. Dazu gehören seine studien zur griechischen tragödie, vorallem zu den nur aus Fragmenten bekannten Werken des Aischylos, deren Zusammengehörigkeit in trilogien wie der bekannten orestie er zuerst erkannte, ferner religionsgeschichtliche und mythologische Werke, die in der von bis erschienenen ›griechischen götterlehre‹ gipfelte, und zahlreiche einzelunter- suchungen zu archäologischen Fragen, sowohl stilistischenals auch vorallem ikonographischen und mythologischen, die in den fünf von an herausgegebenen Bänden ›Alte Denkmäler‹ zusammengefasst sind. ohne politisch direkt aktiv zu sein, war er doch ein Vertreter demokra- tischer ideen, der beiden ›Demagogenverfolgungen‹ mit hausdurchsuchungen und Beschlag- nahme sämtlicher Papiereunter Druck gesetztund mehrfach vomAmt suspendiertwurde ( und ). Vonseinem Wirken zeugen noch heute die alten Bestände der Universitätsbibliothek Bonn und, besser sichtbar,große teile der Abgusssammlung des Akademischen Kunstmuseums, das er ebenso aufgebaut hat, wie er die Anfänge der originalsammlung -

Kultur Und Freizeit Goethe-Institut Bonn Begrüßung Greeting
KULTUR UND FREIZEIT goethe-institut Bonn Begrüßung Greeting Liebe Gäste, Dear guests, herzlich willkommen im goethe-institut Bonn! Welcome to the goethe-institut Bonn! Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. You have made the right decision. Learn German with Mit uns werden Sie Deutsch lernen und Deutschland us and enjoy the opportunity to explore Germany. kennen lernen. The Goethe-Institut is located right in the heart of the Das Goethe-Institut liegt mitten im Univiertel, von hier University district. This allows you to discover Bonn’s aus lässt sich die Innenstadt bequem zu Fuß erobern. city center easily within walking distance. Moreover, Zudem ist Bonn eine lebendige Großstadt. Im Geburts- Bonn is a lively town and the birthplace of Beethoven. ort Beethovens können Sie großartige Konzerte hören You can enjoy great concerts and visit extraordinary und außergewöhnliche Museen besichtigen. Die weltof- museums. As a cosmopolitan city, Bonn is also well fene Stadt ist heute bekannt als Sitz der UN in Deutsch- © Zerrin Kartal / Goethe-Institut Bonn © Goethe-Institut Bonn known as the German base of the United Nations. Ac- land. Tatsächlich ist Bonn ein ideales Ziel für Menschen tually it is an ideal destination for people from all over aus aller Welt, die Kultur und Natur genießen möchten. Es liegt im Rheintal so schön wie the world who are interested both in cultural events and romantic landscapes. The city is in einem Bilderbuch. Beeindruckende Burgen, hohe Felsen, Weinberge und kleine Dörfer situated in the Rhine Valley which is as beautiful as in a picture book. Impressive castles, liegen in unmittelbarer Nähe.