Ranunculus Sektion Batrachium 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
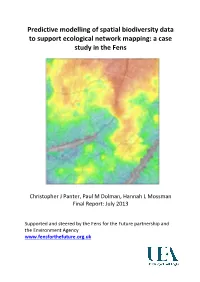
Predictive Modelling of Spatial Biodiversity Data to Support Ecological Network Mapping: a Case Study in the Fens
Predictive modelling of spatial biodiversity data to support ecological network mapping: a case study in the Fens Christopher J Panter, Paul M Dolman, Hannah L Mossman Final Report: July 2013 Supported and steered by the Fens for the Future partnership and the Environment Agency www.fensforthefuture.org.uk Published by: School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, NR4 7TJ, UK Suggested citation: Panter C.J., Dolman P.M., Mossman, H.L (2013) Predictive modelling of spatial biodiversity data to support ecological network mapping: a case study in the Fens. University of East Anglia, Norwich. ISBN: 978-0-9567812-3-9 © Copyright rests with the authors. Acknowledgements This project was supported and steered by the Fens for the Future partnership. Funding was provided by the Environment Agency (Dominic Coath). We thank all of the species recorders and natural historians, without whom this work would not be possible. Cover picture: Extract of a map showing the predicted distribution of biodiversity. Contents Executive summary .................................................................................................................... 4 Introduction ............................................................................................................................... 5 Methodology .......................................................................................................................... 6 Biological data ................................................................................................................... -
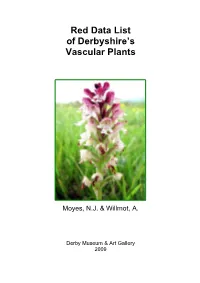
(2009) Red Data List of Derbyshire's Vascular Plants
Red Data List of Derbyshire’s Vascular Plants Moyes, N.J. & Willmot, A. Derby Museum & Art Gallery 2009 Contents 1. Introduction Page 2 2. Red Data List Categories – What’s Included? Page 3 3. What’s Not Included? Page 4 4. Conclusion & Recommendations Page 4 5. Table 1 List of Category 1 Plants Page 5 6. Table 2 List of Category 2 Plants Page 5 7. Table 3 List of Category 3 Plants Page 7 8. Table 4 List of Category 4 Plants Page 8 9. Table 5 List of Category 5 Plants Page 9 10. Table 6 List of Category 6 Plants Page 11 11. References Page 12 Appendix 1 History of Derbyshire Red Data Lists Page 13 Appendix 2 Assessing Local Decline Page 15 Appendix 3 Full List of Derbyshire Red Data Plants Page 18 CITATION: Moyes, N.J. & Willmot, A. (2009) Red Data List of Derbyshire’s Vascular Plants. Derby Museum. 1 1) Introduction County Rare Plant Lists – or Red Data Lists – are a valuable tool to identify species of conservation concern at the local level. These are the plants we should be most concerned about protecting when they are still present, or looking out for if they seem to have declined or become extinct in the locality. All the species named in this Red Data List are native vascular plants in the area, and they either: have a national conservation status in the UK, or are rare in Derbyshire, or have exhibited a significant local decline in recent times, or have become locally extinct. The geographic area in the definition of Derbyshire used here includes: the modern administrative county of Derbyshire, the City of Derby the historic botanical recording area known as the “vice-county” of Derbyshire (VC57). -

CBD First National Report
FIRST NATIONAL REPORT OF THE REPUBLIC OF SERBIA TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY July 2010 ACRONYMS AND ABBREVIATIONS .................................................................................... 3 1. EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................... 4 2. INTRODUCTION ....................................................................................................... 5 2.1 Geographic Profile .......................................................................................... 5 2.2 Climate Profile ...................................................................................................... 5 2.3 Population Profile ................................................................................................. 7 2.4 Economic Profile .................................................................................................. 7 3 THE BIODIVERSITY OF SERBIA .............................................................................. 8 3.1 Overview......................................................................................................... 8 3.2 Ecosystem and Habitat Diversity .................................................................... 8 3.3 Species Diversity ............................................................................................ 9 3.4 Genetic Diversity ............................................................................................. 9 3.5 Protected Areas .............................................................................................10 -

THE IRISH RED DATA BOOK 1 Vascular Plants
THE IRISH RED DATA BOOK 1 Vascular Plants T.G.F.Curtis & H.N. McGough Wildlife Service Ireland DUBLIN PUBLISHED BY THE STATIONERY OFFICE 1988 ISBN 0 7076 0032 4 This version of the Red Data Book was scanned from the original book. The original book is A5-format, with 168 pages. Some changes have been made as follows: NOMENCLATURE has been updated, with the name used in the 1988 edition in brackets. Irish Names and family names have also been added. STATUS: There have been three Flora Protection Orders (1980, 1987, 1999) to date. If a species is currently protected (i.e. 1999) this is stated as PROTECTED, if it was previously protected, the year(s) of the relevant orders are given. IUCN categories have been updated as follows: EN to CR, V to EN, R to V. The original (1988) rating is given in brackets thus: “CR (EN)”. This takes account of the fact that a rare plant is not necessarily threatened. The European IUCN rating was given in the original book, here it is changed to the UK IUCN category as given in the 2005 Red Data Book listing. MAPS and APPENDIX have not been reproduced here. ACKNOWLEDGEMENTS We are most grateful to the following for their help in the preparation of the Irish Red Data Book:- Christine Leon, CMC, Kew for writing the Preface to this Red Data Book and for helpful discussions on the European aspects of rare plant conservation; Edwin Wymer, who designed the cover and who, as part of his contract duties in the Wildlife Service, organised the computer applications to the data in an efficient and thorough manner. -

Ranunculus Sect. Batrachium (Ranunculaceae)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Neilreichia - Zeitschrift für Pflanzensystematik und Floristik Österreichs Jahr/Year: 2016 Band/Volume: 8 Autor(en)/Author(s): Englmaier Peter F. J. Artikel/Article: Ranunculus sect. Batrachium (Ranunculaceae): Contribution to an excursion flora of Austria and the Eastern Alps 97-125 ©Verein zur Erforschung der Flora Österreichs; download unter www.zobodat.at Neilreichia 8: 97–125 (2016) Ranunculus sect. Batrachium (Ranunculaceae): Contribution to an excursion flora of Austria and the Eastern Alps Peter Englmaier Faculty of Life Sciences, University of Vienna, Althanstraße 14, 1090 Vienna, Austria; e-mail: [email protected] Abstract: A treatment of Ranunculus sect. Batrachium is presented for the Eastern Alpine terri- tory as covered by the forthcoming 4th ed. of the “Excursion flora of Austria and the entire Eastern Alps”. A newly designed key as well as alternative keys for terrestrial modificants and vegetative specimens are presented. A new outline for the section is applied including (1) the Ranunculus fluitans group (R. fluitans and R. pseudofluitans); (2) the R. trichophyllus group (R. trichophyl lus, R. confervoides, and R. rionii); (3) the R. aquatilis group, including the R. aquatilis subgroup with R. aquatilis (the only member present in Europe), the R. peltatus subgroup (R. peltatus and R. baudotii) as well as related hybridogenous taxa (R. penicillatus s. str.) and (4) R. circinatus. The distribution of all species is given for the Austrian federal states, the Bavarian Alps, Liechtenstein and the South Alpine regions of Switzerland, Italy and Slovenia. -

Conservation Genetics of Ireland's Sole Population of the River Water Crowfoot (Ranunculus Fluitans Lam.)
Conservation genetics of Ireland's sole population of the River water crowfoot (Ranunculus fluitans Lam.) Bradley, C., Duignan, C., Preston, S. J., & Provan, J. (2013). Conservation genetics of Ireland's sole population of the River water crowfoot (Ranunculus fluitans Lam.). Aquatic Botany, 107, 54–58. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2013.01.011 Published in: Aquatic Botany Document Version: Peer reviewed version Queen's University Belfast - Research Portal: Link to publication record in Queen's University Belfast Research Portal Publisher rights This is the author’s version of a work that was accepted for publication in Aquatic Botany. Changes resulting from the publishing process, such as peer review, editing, corrections, structural formatting, and other quality control mechanisms may not be reflected in this document. Changes may have been made to this work since it was submitted for publication. A definitive version was subsequently published in Aquatic Botany, [VOL 107, (2013)] General rights Copyright for the publications made accessible via the Queen's University Belfast Research Portal is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The Research Portal is Queen's institutional repository that provides access to Queen's research output. Every effort has been made to ensure that content in the Research Portal does not infringe any person's rights, or applicable UK laws. If you discover content in the Research Portal that you believe breaches copyright or violates any law, please contact [email protected]. -
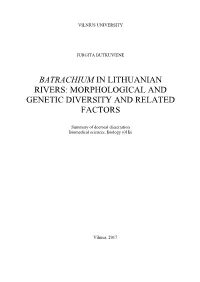
Morphological and Genetic Diversity and Related Factors
VILNIUS UNIVERSITY JURGITA BUTKUVIENĖ BATRACHIUM IN LITHUANIAN RIVERS: MORPHOLOGICAL AND GENETIC DIVERSITY AND RELATED FACTORS Summary of doctoral dissertation Biomedical sciences, Biology (01B) Vilnius, 2017 Dissertation research was carried out at the Vilnius University in 2012 – 2016. Scientific supervisor – prof. dr. Donatas Žvingila (Vilnius University, biomedical sciences, biology – 01B) Scientific consultant – dr. Donatas Naugžemys (Vilnius University, biomedical sciences, biology – 01B) The doctoral dissertation will be defended at the public session of the Council of defence: Chairman – prof. habil. dr. Juozas Rimantas Lazutka (Vilnius University, biomedical sciences, biology – 01B) Members: prof. dr. Darius Danusevičius (A. Stulginskis University, agricultural sciences, forestry – 04A) dr. Ilona Jukonienė (Nature Research Centre, biomedical sciences, biology – 01B) dr. Carla Lambertini (Bologna University, biomedical sciences, biology – 01B) prof. habil. dr. Eugenija Kupčinskienė (Vytautas Magnus University, biomedical sciences, biology – 01B) The doctoral dissertation will be defended at the public session of the Council of defence at 13.00 p.m. on 1st December, 2017 in the R403 auditorium of Life Sciences Center, Vilnius University. Address: Saulėtekio av., 7, Vilnius 10257, Lithuania The summary of the doctoral dissertation was distributed on 30 October, 2017. The dissertation is available at the library of Life Sciences Center, Vilnius University and on the website: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius VILNIAUS UNIVERSITETAS JURGITA BUTKUVIENĖ BATRACHIUM LIETUVOS UPĖSE: MORFOLOGINĖ IR GENETINĖ ĮVAIROVĖ BEI JĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI Daktaro disertacijos santrauka Biomedicinos mokslai, Biologija (01B) Vilnius, 2017 Disertacija rengta 2012 – 2016 metais Vilniaus universitete Mokslinis vadovas – prof. dr. Donatas Žvingila (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B). Mokslinis konsultantas – dr. Donatas Naugžemys (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B). -

Antioxidant and Antibacterial Activities of Ranunculus Marginatus Var. Trachycarpus and R. Sprunerianus
Turk J Biol 34 (2010) 139-146 © TÜBİTAK doi:10.3906/biy-0809-13 Antioxidant and antibacterial activities of Ranunculus marginatus var. trachycarpus and R. sprunerianus Gülen İrem KAYA1,*, Nehir ÜNVER SOMER1, Sibel KONYALIOĞLU2, H. Tansel YALÇIN3, N. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU3, Buket SARIKAYA1, Mustafa Ali ÖNÜR1 1Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Ege University, 35100 Bornova, İzmir - TURKEY 2Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Ege University, 35100 Bornova, İzmir - TURKEY 3Division of Biology, Faculty of Science, Ege University, 35100 Bornova, İzmir – TURKEY Received: 12.09.2008 Abstract: Hexane, ethyl acetate, methanol, and aqueous extracts of Ranunculus marginatus d’Urv. var. trachycarpus (Fisch. & Mey.) Azn. and R. sprunerianus Boiss. were tested in vitro for their antioxidant and antibacterial activities. Antioxidant activity of the extracts was determined by DPPH radical scavenging and Trolox equivalent antioxidant capacity assays. Methanol extracts showed the highest antioxidant activity in both assays. The total phenolics in the extracts were determined colorimetrically by using the Folin-Ciocalteau reagent. The total flavonoid content of the extracts was evaluated by a spectrophotometric method. The results obtained in the antioxidant activity tests were in positive correlation with the total phenolic and flavonoid contents of the extracts. An antibacterial activity analysis was carried out using paper disk diffusion and micro-well dilution techniques. All of the extracts displayed antibacterial activity against the tested bacteria in the disk diffusion method. The minimal inhibitory concentrations (MICs) of all the extracts of both Ranunculus species were found to be between 128 and 256 μg/mL. Key words: Antibacterial activity, antioxidant activity, flavonoid, phenol, Ranunculus marginatus var. -

34 Spring 2008
Spring 2008 Flora News Newsletter of the Hampshire & Isle of Wight Wildlife Trust’s Flora Group Dear Flora Group Member, The Flora Group committee members hope that you had an enjoyable time botanising last year and we look forward to seeing you at some of the events in 2008. This year our AGM will be held at Fleet Pond on Saturday 31 May 2008. If you would like to join the Committee, please let Catherine Chatters know prior to the AGM. Catherine’s address and telephone number are given at the end of this newsletter. As usual, we are always keen to receive your suggestions for events and activities. Please raise your suggestions at the AGM or pass your ideas to any of the Committee members. We are always keen for more people to provide contributions to Flora News on any relevant botanical topics . If you have enjoyed any of the Flora Group events and would like to write a report on it for Flora News, we would be very pleased to receive it. Please send your articles, notes or reports to Catherine. Forthcoming Events There is normally no need to book a place on Flora Group events beforehand, unless the text specifically requests it. A contact ‘phone number is only given in case you wish to know more about the event. The leader can be expected to turn up whatever the weather (although it may then be mutually agreed to cancel the event)! Saturday 9 February 2008, 10 am – 4 pm. Because of restricted space in the museum collection, Leader: Christine Taylor numbers will be strictly limited to 8 on a day. -

Iran, with Ecological and Micromorphological Evidence
ISSN 2226-3063 e-ISSN 2227-9555 Modern Phytomorphology 10 (Suppl.): 25–29, 2016 https://doi.org/10.5281/zenodo.159042 RANUNCULUS POLYRHIZOS AS A NEW RECORD FOR IRAN, WITH ECOLOGICAL AND MICROMORPHOLOGICAL EVIDENCE Mahmoud Bidarlord 1*, Farrokh Gahremaninejad 1, Maneezheh Pakravan 2 Abstract. Ranunculus polyrhizos is reported as a new noteworthy record for the flora of Iran. This species was collected from alpine dry gravelly slope in Talesh Mountains. Taxonomic remarks and notes geographical distribution and habitat for this species are provided. Moreover nectar scale, pollen and achene micromorphological characters of the species are added and compared with related species. Key words: Ranunculus polyrhizos, Talesh Mountains, new record, flora, autoecology 1 Department of Plant Science, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, 49 Dr. Mofatteh av., 15719-14911 Tehran, Iran; *[email protected] 2 Plant Science Department, Faculty of Biological Science, Alzahra University, Dehe Vanak str., 19938-91176 Tehran, Iran Introduction commonly characterized by their tricolpate (rarely pentacolpate) apertures. Genus Ranunculus L. (Ranunculaceae Juss.) Babington (1856) described different with about 60 taxa is one of the largest shape of the nectaries of Ranunculus. Cook genera in the flora of Iran Iranshahr( (1966) introduced three main nectary types: et al. 1992; Naqinezhad et al. 2016). This lunate, circular and pyriform. Subsequently, genus is distributed in different habitats Dahlgren (1992) described eight types of including forests, dry and wet meadows, flood nectaries for subgen. Batrachium. plains, lakes, rivers, and in alpine regions The main classificationsDe ( Candolle (Johansson 1998). Recently, studies have 1818; Tamura 1995; Davis & Cook 1965; been carried out in taxonomy (Pakravan Iranshahr et al. -

60 Spring 2021 Latest
Flora News Newsletter of the Hampshire & Isle of Wight Wildlife Trust’s Flora Group No. 60 Spring 2021 Published February 2021 In This Issue Member Survey .................................................................................................................................................3 Keeping in Touch Flora Group Open Chat Sessions ........................................................... Martin Rand ...............................3 Forthcoming Online Events .........................................................................................................................3 Forthcoming Field Events ...........................................................................................................................5 Reports of Recent Events Zoom Workshop on Flowering Plant Families ........................................ Martin Rand ...............................8 Notes & Features Possible first British record of Linaria vulgaris × L. purpurea .................. John Norton ...............................9 ‘Hello Old Friend’: the reappearance of Mudwort in the New Forest ...... Clive Chatters ..........................13 Small Fleabane: A Miscellany ................................................................. Clive Chatters ..........................14 Hunting for Local Orchids During the 2020 Lockdown ............................ Peter Vaughan .........................16 Reporting New Pests and Diseases of Trees ......................................... Sarah Ball ................................18 Hants -
Ranunculaceae
FLORA DEL VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN RANUNCULACEAE INSTITUTO DE BIOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 2020 Instituto de Biología Directora Susana Magallón Puebla Secretaria Académica Virginia León Règagnon Secretario Técnico Pedro Mercado Ruaro EDITORA Rosalinda Medina Lemos Departamento de Botánica, Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México COMITÉ EDITORIAL Abisaí J. García Mendoza Jardín Botánico, Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México Salvador Arias Montes Jardín Botánico, Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma de México Rosaura Grether González División de Ciencias Biológicas y de la Salud Departamento de Biología Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa Rosa María Fonseca Juárez Laboratorio de Plantas Vasculares Facultad de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Serie Publicación Digital, es un esfuerzo del Departamento de Botánica del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, por continuar aportando conocimiento sobre nuestra Biodiversidad, cualquier asunto relacionado con la publicación dirigirse a la Editora: Apartado Postal 70-233, C.P. 04510. Ciudad de México, México o al correo electrónico: [email protected] Autores: Atanasio Echeverría y Godoy y Juan de Dios Vicente de la Cerda. Año: 1787-1803. Título: Ranunculus dichotomus Moc. & Sessé ex DC. Técnica: Acuarela sobre papel. Género: Iconogra- fía Siglo XVIII. Medidas: 35 cm largo x 24 cm ancho. Reproducida de: Labastida, J., E. Mora- les Campos, J.L. Godínez Ortega, F. Chiang Cabrera, M.H. Flores Olvera, A. Vargas Valencia & M.E. Montemayor Aceves (coords.). 2010. José Mariano Mociño y Martín de Sessé y Lacasta: La Real Expedición Botánica a Nueva España. Siglo XXI/Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.