Als Zitierhinweis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Beta Israel: the Jews of Ethiopia and Beyond
Beta Israel: the Jews of Ethiopia and Beyond. History, Identity and Borders edited by Emanuela Trevisan Semi and Shalva Weil Beta Israel: the Jews of Ethiopia and Beyond. History, Identity and Borders Edited by Emanuela Trevisan Semi and Shalva Weil Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea © 2011 Università Ca’ Foscari Venezia ISBN: 978-88-7543-286-7 Libreria Editrice Cafoscarina srl Dorsoduro 3259, 30123 Venezia www.cafoscarina.it Tutti i diritti riservati. Prima edizione febbraio 2011 CONTENTS Introduction 7 JAMES QUIRIN Personal Reflections on Researching Beta Israel History 11 HAIM ADMOR The Question about the Beta Israel’s Jewish Identity, at the Crossroads of History and Argumentation 25 EMANUELA TREVISAN SEMI East and West through the Conversations between Jacques Faitlovitch and Farid Kassab 45 ALICE JANKOWSKI “An Obligation of Honour”: Glimpses of the Forgotten Story of the Pro-Falasha Committee in Germany 57 JOSEPH (GIUSEPPE ) LEVI Taamerat Emmanuel and Giuseppe Levi. A Friendship between an Ethiopian Jewish Maskil and a Florentine Jewish Rabbi 75 ANITA NUDELMAN AND MELKAMU YAACOV Aleka Yaacov: Undisputed Healer and Leader among Ethiopian Jews 101 SHARON SHALOM The Time of Circumcision in the Beta Israel Community 117 RON ATAR The Performance Practice in Beta Israel Prayers – a Service for the New Moon (ya-Caraqâ Ba’âl): a Case Study 133 SHALVA WEIL Mikael Aragawi: Christian Missionary among the Beta Israel 147 RAVIT COHEN The Ethnography of the Gondar Compound: “Waiting” and what it means 159 EDITH BRUDER The Beit Avraham of Kechene: The Emergence of a New Jewish Community in Ethiopia 181 INTRODUCTION This volume focuses around the issues of history, identity and borders concerning the Beta Israel (Jews of Ethiopia). -

Die Sprache Des Nachbarn. Die Fremdsprache Deutsch Bei
2 Schriften der Matthias-Kramer-Gesellschaft Helmut Glück (Hg.) Die Sprache des Nachbarn Die Fremdsprache Deutsch bei Italienern und Ladinern vom Mittelalter bis 1918 2 Schriften der Matthias-Kramer-Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte des Fremd- sprachenerwerbs und der Mehrsprachigkeit Schriften der Matthias-Kramer-Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte des Fremd- sprachenerwerbs und der Mehrsprachigkeit Herausgegeben von Helmut Glück, Mark Häberlein, Claudie Paye und Konrad Schröder Band 2 2018 Die Sprache des Nachbarn Die Fremdsprache Deutsch bei Italienern und Ladinern vom Mittelalter bis 1918 Herausgegeben von Helmut Glück 2018 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de/ abrufbar. Dieses Werk ist als freie Onlineversion über den Hochschulschriften-Server OPUS (http://www.opus-bayern.de/uni-bamberg/) der Universitätsbiblio- thek Bamberg erreichbar. Kopien und Ausdrucke dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden. Herstellung und Druck: docupoint, Magdeburg Umschlaggestaltung: University of Bamberg Press, Larissa Günther Umschlagbild: Annette Glück-Schmidt, Bamberg © University of Bamberg Press Bamberg, 2018 http://www.uni-bamberg.de/ubp/ ISSN: 2365-3183 ISBN: 978-3-86309-581-9 (Druckausgabe) eISBN: 978-3-86309-582-6 (Online-Ausgabe) URN: urn:nbn:de:bvb:473-opus4-518799 DOI: http://dx.doi.org/10.20378/irbo-51879 In memoriam Hannelore Burger (1946 - 2017) Inhalt Helmut Glück: Die Sprache des Nachbarn. Die Fremdsprache Deutsch in Italien und bei Italienern in Deutschland vom Mittelalter bis 1918. Eine Einführung in diesen Band und sein Thema ....................................... 9 Hans Goebl: Kurze Einführung in die Sprachenvielfalt und Sprachenpolitik der Donaumonarchie in deren Spätphase (1848-1918) .................... -
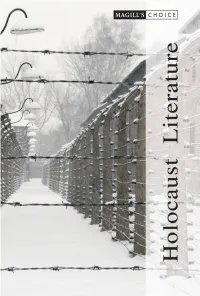
Untitled Poems
Holocaust Literature MAGILL’S CHOICE Holocaust Literature Volume 1 The Accident - Letters and Papers from Prison Edited by John K. Roth Claremont McKenna College SALEM PRESS, INC. Pasadena, California Hackensack, New Jersey Cover photo: © iStockphoto.com/Jason Walton Copyright © 2008, by Salem Press, Inc. All rights in this book are reserved. No part of this work may be used or repro- duced in any manner whatsoever or transmitted in any form or by any means, elec- tronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright owner except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews or in the copying of images deemed to be freely licensed or in the public domain. For infor- mation address the publisher, Salem Press, Inc., P.O. Box 50062, Pasadena, Califor- nia 91115. The paper used in these volumes conforms to the American National Standard for Permanence of Paper for Printed Library Materials, Z39.48-1992 (R1997). Essays originally appeared in Magill’s Literary Annual (1990-2007), Masterplots,Re- vised Second Edition (1996), Masterplots II: American Fiction Series, Revised Edition (2000), Masterplots II: British and Commonwealth Fiction Series (1987), Masterplots II: Christian Literature (2008), Masterplots II: Drama Series, Revised Edition (2004), Masterplots II: Juvenile and Young Adult Biography Series (1993), Masterplots II: Juvenile and Young Adult Fiction Series (1991), Masterplots II: Juvenile and Young Adult Litera- ture Series Supplement (1997), Masterplots II: Nonfiction Series (1989), Masterplots II: Poetry Series, Revised Edition (2002), Masterplots II: Short Story Series, Revised Edi- tion (2004), Masterplots II: Women’s Literature Series (1995), Masterplots II: World Fic- tion Series (1987), and World Philosophers and Their Works (2000). -

The Problem of Psychoneural Isomorphism Between Visual Objects and Their Neural Correlates
Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft THE PROBLEM OF PSYCHONEURAL ISOMORPHISM BETWEEN VISUAL OBJECTS AND THEIR NEURAL CORRELATES Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin/eines Doktors der Philosophie vorgelegt von ALFREDO VERNAZZANI aus NEAPEL (ITALIEN) Referent/-in: Prof. Dr. Tobias Schlicht Koreferent/-in: Prof. Marcin Miłkowski Dekanin: Prof. Dr. Corinna Mieth Mündliche Prüfung BOCHUM, DEN 16. Mai 2018 Eidesstattliche Erklärung Alfredo Vernazzani Vor- und Zuname: 30.07.1984 Geburtsdatum: Neapel (Italien) Geburtsort: Hiermit versichere ich an Eides statt, - dass ich die eingereichte Dissertation selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe verfasst, andere als die in ihr angegebene Literatur nicht benutzt und dass ich alle ganz oder annähernd übernommenen Textstellen sowie verwendete Gra- fiken, Tabellen und Auswertungsprogramme kenntlich gemacht habe. Außerdem versichere ich, dass die vorgelegte elektronische mit der schriftlichen Version der Dissertation übereinstimmt und die Abhandlung in dieser oder ähnlicher Form noch nicht anderweitig als Promotionsleistung vorgelegt und bewertet wurde. [Unterschrift] ORT, DATUM DR. ALFREDO VERNAZZANI Curriculum Vitae — March 2019 EMPLOYMENT AND APPOINTMENTS September 2019 - Visiting Scholar May 2020 HARVARD UNIVERSITY, GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION (accepted) Sponsor: Prof. Catherine Elgin. April 2019 - Post-Doc Researcher (wissenschaftlicher Mitarbeiter) May 2020 RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM October 2018 - Research Fellow March