Energiezukunft Emmental-Oberaargau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dahlia 0Beraargau Huttwil Herzlich Willkommen Im Dahlia Huttwil
dahlia 0beraargau Huttwil Herzlich willkommen im dahlia Huttwil An schönster Lage, etwas abseits vom Lärm und doch eingebettet in die Umge- bung von Huttwil liegt unser Haus südlich in respektvollem Abstand, umschlos- sen von der Langeten. Das Gesundheitszentrum Huttwil der SRO AG befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes. Die vielfältigen Dienstleistungen stossen bei der Bevölkerung auf regen Zuspruch, entsprechend «geschäftig» geht es zu und her im Haus. Selbstverständlich profitieren auch Sie direkt von den Angeboten des Zentrums. So sind beispielsweise der Arzt, die Physiotherapie und weitere spezialärztliche Angebote vor Ort. Wir möchten, dass Sie sich bei uns «wohl und geborgen» fühlen. Dafür sind wir da und geben unser Bestes. Immer gemeinsam mit Ihnen und mit Rücksicht auf Ihre Wünsche und Möglichkeiten. Kommen sie doch einfach mal vorbei und schauen Sie unser Haus an; erleben Sie die Atmosphäre und die Stimmung im dahlia Huttwil. Sie sind herzlich will- kommen. 2 | 3 wohl und geborgen. Wohnen – Betreuen – Pflegen Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Angehörigen wollen wir ein persönliches Sie können Ihrem Tag eine gewisse Struktur geben, zeitliche Orientierung und für Sie gemütliches Ambiente in Ih-rem Zimmer schaffen. Selbstver- und Abwechslung haben. Es gibt vielfäl-tige Möglichkeiten, sich entspre- ständlich können Sie einzelne kleinere Möbelstücke und Erinnerungsge- chend Ihren Wünschen und Fähigkeiten zu beschäftigen. genstände mitbringen, die Ihnen am Herzen liegen. Sie werden rasch mer- ken, auch in einem Zweier- oder Mehrbettzimmer lässt es sich ganz gut Anlässe und Aktivitäten wie Singen, Kochen und Backen, Lotto-Spielen, leben. draussen Grillieren, Konzerte, Spazier-gänge und Ausflüge fördern das ge- meinschaftliche Wohl, regen zu Gesprächen an und nicht selten erwachsen Ein verstellbares Bett, ein Schrank und ein Nachttisch gehören zur Grund- da-raus neue herzliche Freundschaften. -

Jahrbuch Des Oberaargaus 1997
JAHRBUCH DES OBERAARGAUS 1997 Jahrbuch des Oberaargaus 1997 Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde 40. Jahrgang Herausgeber: Jahrbuch-Vereinigung Oberaargau mit Unterstützung von Staat und Gemeinden Umschlagbild: Pedro Meier: Galmis, Niederbipp Geschäftsstelle: Mina Anderegg, 3380 Wangen a. A. Erwin Lüthi, 3360 Herzogenbuchsee Druck und Gestaltung: Merkur Druck AG, Langenthal Inhaltsverzeichnis Vorwort . 7 (Valentin Binggeli, Bleienbach, und Karl H. Flatt, Solothurn) Losgelöst von den Dingen dieser Erde. 9 (Andreas Isenschmid, Redaktor, Zürich) Gerhard Meier und die bildende Kunst. 13 (Christoph Vögele, Kunsthistoriker, Zürich) Johann Heinrich Pestalozzi und Albert Bitzius VDM. 51 (Thomas Multerer, Rektor, Langenthal) Erlebnisse aus dem Oberaargau in Gotthelfs Werken. 71 (Hans Schüpbach, IVS, Bern/Rüderswil) Die Situation des Rehwildes um 1830 – nach Jeremias Gotthelf. 79 (Peter Lüps, Konservator Naturhistorisches Museum, Bern) Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen an Schieferkohlen von Schweinbrunnen/Huttwil. 93 (Samuel Wegmüller, Professor, Mattstetten) Die Alp Vordere Schmiedenmatt. 111 (Samuel Geissbühler, Ingenieur-Agronom, Langenthal) Der Kräuteranbau im Oberaargau. 121 (Thomas Aeschlimann, Ingenieur-Agronom, Langenthal) Bemerkenswerte Bäume im Oberaargau, Teil II. 139 (Ernst Rohrbach, Förster, Rütschelen) Die Wässermatten von Melchnau. 165 (Valentin Binggeli, Bleienbach, und Markus Ischi, Langenthal) Langenthal – Perspektiven einer Stadt. 179 (Hans-Jürg Käser, Stadtpräsident, Langenthal) 36 Jahre Regierungsstatthalter. 185 -

AOA Tarifdokumentation-2019.Pdf
Tarifdokumentation anzeiger oberaargau Adressfeld Post CH AG • PPA 4900 Langenthal • 147. Jahrgang • www.anzeigeroberaargau.ch • Telefon 062 922 65 55 • Fax 062 922 93 27 • Langenthal, 17. Mai 2018 • Nr. 20 Amtliches Publikationsorgan für die Gemeinden, inkl. deren Ortsteile: Aarwangen • Attiswil • Auswil • Bannwil • Berken • Bettenhausen • Bleienbach • Bollodingen • Busswil • Bützberg/Thun stetten Farnern • Gondiswil • Graben • Grasswil • Gutenburg • Heimenhausen • Hermiswil • Herzogenbuchsee • Inkwil • Kleindietwil • Langenthal • Leimiswil • Lotzwil • Madiswil • Melchnau • Niederbipp • Niederönz Oberbipp • Oberönz • Obersteckholz • Ochlenberg • Oeschenbach • Oschwand • Reisiswil • Riedtwil • Roggwil • Rohrbach • Rohrbachgraben • Röthenbach • Rumisberg • Rütschelen • Schwarzhäusern • Seeberg Thörigen • UntersteckholzSehr erfolgreicher • Ursenbach • Start Walliswil für b. die N. • Walliswil b. W. • Wangen a.d. A. • Wangenried • Wanzwil • Wiedlisbach • Wolfisberg • Wynau 2. Ausgabe von «Kunst am Schlossberg» in Melchnau. 25 Kunstschaffende aus dem S. 7 In- und Ausland zeigen ihre Werke. Gottesdienstordnungen Ärztliche Notfall- Kleininserate 2 Kirchliche Anlässe und Gottes- 6 und Betreuungsdienste 9 Marktplatz für alles von A–Z: dienste in der Region – aktuell Unverhofft kommt oft – Geräte, Dienstleistungen, Autos, und kompakt. bitte aufbewahren. Liegenschaften und vieles mehr. VERWALTUNGSKREIS Krankenkassen anerkannt OBERAARGAU www.yinyangmedi.ch Erbenruf 237116/101976 Janaina Roberta Da Silva Gomes, ge- D TCMZENTRUM MITTELLAND boren am -

Bernese Anabaptist History: a Short Chronological Outline (Jura Infos in Blue!)
Bernese Anabaptist History: a short chronological outline (Jura infos in blue!) 1525ff Throughout Europe: Emergence of various Anabaptist groups from a radical reformation context. Gradual diversification and development in different directions: Swiss Brethren (Switzerland, Germany, France, Austria), Hutterites (Moravia), Mennonites [Doopsgezinde] (Netherlands, Northern Germany), etc. First appearance of Anabaptists in Bern soon after 1525. Anabaptists emphasized increasingly: Freedom of choice concerning beliefs and church membership: Rejection of infant baptism, and practice of “believers baptism” (baptism upon confession of faith) Founding of congregations independent of civil authority Refusal to swear oaths and to do military service “Fruits of repentance”—visible evidence of beliefs 1528 Coinciding with the establishment of the Reformation in Bern, a systematic persecution of Anabaptists begins, which leads to their flight and migration into rural areas. Immediate execution ordered for re-baptized Anabaptists who will not recant (Jan. 1528). 1529 First executions in Bern (Hans Seckler and Hans Treyer from Lausen [Basel] and Heini Seiler from Aarau) 1530 First execution of a native Bernese Anabaptist: Konrad Eichacher of Steffisburg. 1531 After a first official 3-day Disputation in Bern with reformed theologians, well-known and successful Anabaptist minister Hans Pfistermeyer recants. New mandate moderates punishment to banishment rather than immediate execution. An expelled person who returns faces first dunking, and if returning a second time, death by drowning . 1532 Anabaptist and Reformed theologians meet for several days in Zofingen: Second Disputation. Both sides declare a victory. 1533 Further temporary moderation of anti-Anabaptist measures: Anabaptists who keep quiet are tolerated, and even if they do not, they no longer face banishment, dunking or execution, but are imprisoned for life at their own expense. -

Regionale Richtplanung Für Windkraftanlagen
Regionale Richtplanung für Windkraftanlagen für die Regionen Emmental, Oberaargau und die Gemeinden Bolligen, Vechigen und Worb der Re- gionalkonferenz Bern-Mittelland 8. September 2010 Teil I Grundlagenbericht nach Art. 6 RPG Teil II Behördenverbindlicher Teilrichtplan nach Art. 98 BauG des Kantons Bern für die Regio- nen Emmental und Oberaargau und die Gemeinden Bolligen, Vechigen und Worb der Re- gionalkonferenz Bern-Mittelland Auftrag Regionale Richtplanung für Windkraftanlagen Auftraggeber Regionen Emmental, Oberaargau, Regionalkonferenz Bern-Mittelland Auftragnehmer Planteam S AG; Genfergasse 10, 3011 Bern Tel. 031 311 44 00 Fax. 031 311 44 46 [email protected]; www.planteam.ch Qualitätssicherung SQS – Zertifikat ISO 9001 am 11. Juli 1999 Projektleitung Roger Michelon, dipl. Kult. Ing. ETH/SIA, Planer FSU/RegA Mitarbeit David Stettler, dipl. Geograf, Planer FSU Referenz roe_schlussbericht_100908.doc Quelle Titelbild: www.immergenugstrom.ch Inhaltsverzeichnis Inhalt TEIL I: GRUNDLAGENBERICHT RICHTPLANUNG WINDKRAFTANLAGEN 1 1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 1 1.1 Ausgangslage 1 1.2 Komplexe Aufgabenstellung mit unterschiedlichen Planungsständen 1 1.3 Projektorganisation 2 1.4 Terminprogramm 3 1.5 Öffentliche Mitwirkung 3 1.6 Kantonale Vorprüfung 4 2 Vorgehen 5 2.1 Grundsätzliches Vorgehen 5 2.2 Betrachtungsperimeter 6 2.3 Grundlagen 7 3 Negativplanung anhand der Windmodelldaten und ausgewählter Beurteilungskriterien 7 3.1 Windexposition 7 3.2 Richtlinien für Windkraftanlagen im Kanton Bern 8 3.2.1 Ausschlusskriterien von nationaler -

Regional Inequality in Switzerland, 1860 to 2008
Economic History Working Papers No: 250/2016 Multiple Core Regions: Regional Inequality in Switzerland, 1860 to 2008 Christian Stohr London School of Economics Economic History Department, London School of Economics and Political Science, Houghton Street, London, WC2A 2AE, London, UK. T: +44 (0) 20 7955 7084. F: +44 (0) 20 7955 7730 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT OF ECONOMIC HISTORY WORKING PAPERS NO. 250 - SEPTEMBER 2016 Multiple Core Regions: Regional Inequality in Switzerland, 1860 to 2008 Christian Stohr London School of Economics Abstract This paper estimates regional GDP for three different geographical levels in Switzerland. My analysis of regional inequality rests on a heuristic model featuring an initial growth impulse in one or several core regions and subsequent diffusion. As a consequence of the existence of multiple core regions Swiss regional inequality has been comparatively low at higher geographical levels. Spatial diffusion of economic growth has occurred across different parts of the country and within different labor market regions at the same time. This resulted in a bell- shape evolution of regional inequality at the micro regional level and convergence at higher geographical levels. In early and in late stages of the development process, productivity differentials were the main drivers of inequality, whereas economic structure was determinant between 1888 and 1941. Keywords: Regional data, inequality, industrial structure, productivity, comparative advantage, switzerland JEL Codes: R10, R11, N93, N94, O14, O18 Acknowledgements: I thank Heiner Ritzmann-Blickensdorfer and Thomas David for sharing their data on value added by industry with me. I’m grateful to Joan Rosés, Max Schulze, and Ulrich Woitekfor several enlightening discussions. -

Rankings Province of Verwaltungskreis Oberaargau
9/28/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links SVIZZERA / Bern / Berne / Province of Verwaltungskreis Oberaargau Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH SVIZZERA Municipalities Powered by Page 2 Aarwangen Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Langenthal AdminstatAttiswil logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Lotzwil Auswil SVIZZERA Madiswil Bannwil Melchnau Berken Niederbipp Bettenhausen Niederönz Bleienbach Oberbipp Busswil bei Melchnau Obersteckholz Eriswil Ochlenberg Farnern Oeschenbach Gondiswil Reisiswil Graben Roggwil (BE) Heimenhausen Rohrbach HerzogenbuchseeRohrbachgraben Huttwil Rumisberg Inkwil Rütschelen Schwarzhäusern Seeberg Thörigen Thunstetten Ursenbach Walliswil bei Niederbipp Walliswil bei Wangen Walterswil (BE) Wangen an der Aare Wangenried Wiedlisbach Wolfisberg Wynau Wyssachen Provinces Powered by Page 3 ARRONDISSEMENTVERWALTUNGSKREIS L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin ADMINISTRATIF FRUTIGEN- Adminstat logo JURA BERNOIS NIEDERSIMMENTALDEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH SVIZZERA VERWALTUNGSKREISVERWALTUNGSKREIS BERN-MITTELLANDINTERLAKEN- OBERHASLI VERWALTUNGSKREIS BIEL/BIENNE VERWALTUNGSKREIS VERWALTUNGSKREISOBERAARGAU EMMENTAL VERWALTUNGSKREIS OBERSIMMENTAL- SAANEN VERWALTUNGSKREIS SEELAND VERWALTUNGSKREIS THUN Regions Aargau Graubünden / Grigioni / Appenzell -

2Melchnauer-Spiegel
*Dorfbach_Mai_2018_*Dorfbach_April_2016 23.04.18 08:44 Seite 1 Melchnauer-Spiegel Mit Informationen der Gemeindebehörden von Melchnau, Busswil und Reisiswil 232. Jahrgang/Mai 2018 • Kunstweg mit vielen Events • Fasnachtsumzug Melchnau • Info-Anlass MZH Melchnau *Dorfbach_Mai_2018_*Dorfbach_April_2016 23.04.18 08:44 Seite 2 $SRWKHNH*HVXQGKHLWV]HQWUXP0(<(55RJJZLO PLW*UDWLV.XQGHQSDUNSOlW]HQ GLUHNWEHLGHU$SRWKHNH $SRWKHNH gIIQXQJV]HLWHQ 0R 1DWXUKHLOPLWWHO 'L)U 7LHUDU]QHLPLWWHO 6D 'URJHULHDEWHLOXQJ $SRWKHNH0(<(5 1DWXUKHLOWKHUDSHXWHQ *HVXQGKHLWV]HQWUXP .RVPHWLN %DKQKRIVWUDVVH 5RJJZLO +DXVOLHIHUGLHQVW 7HO %RQXV&DUG ZZZDSRWKHNHPH\HUFK 2 DR DORFBACH 2/2018 *Dorfbach_Mai_2018_*Dorfbach_April_2016 23.04.18 08:44 Seite 3 IMPRESSUM INHALT Herausgeber Auflage Inhalt Forum Melchnau 1300 Exemplare Dorfbach-Team 2018 Verteiler 3 Impressum Vorstand gratis in alle Haushaltungen Helena Jordi, Präsidentin der Gemeinden Melchnau, 5 Editorial und Sekretariat Busswil und Reisiswil Therese Friedli-Hofer, Kassierin 6 150 Jahre Burger Melchnau und Adressverwaltung Erscheinungsweise 7 Melchnau Facebook/Instagramm Christoph Brunschwiler, Inserate Fünf Ausgaben pro Jahr Redaktion jeweils im Februar, April, Juli, 9 Postschliessung Melchnau Marcel Siegrist Oktober und Dezember Peter Graber © by Redaktion DORFBACH 9 SBB Tageskarten Monika Aeschlimann Änderungen vorbehalten. 11 Schule Melchnau Lektorat Helena Jordi Redaktionstermine 2018 13 Tagesschule Melchnau Monika Aeschlimann Bitte vormerken, reservieren 13 Spielgruppe Schnäggehus Freier Mitarbeiter Peter Roth Ausgabe 3/2018 15 Mehrzweckhalle Melchnau Redaktionsschluss: Manuskripte Donnerstag, 14. Juni 2018 18 Melchnauer Fasnacht sind willkommen. Redaktionssitzung: 21 Turnverein Melchnau Mit der Einsendung erteilt der Montag, 18. Juni 2018 Verfasser die Zustimmung zum Ausgabe 4/2018 23 Einachserrennen Melchnau Abdruck im Dorf bach. Redaktionsschluss: Seitens der Redaktion entstehen Donnerstag, 13. Sept. 2018 24 Kunst am Schlossberg durch die Einsen dung von Redaktionssitzung: 29 ToKJO Manuskripten keinerlei Verpflich- Montag, 17. -
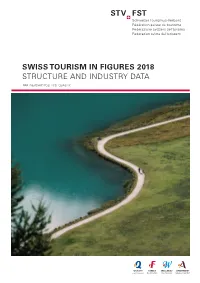
Swiss Tourism in Figures 2018 Structure and Industry Data
SWISS TOURISM IN FIGURES 2018 STRUCTURE AND INDUSTRY DATA PARTNERSHIP. POLITICS. QUALITY. Edited by Swiss Tourism Federation (STF) In cooperation with GastroSuisse | Public Transport Association | Swiss Cableways | Swiss Federal Statistical Office (SFSO) | Swiss Hiking Trail Federation | Switzerland Tourism (ST) | SwitzerlandMobility Imprint Production: Martina Bieler, STF | Photo: Silvaplana/GR (© @anneeeck, Les Others) | Print: Länggass Druck AG, 3000 Bern The brochure contains the latest figures available at the time of printing. It is also obtainable on www.stv-fst.ch/stiz. Bern, July 2019 3 CONTENTS AT A GLANCE 4 LEGAL BASES 5 TOURIST REGIONS 7 Tourism – AN IMPORTANT SECTOR OF THE ECONOMY 8 TRAVEL BEHAVIOUR OF THE SWISS RESIDENT POPULATION 14 ACCOMMODATION SECTOR 16 HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY 29 TOURISM INFRASTRUCTURE 34 FORMAL EDUCATION 47 INTERNATIONAL 49 QUALITY PROMOTION 51 TOURISM ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS 55 4 AT A GLANCE CHF 44.7 billion 1 total revenue generated by Swiss tourism 28 555 km public transportation network 25 497 train stations and stops 57 554 795 air passengers 471 872 flights CHF 18.7 billion 1 gross value added 28 985 hotel and restaurant establishments 7845 trainees CHF 16.6 billion 2 revenue from foreign tourists in Switzerland CHF 17.9 billion 2 outlays by Swiss tourists abroad 175 489 full-time equivalents 1 38 806 777 hotel overnight stays average stay = 2.0 nights 4765 hotels and health establishments 274 792 hotel beds One of the largest export industries in Switzerland 4.4 % of export revenue -

Liste 1 • EVP-Grossratsliste Unverändert in Die Wahlurne Legen
Wahlen 2010 Wichtig ! Am wirkungsvollsten unterstützen Sie uns, wenn Sie eine Liste 1 • EVP-Grossratsliste unverändert in die Wahlurne legen. Wenn Sie den amtlichen (leeren) Wahlzettel benutzen, • schreiben Sie bitte «EVP» in den Listenkopf. So kommen leere Linien der EVP zugute. • Jeder Name darf höchstens 2× aufgeschrieben werden. Motivieren Sie Ihre Familie und Ihre Bekannten zum • EVP-Wählen – jede Stimme kann entscheidend sein! Für die Regierungsratswahlen schreiben Sie bitte • Patrick Gsteiger und Marc Jost auf den Wahlzettel. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Die EVP Oberaargau setzt sich ein: EVP – mittendrin für starke Familien: Die Familie ist die Kernzelle unserer Gesellschaft und deshalb gebührt ihr besonderer Schutz und Förderung. Warum soll ich OA1/2 für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen im Oberaargau sind uns ein besonderes Anliegen. Wir treten für eine Wirtschaft ein, die die EVP Oberaargau wählen? verantwortungsvoll mit Menschen und Ressourcen umgeht. Die EVP Oberaargau ist eine seit 42 Jahren im Oberaargau etablierte Partei. Wir sind keine für eine intakte Umwelt: Wir setzen uns für Lebensqualität Eintagsfliege und unbekannte Neugründung, sondern können auf einen breiten Leistungsnachweis ein. Die Förderung CO2-neutraler Energien und eine effiziente zurückblicken! Energienutzung bilden dazu die Basis. Als Partei der Mitte sind wir im Oberaargau mehrheitsbildend: 2 Grossräte, 7 Exekutivmitglieder, für gesunde Staatsfinanzen: Die Belastung durch Gebühren 7 Sektionen -

Quaternary Glaciation History of Northern Switzerland
Quaternary Science Journal GEOzOn SCiEnCE MEDiA Volume 60 / number 2–3 / 2011 / 282–305 / DOi 10.3285/eg.60.2-3.06 iSSn 0424-7116 E&G www.quaternary-science.net Quaternary glaciation history of northern switzerland Frank Preusser, Hans Rudolf Graf, Oskar keller, Edgar krayss, Christian Schlüchter Abstract: A revised glaciation history of the northern foreland of the Swiss Alps is presented by summarising field evidence and chronologi- cal data for different key sites and regions. The oldest Quaternary sediments of Switzerland are multiphase gravels intercalated by till and overbank deposits (‘Deckenschotter’). Important differences in the base level within the gravel deposits allows the distin- guishing of two complex units (‘Höhere Deckenschotter’, ‘Tiefere Deckenschotter’), separated by a period of substantial incision. Mammal remains place the older unit (‘Höhere Deckenschotter’) into zone MN 17 (2.6–1.8 Ma). Each of the complexes contains evidence for at least two, but probably up-to four, individual glaciations. In summary, up-to eight Early Pleistocene glaciations of the Swiss alpine foreland are proposed. The Early Pleistocene ‘Deckenschotter’ are separated from Middle Pleistocene deposition by a time of important erosion, likely related to tectonic movements and/or re-direction of the Alpine Rhine (Middle Pleistocene Reorganisation – MPR). The Middle-Late Pleistocene comprises four or five glaciations, named Möhlin, Habsburg, Hagenholz (uncertain, inadequately documented), Beringen, and Birrfeld after their key regions. The Möhlin Glaciation represents the most extensive glaciation of the Swiss alpine foreland while the Beringen Glaciation had a slightly lesser extent. The last glacial cycle (Birrfeld Glaciation) probably comprises three independent glacial advances dated to ca. -

Einführung Der Regionalkonferenz Oberaargau
11. März 2012 Regionale Volksabstimmung Botschaft des Regierungsrates des Kantons Bern an die Stimmberechtigten im Verwaltungskreis Oberaargau Einführung der Regionalkonferenz Oberaargau Botschaft_Regional_OA_110312_rz.indd 1 30.12.2011 10:37:29 Uhr Die Gemeinderäte von 37 der 47 Ge meinden im Verwaltungskreis Ober Darüber wird abgestimmt aargau haben dem Regierungsrat den Antrag für die Anordnung einer Für das Leben der Menschen wird die regionalen Volksabstimmung über Region immer wichtiger. Arbeit und Frei- die Einführung der Regionalkonfe zeit finden zunehmend ausserhalb der renz Oberaargau gestellt. Die Ge Wohngemeinde statt. Wirtschaft und meinderäte von sieben Gemeinden Gesellschaft werden mobiler. Deshalb lehnen dies ab. Drei haben sich nicht braucht es neue Strukturen, um die regio- geäussert. nale Zusammenarbeit der Gemeinden zu verstärken. Mit der Regionalkonferenz Der Regierungsrat des Kantons Bern Oberaargau können die Gemeinden effi- befürwortet die Einführung der Re zienter, rascher und verbindlicher über gio nalkonferenz Oberaargau. wichtige regionale Fragen wie Raum- planung, Verkehr, Kulturförderung und Regionalpolitik entscheiden. Die demo- kratische Mitwirkung ist gewährleistet. Die Stimmkraft der Gemeinden ist nach der Einwohnerzahl gewichtet. Die Bevöl- kerung entscheidet mit. Für die Einfüh- rung der Regionalkonferenz Oberaargau braucht es die Zustimmung der Mehrheit der Gemeinden und der Mehrheit der Stimmenden in der Region Oberaargau. Informationen und Dokumente zur regionalen Volksabstimmung vom 11. März 2012 finden Sie unter: www.be.ch / abstimmungen www.oberaargau.ch 2 Botschaft_Regional_OA_110312_rz.indd 2 30.12.2011 10:37:29 Uhr Einführung der Regionalkonferenz Oberaargau Die Regionalkonferenz stärkt die Mit- wirkungsrechte der Gemeinden und der Das Wichtigste in Kürze Bevölkerung auf regionaler Ebene. Die Stimmkraft der Gemeinden in der Regio- Die Gemeinden in der Region Oberaargau nalversammlung ist entsprechend der arbeiten seit langem in verschiedenen Gemeindegrösse gewichtet.