Vortrag Meike Hopp Als
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Resource Guide to Literature, Poetry, Art, Music & Videos by Holocaust
Bearing Witness BEARING WITNESS A Resource Guide to Literature, Poetry, Art, Music, and Videos by Holocaust Victims and Survivors PHILIP ROSEN and NINA APFELBAUM Greenwood Press Westport, Connecticut ● London Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rosen, Philip. Bearing witness : a resource guide to literature, poetry, art, music, and videos by Holocaust victims and survivors / Philip Rosen and Nina Apfelbaum. p. cm. Includes bibliographical references (p.) and index. ISBN 0–313–31076–9 (alk. paper) 1. Holocaust, Jewish (1939–1945)—Personal narratives—Bio-bibliography. 2. Holocaust, Jewish (1939–1945), in literature—Bio-bibliography. 3. Holocaust, Jewish (1939–1945), in art—Catalogs. 4. Holocaust, Jewish (1939–1945)—Songs and music—Bibliography—Catalogs. 5. Holocaust,Jewish (1939–1945)—Video catalogs. I. Apfelbaum, Nina. II. Title. Z6374.H6 R67 2002 [D804.3] 016.94053’18—dc21 00–069153 British Library Cataloguing in Publication Data is available. Copyright ᭧ 2002 by Philip Rosen and Nina Apfelbaum All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, by any process or technique, without the express written consent of the publisher. Library of Congress Catalog Card Number: 00–069153 ISBN: 0–313–31076–9 First published in 2002 Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, CT 06881 An imprint of Greenwood Publishing Group, Inc. www.greenwood.com Printed in the United States of America TM The paper used in this book complies with the Permanent Paper Standard issued by the National Information Standards Organization (Z39.48–1984). 10987654321 Contents Preface vii Historical Background of the Holocaust xi 1 Memoirs, Diaries, and Fiction of the Holocaust 1 2 Poetry of the Holocaust 105 3 Art of the Holocaust 121 4 Music of the Holocaust 165 5 Videos of the Holocaust Experience 183 Index 197 Preface The writers, artists, and musicians whose works are profiled in this re- source guide were selected on the basis of a number of criteria. -

Introduction the Surreal Without Surrealism
INTRODUCTION The Surreal without Surrealism The time will come, if it is not already come, when the surrealist enterprise:': will be studied and evaluated, in the history of literature, as an adventure of hope. —Wallace Fowlie, Age of Surrealism Indubitably, Surrealism and the GDR are closely connected, and are more closely related to each other than one might think. When, for example, one listens to the recollections and reads the memoirs of those who lived in this country, apparently no other conclusion can be drawn. Life in the East German Communist state had a surrealistic disposition, was associated with the grotesque, absurd and irrational. Admittedly, Surrealism did not exist in the GDR. Not only are the insights of Hans Magnus Enzensberger and Peter Bürger on the death of the historical avant-garde convincing and applicable to the GDR;1 it is also significant that no German artist or writer who considered him- or herself a Surrealist prior to 1945 returned from exile to settle in the SBZ or the GDR. Most of the celebrities of German Surrealism during the Weimar Republic were forced to go into exile or did not return to Germany at all. Max Ernst, for example, remained living in the USA, and then in 1953 moved to his wife’s old quarters in Paris; Hans Arp decided to live in Switzerland, and in 1949 chose the USA as his home country. Others who had lived through and survived Hitler’s Germany had to face the harsh demands of National Socialist cultural politics that downgraded the avant-garde to the status of Entartete Kunst, or degenerate art, and sidelined and even terrorized its representatives. -

Heinrich Zille's Berlin Selected Themes from 1900
"/v9 6a~ts1 HEINRICH ZILLE'S BERLIN SELECTED THEMES FROM 1900 TO 1914: THE TRIUMPH OF 'ART FROM THE GUTTER' THESIS Presented to the Graduate Council of the North Texas State University in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS By Catherine Simke Nordstrom Denton, Texas May, 1985 Copyright by Catherine Simke Nordstrom 1985 Nordstrom, Catherine Simke, Heinrich Zille's Berlin Selected Themes from 1900 to 1914: The Trium of 'Art from the Gutter.' Master of Arts (Art History), May, 1985, 139 pp., 71 illustrations, bibliography, 64 titles. Heinrich Zille (1858-1929), an artist whose creative vision was concentrated on Berlin's working class, portrayed urban life with devastating accuracy and earthy humor. His direct and often crude rendering linked his drawings and prints with other artists who avoided sentimentality and idealization in their works. In fact, Zille first exhibited with the Berlin Secession in 1901, only months after Kaiser Wilhelm II denounced such art as Rinnsteinkunst, or 'art from the gutter.' Zille chose such themes as the resultant effects of over-crowded, unhealthy living conditions, the dissolution of the family, loss of personal dignity and economic exploi tation endured by the working class. But Zille also showed their entertainments, their diversions, their excesses. In so doing, Zille laid bare the grim and the droll realities of urban life, perceived with a steady, unflinching gaze. TABLE OF CONTENTS Page LIST OF ILLUSTRATIONS . S S S . vi CHRONOLOGY . xi Chapter I. INTRODUCTION . 5 . 1 II. AN OVERVIEW: BERLIN, ART AND ZILLE . 8 III. "ART FROM THE GUTTER:" ZILLE'S THEMATIC CHOICES . -

Downloaded for Personal Non-Commercial Research Or Study, Without Prior Permission Or Charge
Hobbs, Mark (2010) Visual representations of working-class Berlin, 1924–1930. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/2182/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Glasgow Theses Service http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] Visual representations of working-class Berlin, 1924–1930 Mark Hobbs BA (Hons), MA Submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of PhD Department of History of Art Faculty of Arts University of Glasgow February 2010 Abstract This thesis examines the urban topography of Berlin’s working-class districts, as seen in the art, architecture and other images produced in the city between 1924 and 1930. During the 1920s, Berlin flourished as centre of modern culture. Yet this flourishing did not exist exclusively amongst the intellectual elites that occupied the city centre and affluent western suburbs. It also extended into the proletarian districts to the north and east of the city. Within these areas existed a complex urban landscape that was rich with cultural tradition and artistic expression. This thesis seeks to redress the bias towards the centre of Berlin and its recognised cultural currents, by exploring the art and architecture found in the city’s working-class districts. -

Hans Grundig's Masterful
Martin Schmidt An Iconic Work of New Objectivity: Hans Grundig’s Masterful “Schüler mit roter Mütze” The artistic ethos of the painter Hans Grundig is reflected in his attempt to conjoin the sometimes one-dimensional worldview of politically informed art with a more universal human outlook. This is to say that in addition to his overriding preoccupation with the social conditions that prevailed during his turbulent times – particularly class conflicts –, he was nonetheless able to paint with a deeply felt lyricism. Without this aspect, his art would probably have come across as passionless and merely declamatory. And so we always find the human being as the key point of reference for his care and concern, not just ab- stract principles. A highly idiosyncratic way of looking at things shines through Grundig’s work, one that mixes naiveté with artifice, pro- clamation with lyricism, and that supercharges non-descript details with a deeply felt, magical poetry. Lea, the school friend who later became his wife and life’s companion, and whom he fondly referred to as his “silver one” in his memoirs, described him as “a dreamer and warrior rolled into one.” He wanted his art Karl Hubbuch. The schoolroom. 1925. Oil/cardboard and wood. Private Col- to have a social impact, of course. Yet he was also well aware that lection choosing the right side in class warfare, as demanded by the Ger- man Communist Party (KPD) and later by its East German succes- seems designed for titanic hands, assuming spatial logic is applied. Grundig evi- sor (SED), was an artistic dead end that usually produced less than dently is unconcerned about the plausibility of his center-line perspective. -

Hitler, Goebbels and the Frogs on the Nile a 1931 Political Photomontage
Schneider: Hitler, Goebbels and the Frogs on the Nile Hitler, Goebbels and the Frogs on the Nile A 1931 Political Photomontage Thomas Schneider University of British Columbia∗ 1. Ancient Egypt in Political Caricature Since the Napoleonic expedition,1 ancient Egyptian sceneries and artifacts have played an important role in political caricatures relating to events of Egypt’s own modern history.2 One example discussed recently by Donald Reid is “The Wafd’s last cabinet in pharaonic guise” from 1950, by Iskandar Saroukhan, which taunts the government’s purported dedication to pharaonism (fig. 1).3 The caricaturist seems to have used ancient Egyptian templates for some of the depicted personae: E.g., as Reid noticed, the blind minister of education, Taha Hussein, is depicted as the Louvre scribe (with dark glasses). One may also compare Prime Minister Mostafa al-Nahhas who sits as Egyptian king on the throne to the left: with an individual depicted to his right (in a woman’s dress but representing a male cabinet minister), the blue crown on his head, the heqa sceptre in his left hand, and mace, flail and ankh in his right hand, this is precisely modelled on the depiction of Amenhotep III and his mother Mutemwia in Theban Tomb 226 (fig. 2), to give just one additional example.4 ∗ Initial research for this article was conducted as part of the project “Egyptology in the Nazi Era: National Socialism and the Profile of a Humanistic Discipline, 1933-45”, funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (2012-6). 1 A first example is satirist James Gillray in his 1799 “Egyptian Sketches”, see Draper Hill, ed., The Satirical Etchings of James Gillray (New York: Dover Publications, 1976). -
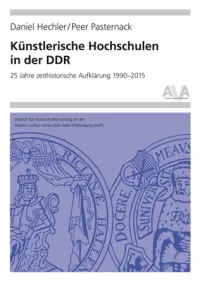
Künstlerische Hochschulen in Der DDR
Daniel Hechler | Peer Pasternack Künstlerische Hochschulen in der DDR. 25 Jahre zeithistorische Aufklärung 1990–2015 Hochschulforschung Halle‐Wittenberg Herausgegeben für das Institut für Hochschulforschung (HoF) von Peer Pasternack Daniel Hechler | Peer Pasternack Künstlerische Hochschulen in der DDR 25 Jahre zeithistorische Aufklärung 1990–2015: Eine Auswertung mit bibliografischer Dokumentation AVA – Akademische Verlagsanstalt Leipzig 2015 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio- nalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.d- nb.de abrufbar. Reihe „Hochschulforschung Halle-Wittenberg“ AVA – Akademische Verlagsanstalt Leipzig 2015 © Institut für Hochschulforschung an der Universität Halle-Wittenberg (HoF) Collegienstraße 62, 06886 Lutherstadt Wittenberg, [email protected], http://www.hof.uni-halle.de Druck: Osiris-Druck Leipzig ISBN 978-3-931982-99-7 Inhalt Teil A. 25 Jahre Aufarbeitung, Erforschung und Dokumentation der DDR‐Geschichte künstlerischer Hochschulen ..................................... 7 1. Die künstlerische Ausbildungslandschaft in der DDR und danach ................................................................................ 9 1.1. Hochschulen ............................................................................... 9 1.2. Fachschulen .............................................................................. 15 2. Erinnerungspolitik und Zeitgeschichtsforschung -

Hochschule & Wissenschaft in SBZ / DDR / Ostdeutschland 1945
Peer Pasternack Hochschule & Wissenschaft in SBZ / DDR / Ostdeutschland 1945 - 1995 Annotierte Bibliographie für den Erscheinungszeitraum 1990 - 1998 SBZ/DDR-Wissenschafts-/Hochschulgeschichte allgemein 5 Inhalt Vorbemerkungen........................................................................................................................ 7 A. Fächerübergreifende Themen / Ostdeutsche Hochschul- und Wissenschaftsentwicklung allgemein .......................................................................... 9 1. SBZ/DDR-Wissenschafts- und -Hochschulgeschichte allgemein .................................... 11 2. Statistik.............................................................................................................................. 47 3. Ostdeutscher Hochschul- und Wissenschaftsumbau 1989ff............................................. 53 3.1. Inhaltliche, personalbezogene und strukturelle Entwicklungen....................................... 53 3.2. Rechtliche Aspekte.......................................................................................................... 104 3.3. Administrative und technische Aspekte.......................................................................... 108 4. Spezielle Aspekte der ostdeutschen Hochschul- und Wissenschaftsentwicklung.......... 139 4.1. Gleichstellungspolitik / Frauenförderung ....................................................................... 139 4.2. Die Studierenden............................................................................................................ -

The Library of Professor Leo Steinberg
The Library of Professor Leo Steinberg 4164 titles in ca. 4600 physical volumes INTRODUCTORY MATERIAL DICTIONARY OF ART HISTORIANS A Biographical Dictionary of Historic Scholars, Museum Professionals and Academic Historians of Art Steinberg, Leo, né Zalman Lev Date born: July 9, 1920 Place Born: Moscow, Russia Date died: March 13, 2011 Place died: New York, NY Michelangelo- and modernist art historian; Benjamin Franklin professor of art at University of Pennsylvania, 1975- 1991. Steinberg was born in Moscow of German-Jewish parents (his mother was Anyuta Esselson [Steinberg], 1890- 1954) and his father, Isaac Nachman Steinberg (1888-1957), government figure and lawyer in revolutionary Russia. Lenin appointed Steinberg's father commissar of justice. His idealism, (he wanted to abolish the prison system, for example) forced the family into exile in Berlin, where the younger Steinberg grew up. After the rise of the Nazis in Germany, the family moved to London where Steinberg studied (studio) painting and sculpture at the Slade School in London from 1936 to 1940. After World War II he immigrated to New York working initially as a freelance writer and translator (including a holocaust account, Ashes and Fire, 1947). He also taught drawing at the Parsons School of Design. He studied art history at the Institute of Fine Arts, New York University, under Richard Krautheimer and Wolfgang Lotz, receiving his Ph.D., in 1960. His dissertation, written under Lotz, was on Borromini's San Carlo alle Quattro Fontane. In 1962 he an art editor for Life magazine married Dorothy Seiberling (later divorced). Between 1962-1975 Steinberg taught art history and life drawing at Hunter College, the City University of New York. -

The Ethics of Seeing
The Ethics of Seeing Twentieth-Century German Documentary Photography Reconsidered Studies in German History Published in Association with the German Historical Institute, Washington, D.C. General Editor: Simone Lässig, Director of the German Historical Institute, Washington D.C., with the assis- tance of Patricia Sutcliffe, Editor, German Historical Institute Volume 1 Volume 12 Nature in German History Raising Citizens in the ‘Century of the Child’: Edited by Christof Mauch The United States and German Central Europe in Comparative Perspective Volume 2 Edited by Dirk Schumann Coping with the Nazi Past: West German Debates on Nazism and Generational Conflict, 1955–1975 Volume 13 Edited by Philipp Gassert and Alan E. Steinweis The Plans that Failed: An Economic History of the GDR Volume 3 André Steiner Adolf Cluss, Architect: From Germany to America Edited by Alan Lessoff and Christof Mauch Volume 14 Max Liebermann and International Modernism: An Volume 4 Artist’s Career from Empire to Third Reich Two Lives in Uncertain Times: Facing the Challenges Edited by Marion Deshmukh, Françoise Forster- of the 20th Century as Scholars and Citizens Hahn and Barbara Gaehtgens Wilma Iggers and Georg Iggers Volume 15 Volume 5 Germany and the Black Diaspora: Points of Contact, Driving Germany: The Landscape of the German 1250–1914 Autobahn, 1930–1970 Edited by Mischa Honeck, Martin Klimke, and Thomas Zeller Anne Kuhlmann Volume 6 Volume 16 The Pleasure of a Surplus Income: Part-Time Crime and Criminal Justice in Modern Germany Work, Gender Politics, -

Gesamtverzeichnis 2019/2020
www. verlagsgruppe.de Verlagsgruppe Husum Mehr als 2500 Bücher im Gesamtverzeichnis 2019/2020 Verlagsgruppe Husum Ihrre Buchhandlung Nordbahnhofstraße 2 · D-25813 Husum Postfach 1480 · D-25804 Husum TTelefonelefon (0 48 41) 83 52-0 Husum Verlagsgruppe · Gesamtverzeichnis 2019/20 TTelefaxelefax (0 48 41) 83 52-10 eMail: [email protected] www.verlagsgruppe.de Husum Druck- und Verlagsgesellschaft · Hamburger Lesehefte Verlag Umschlagbild: Lesende (Verlagsarchiv) Hansa Verlag · Matthiesen Verlag · Verlag der Nation Umschlagbild: Günter Pump Turmschreiber Verlag · Verlag der Kunst Dresden Frank Wagner Verlagsbuchhandlung · Weihnachtshaus Inhaltsübersicht Weihnachtshaus .............................................. 94 Weihnachtshaus Husum – Sehen, Staunen, Erinnern ... Baden-Württemberg ............................................................. 3 ................................................ 104 Baltikum ............................................................................... 4 ... im Museum und im historischen Laden Bayern ................................................................................... 4 .............................................. 105 Berlin .................................................................................... 10 In unmittelbarer Nachbarschaft des Verlags- Brandenburg ......................................................................... 10 .............................................................. 107 hauses befindet sich das Weihnachtshaus, das Bremen ................................................................................ -

1 Hans Grundig Und Die Dresdner Kunstszene Der Nachkriegszeit Für
1 Hans Grundig und die Dresdner Kunstszene der Nachkriegszeit Für die Zeitschrift Militärgeschichte1 schrieb der DDR-Armeegeneral Heinz Hoffmann über seine Begegnung mit Hans Grundig an der Parteischule in Schodnja bei Moskau im Frühjahr 1945. Hoffmann berichtet, Grundig hätte sich in seinen Aufzeichnungen einen Satz besonders markiert, nämlich „Revolution müssen wir mit den Menschen machen, die wir haben“. Er berichtet weiter über Grundigs Bitterkeit angesichts der im Kriegsgefangenenlager unbehelligt herumspazierenden hohen Offiziere der Wehrmacht und zitiert ihn dazu: „es fällt schwer, sich vorzustellen, dass unter diesen Gestalten auch nur einer sein könnte, der mit seiner Vergangenheit gebrochen und gelernt hat, der bereit ist, mit uns zu gehen“. Wenn man sich mit Hans Grundigs Aktivitäten in Dresden ab 1946 beschäftigt, so fällt diese skeptische Haltung immer wieder auf. In seinem Erinnerungsbuch „Zwischen Karneval und Aschermittwoch“ reduzierte Grundig die Zeit nach 1945 auf fünf der 456 Druckseiten, auf das Wiedersehen mit der Mutter, die Wiedererlangung seiner Bilder und das Wiedersehen mit seiner Frau. Zur Frage, mit wem er in Dresden in Verbindung stand, muss man sich also auf Archivalien, Briefe und die Aussagen anderer stützen. Als Freund nennt er in seinen Briefen nach Palästina den Maler Alexander Neroslow. Dieser gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Asso (Assoziation Revolutionärer Bildender Künstler Deutschlands) in Dresden und war nach 1933 in der Widerstandsgruppe um Karl Stein tätig, der auch der Maler Fritz Schulze und seine Frau Eva Schulze Knabe angehört hatten. 1942 war auch er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus Waldheim blieb er als Dolmetscher und freischaffender Künstler am Ort und zog 1951 nach Leipzig, wo er ein Lehramt an der HGB übernahm.