3806236933 Lp.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ending Jim Crow Life Insurance Rates Mary L
University of Richmond UR Scholarship Repository Law Faculty Publications School of Law 2009 Ending Jim Crow Life Insurance Rates Mary L. Heen University of Richmond, [email protected] Follow this and additional works at: http://scholarship.richmond.edu/law-faculty-publications Part of the Civil Law Commons, Civil Rights and Discrimination Commons, and the Insurance Law Commons Recommended Citation Mary L. Heen, Ending Jim Crow Life Insurance Rates, 4 Nw. J. L. & Soc. Pol'y. 360 (2009). This Article is brought to you for free and open access by the School of Law at UR Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Law Faculty Publications by an authorized administrator of UR Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. Copyright 2009 by Mary Heen Volume 4 (Fall 2009) Northwestern Journal of Law and Social Policy Ending Jim Crow Life Insurance Rates Mary L. Heen* How people count and measure embodies certain assumptions about the thing they are counting; this was true in the nineteenth century, and it is equally true today.' [E]ver since the 1880's, Negroes have been subject to differential treatment by white insurance companies in that some of them, at that time, started to apply higher premium schedules for Negro than for white customers, whereas others decided not to take on any Negro business at all. The underlying reason, of course, is the fact that mortality rates are 2 much higher for Negroes than for whites. [I]f the misery of our poor be caused not by the laws of nature, but by our institutions, great is our sin..3 I. -

Biology a Level
World class thinking. World class achieving. St Mary’s College BIOLOGY (EDEXCEL BIOLOGY A) Pre-course reading and guidance A LEVEL Biology WHY SHOULD I CHOOSE BIOLOGY? › Biology is a wonderful science that gives you the opportunity to go into many areas, with dentistry, veterinary science, medicine to name a few. The course is taught by members of staff that have a great deal of expertise in delivering the subject. The study of life itself, A level Biology explores the theories and principles involved in living systems, in all their intricate beauty. Topics you will learn about include: lifestyle, transport, genes and health, development, plants and the environment, the natural environment and species survival, energy, exercise and co-ordination, as well as practical biology and research skills. By the end of the course you will know about the principles of genetics, molecules, taxonomy, natural selection, evolutionary theory, global warming, bacteria and viruses, and more. WHAT IS THE COURSE STRUCTURE LIKE? › The course is a two year course. It consists of three exams. The exams are worth a total of 33% each. All exams will be taken at the end of your second year. There is no coursework. World class thinking. World class achieving. A LEVEL Biology Exams (sat in Y13) Weighting Paper Topics Time (hours) (%) Topic 1: Lifestyle, Health and Risk Topic 2: Genes and Health Topic 3: Voice of the Genome 1 33.3 2 Topic 4: Biodiversity and Natural Resources Topic 5: On the Wild Side Topic 6: Immunity, Infection and Forensics Topic 1: Lifestyle, Health and Risk Topic 2: Genes and Health Topic 3: Voice of the Genome 2 33.3 2 Topic 4: Biodiversity and Natural Resources Topic 7: Run for your Life Topic 8: Grey Matter Topic 1: Lifestyle, Health and Risk Topic 2: Genes and Health Topic 3: Voice of the Genome Topic 4: Biodiversity and Natural Resources 3 Topic 5: On the Wild Side 33.3 2 Topic 6: Immunity, Infection and Forensics Topic 7: Run for your Life Topic 8: Grey Matter Exam Syllabus for Biology: https://bit.ly/2xJ6bTw World class thinking. -

EMBO Awardees Reveal Blueprints for Success
NATURE|Vol 443|19 October 2006 THE CAREERS MAGAZINE FOR SCIENTISTS eeing fellow researchers receive awards for their endeavours offers an ideal time to study success and learn valuable lessons about how to guide your scientific career. The two medals given out in the past month by the SEuropean Molecular Biology Organization (EMBO), based in Heidelberg, Germany, are no exception. The organization’s 2006 Award for Communication in the Life Sciences went to developmental geneticist Armand Marie Leroi of Imperial College London. Leroi’s success had its roots in his desire to spice up his lectures. When he discussed the connection between mutated fruitfly genes and disabilities in humans, his students “sat up and took notice — especially after snoozing through the 50th fly gene”, Leroi says. Inspired, Leroi sought out other connections between genetic mutations and human development, and brought them together in a book called Mutants: On the Form, Varieties and Errors of the Human Body. A television producer saw a copy of the book’s manuscript and approached Leroi to make a programme, which was broadcast under the title Human Mutants. Although Leroi says he finds public communication of science “seductive”, he tries to stay “grounded” in his research on the nematode worm Caenorhabditis elegans. “Ultimately communicating science isn’t more satisfying than doing science,” he says. Frank Uhlmann, winner of the 2006 EMBO Gold Medal, attributes much of his success to working in a number of different locations. Now based at Cancer Research UK in London, Uhlmann moved round six labs in Munich while doing his diploma in Germany. -

Zoological Endeavors Inspired by A. Richard Palmer: Introduction, Biography, and Bibliography
Canadian Journal of Zoology Zoological Endeavors Inspired by A. Richard Palmer: Introduction, Biography, and Bibliography Journal: Canadian Journal of Zoology Manuscript ID cjz-2020-0274 Manuscript Type: Editorial Date Submitted by the 17-Nov-2020 Author: Complete List of Authors: Miyashita, Tetsuto; Canadian Museum of Nature Jamniczky, Heather; University of Calgary, Cell Biology & Anatomy Standen, Emily; University of Ottawa, Department of Biology Is your manuscript invited for Draft consideration in a Special Zoological Endeavors Inspired by A. Richard Palmer Issue?: evolutionary biology, bilateral asymmetry, phenotypic plasticity, marine Keyword: ecology, career in biology, Pacific Northwest © The Author(s) or their Institution(s) Page 1 of 54 Canadian Journal of Zoology 1 Zoological Endeavors Inspired by A. Richard Palmer: Introduction, Biography, and 2 Bibliography1 3 4 Tetsuto Miyashita2, Heather A. Jamniczky3, and Emily M. Standen4 5 6 1This editorial introduces a series of invited papers arising from the symposium “Zoological 7 Endeavours Inspired by A. Richard Palmer” that was co-sponsored by the Canadian Society of 8 Zoologists and the Canadian Journal of Zoology and held during the Annual Meeting of the Canadian 9 Society of Zoologists at the University of Windsor, Windsor, Ontario, 14–16 May 2019. 10 11 2Canadian Museum of Nature, P.O. Box 3443,Draft Station D, Ottawa, ON K1P 6P4, Canada 12 3Department of Cell Biology and Anatomy, Cumming School of Medicine, the University of Calgary, 13 Calgary, AB T2X 4N1, Canada 14 4Department of Biology, the University of Ottawa, Ottawa, ON K1N 6N5, Canada 15 © The Author(s) or their Institution(s) Canadian Journal of Zoology Page 2 of 54 2 16 17 A professorial cowboy-aesthete – the combination seems incongruous yet he was utterly of a 18 piece – taught me how to think about evolution, which is to say about almost everything. -

Make Your Own Monster Adrian Woolfson
Make your own monster Adrian Woolfson MutAnts: On the Form, VArieties And Errors of the HumAn Body by ArmAnd MArie Leroi HarperCollins, 431 pp, £20.00, May 2004, ISBN 0 00 257113 7 JAcob’s LAdder: The History of the HumAn Genome by Henry Gee Fourth Estate, 272 pp, £20.00, March 2004, ISBN 1 84115 734 1 848 an advertisement in the Brooklyn tury, the mood of the public had changed Eagle triumphantly announced a per- and the public display of such ‘human Iformance by ‘the most extraordinary prodigies’ – as they preferred to be called – and interesting man in miniature in the had become unacceptable in many coun- known world’. Charles Sherwood Stratton tries. The profession of ‘museum freak’ was a perfectly formed 25-inch-tall midget, was in terminal decline. who weighed only 15 pounds. It had been Such discontinuous variations on the the idea of the Victorian freak show impre- human form are rare, but we are used to the sario Phineas Taylor Barnum to present continuous everyday variations that com- him in the guise of ‘General Tom Thumb’. prise the full spectrum of the ‘normal’. Before long, the general’s imitations – ‘in They leave the basic body plan intact, and full military costume’ – of Napoleon Bona- are the stuff of evolution by natural selec- parte and Frederick the Great, and a varied tion. The more ‘monstrous’ variations are repertoire including a ‘Scotch song’ and a unlikely to be of direct significance in evo- rendition of the polka, would make him a lutionary processes, but they do offer inval- wealthy man. -

Biology Work 2020
Longdean School GCSE to AS Transition Biology Work 2020 Bridging the gap between GCSE and A level Name: ___________________ In September 2020, you will be starting the OCR Biology A syllabus. 1) If possible, order the following book and work through it. ‘Head Start to A-Level Biology’ published by CGP. This book is a summary of the basics that we require at A-level. We build on this prior knowledge. If there is any area that you don’t quite know, please go through it in more detail. You can use online resources to help as well. Please do the questions at the end of each page and mark them using the answers in the back of the book. 2) You can also reinforce, as well as expand, your knowledge by visiting websites such as: • http://nobelprize.org – Details of the history of the best scientific discoveries • http://nature.com – The site of the scientific journal • http://royalsociety.org – Podcasts, news and interviews with scientists about recent scientific developments • http://www.nhm.ac.uk – The London Natural History Museum’s website with lots of interesting educational material • http://www.bmj.com – The website of the British Medical Journal • http://www.bbc.co.uk/news/science_and_environment - The BBC news page for Science and the Environment • There are a range of TED talks that may interest you http://www.ted.com/talks?sort=newest&topics%5B%5D=science 3) I would also encourage you to start reading more Biology related books such as: • Charles Darwin The origin of species • Matt Ridley Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters • Richard Dawkins The Selfish Gene; The Blind Watchmaker • Steve Jones Y: The Descent of Men; Almost Like a Whale; Coral • James Watson DNA: The Secret of Life; The Double Helix • Lewis Thomas The Lives of a Cell; The Medusa and the Snail • Barry Gibb The Rough Guide to the Brain • Armand Marie Leroi Mutants: On the Form, Varieties and Errors of the Human Body • David S. -
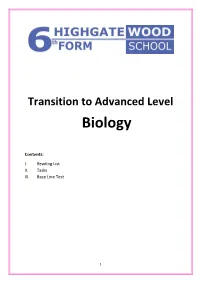
Biology Transition to a Level
Transition to Advanced Level Biology Contents: I. Reading List II. Tasks III. Base Line Test 1 Reading List The books below are all popular science books and great for extending your understanding of Biology. Richard Dawkins: The Selfish Gene The Blind Watchmaker. Unweaving the Rainbow Climbing Mount Improbable The Ancestor’s Tale Steve Jones: Y: The Descent of Men In the Blood: God, Genes and Destiny Almost Like a Whale: The 'Origin of Species' Updated The Language of the genes Matt Ridley: Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature The Language of Genes Francis Crick: Discoverer of the Genetic Code Nature Via Nurture: Genes, Experience and What Makes Us Human James Watson: DNA: The Secret of Life The Double Helix: Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA Lewis Thomas: The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher. The Medusa and the Snail: More Notes of a Biology Watcher Barry Gibb: The Rough Guide to the Brain (Rough Guides Reference Titles) Charles Darwin: The origin of species Armand Marie Leroi: Mutants: On the Form, Varieties and Errors of the Human Body David S. Goodsell: The Machinery of Life Ernst Mayr: This Is Biology: The Science of the Living World George C. Williams: Plan and Purpose in Nature Steve Pinker: The Language Instinct Edward O Wilson: The Diversity of Life Richard Leaky: The Origin of Humankind Bill Bryson: A Short History of Nearly Everything Oliver Sachs: The Man Who Mistook His Wife For A Hat Daniel Chamovitz: What A Plant Knows 2 Websites 1. -

The Lagoon How Aristotle Invented Science Armand Marie Leroi (Penguin Books 2014)
The Lagoon How Aristotle invented science Armand Marie Leroi (Penguin Books 2014) 7 There is a sense in which his philosophy is biology|in which he devised his ontology and epistemology just to explain how animals work. Ask Aristotle: what, fundamentally, exists? He would not say|as a modern biologist might |'go ask a physicist'; he'd point to a cut- tlefish and saythat. 18 IT's NOT THAT there wasn't any science|or at least natural philosophy|before Aristo- tle... The Greeks called them physiologoi, literally `those who give an account of nature'. Many were bold theoreticians. 20 It may seem that all Aristotle needed to do to become a scientist was to broker a marriage between the questing, querulous physiologoi and the dourly empirical medics. Which is what he did. That he managed it, however, is a tribute to the power of his mind. 22 By the time the teenaged Aristotle arrived at Athens to sit at Plato's feet, the tradition of natural philosophy, no more than two centuries old, was dead. Literally so: Democritus of Abdera, the last and greatest of the physiologoi, had diedjust a few years earlier. Disillusioned by the physiologoi's singular lack of interest in discussing why the universe was good, Socrates turned away from the study of the natural world. 26 Then, too, if Plato's science is barely distinguishable from theology so, to judge by the pronouncements of some physicists, is modern science: 'If we discover a complete theory, it would be the ultimate triumph of human reason|for then we should know the mind of God.' Plato? No, Hawking. -

Biology 3 Reading List
A Suggested Reading List for A Level Biologists Magazines, Newspapers and journals New Scientist Scientific American Nature Science Biological Sciences Review British Medical Journal Any scientific articles in newspapers (eg the Guardian on Wednesday) Websites http://www.ibiblio.org/virtualcell/index.htm – An interactive cell biology site http://www.dnai.org/a/index.html – Explore the genetic code http://nobelprize.org – Details of the history of the best scientific discoveries http://nature.com – The site of the scientific journal http://royalsociety.org – Podcasts, news and interviews with scientists about recent scientific developments http://www.nhm.ac.uk – The London Natural History Museum’s website with lots of interesting educational material http://www.bmj.com – The website of the British Medical Journal http://www.bbc.co.uk/news/science_and_environment - The BBC news page for Science and the Environment Books Research these on Amazon and select a few to read (you don’t have to read them all!): Richard Dawkins: The Selfish Gene The Blind Watchmaker. Unweaving the Rainbow Climbing Mount Improbable The Ancestor’s Tale Steve Jones: Y: The Descent of Men In the Blood: God, Genes and Destiny Almost Like a Whale: The 'Origin of Species' Updated The Language of the genes Matt Ridley Genome: The Autobiography of a Species in 23 Chapters The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature The Language of Genes Francis Crick: Discoverer of the Genetic Code Nature Via Nurture: Genes, Experience and What Makes Us Human James Watson: DNA: The Secret of Life The Double Helix: Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA Lewis Thomas: The Lives of a Cell: Notes of a Biology Watcher. -

Press Release
embopress release Heidelberg | 4 October 2006 EMBO honours triple talents of UK scientist, author, broadcaster UK scientist,author and broadcaster Incredibly Leroi’s achievements in science Armand Marie Leroi is the 2006 winner communication are more of a hobby than a of the EMBO Award for Communication in day job. His “real job” is research scientist the Life Sciences. The multi-talented devel- and lecturer at Imperial College London, opmental geneticist from Imperial College where he leads a group investigating London receives the award in recognition growth genetics and evolutionary develop- of his remarkable contribution to science mental biology in the worm communication. Author of an acclaimed C. elegans – one of the most important popular science book, Leroi has also writ- species in modern biology. The EMBO ten and presented scientific documentaries Award for Communication recognises for TV. scientists like Leroi for exactly this kind of Armand Marie Leroi dual commitment and their exceptional 2006 winner of the EMBO Why are most of us born with one nose, efforts to bring science to the public while Award for Communication in two legs, ten fingers and twenty-four ribs remaining active in research. the Life Sciences – and some of us not? This fundamental question forms the basis for much of The EMBO selection panel’s praise for Armand Leroi’s communication work. It is Armand Leroi: also the topic of his book Mutants, which tells the fascinating and often misunder- “Leroi masters the worlds of science writ- stood story of human development – and ing and broadcasting with the skill and how genetic mutations can provide the key versatility of a seasoned media profes- to who we are. -

Aristotle's Apron
Volume 9, Issue 1 (Winter 2017) Aristotle’s Apron Susan Koslow [email protected] Recommended Citation: Susan Koslow, “Aristotle’s Apron,” JHNA 9:1 (Winter 2017) DOI: 10.5092/jhna.2017.9.1.13 Available at https://jhna.org/articles/rembrandt-aristotle-bust-of-homer-apron/ Published by Historians of Netherlandish Art: https://hnanews.org/ Republication Guidelines: https://jhna.org/republication-guidelines/ Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. This PDF provides paragraph numbers as well as page numbers for citation purposes. ISSN: 1949-9833 JHNA 7:2 (Summer 2015) 1 ARISTOTLE’S APRON Susan Koslow This study concerns the apron in Rembrandt’s 1653 Aristotle with a Bust of Homer. Though the philosopher’s attire lacks historicity and resembles fictive theatrical costumes, one item situates it in “the present” and is recognizably realistic: the apron. It is argued here, for the first time, that the apron, a garment associated with artisanal occupations, is also indicative of experiential investigations carried out by the “new” natural philosophers who created and developed the scientific revolution in the early modern era. This movement also engaged artist and patron, Rembrandt and Ruffo. DOI: 10.5092/jhna.2017.9.1.13 Fig. 1 Rembrandt, Aristotle with a Bust of Homer, 1653, oil on canvas, 143.5 x 136.5 cm. New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 61.198 (artwork in the public domain) 1 Aristotle with a Bust of Homer (fig. 1) is -

Ending Jim Crow Life Insurance Rates Mary L
Northwestern Journal of Law & Social Policy Volume 4 | Issue 2 Article 3 Fall 2009 Ending Jim Crow Life Insurance Rates Mary L. Heen Recommended Citation Mary L. Heen, Ending Jim Crow Life Insurance Rates, 4 Nw. J. L. & Soc. Pol'y. 360 (2009). http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njlsp/vol4/iss2/3 This Article is brought to you for free and open access by Northwestern University School of Law Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Northwestern Journal of Law & Social Policy by an authorized administrator of Northwestern University School of Law Scholarly Commons. Copyright 2009 by Mary Heen Volume 4 (Fall 2009) Northwestern Journal of Law and Social Policy Ending Jim Crow Life Insurance Rates Mary L. Heen* How people count and measure embodies certain assumptions about the thing they are counting; this was true in the nineteenth century, and it is equally true today.1 [E]ver since the 1880’s, Negroes have been subject to differential treatment by white insurance companies in that some of them, at that time, started to apply higher premium schedules for Negro than for white customers, whereas others decided not to take on any Negro business at all. The underlying reason, of course, is the fact that mortality rates are much higher for Negroes than for whites.2 [I]f the misery of our poor be caused not by the laws of nature, but by our institutions, great is our sin.3 I. INTRODUCTION ¶1 Earlier this decade some of America’s best-known life insurance companies quietly settled multi-million dollar civil rights lawsuits involving race-based life insurance rates and benefits.4 As a result, those companies closed a chapter of American *Visiting Professor, Spring 2009, Washington and Lee University School of Law, and Professor of Law at the University of Richmond.