Ubuntu GNU/Linux
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
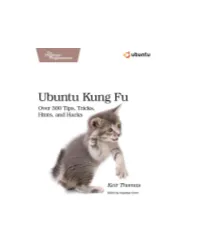
Ubuntu Kung Fu
Prepared exclusively for Alison Tyler Download at Boykma.Com What readers are saying about Ubuntu Kung Fu Ubuntu Kung Fu is excellent. The tips are fun and the hope of discov- ering hidden gems makes it a worthwhile task. John Southern Former editor of Linux Magazine I enjoyed Ubuntu Kung Fu and learned some new things. I would rec- ommend this book—nice tips and a lot of fun to be had. Carthik Sharma Creator of the Ubuntu Blog (http://ubuntu.wordpress.com) Wow! There are some great tips here! I have used Ubuntu since April 2005, starting with version 5.04. I found much in this book to inspire me and to teach me, and it answered lingering questions I didn’t know I had. The book is a good resource that I will gladly recommend to both newcomers and veteran users. Matthew Helmke Administrator, Ubuntu Forums Ubuntu Kung Fu is a fantastic compendium of useful, uncommon Ubuntu knowledge. Eric Hewitt Consultant, LiveLogic, LLC Prepared exclusively for Alison Tyler Download at Boykma.Com Ubuntu Kung Fu Tips, Tricks, Hints, and Hacks Keir Thomas The Pragmatic Bookshelf Raleigh, North Carolina Dallas, Texas Prepared exclusively for Alison Tyler Download at Boykma.Com Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their prod- ucts are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and The Pragmatic Programmers, LLC was aware of a trademark claim, the designations have been printed in initial capital letters or in all capitals. The Pragmatic Starter Kit, The Pragmatic Programmer, Pragmatic Programming, Pragmatic Bookshelf and the linking g device are trademarks of The Pragmatic Programmers, LLC. -

DVD Menus with Dvdstyler
Full Circle THE INDEPENDENT MAGAZINE FOR THE UBUNTU LINUX COMMUNITY ISSUE #74 - June 2013 ) ) m m o o c c . r r k k c c i i l l F F ( ( s s a a i i B B a a e e r r A A y y a a B B e e h h T T : : o o t t o o h h P P SSOOFFTTWWAARREE SSHHOOWWDDOOWWNN PDF VIEWERS: EVINCE vs OKULAR full circle magazine #74 1 Full Ciircle Magaziine iis neiither affiiliiated wiith,, nor endorsed by,, Canoniical Ltd.. contents ^ HowTo Full Circle Opinions THE INDEPENDENT MAGAZINE FOR THE UBUNTU LINUX COMMUNITY My Story p.31 Gpodder p.08 Columns LibreOffice p.11 Command & Conquer p.06 Ubuntu News p.04 My Story p.33 Connect To IPV6 p.14 Ask The New Guy p.26 Ubuntu Games p.47 Review p.34 Blender p.18 Linux Labs p.29 Q&A p.42 Software Showdown p.36 Inkscape p.21 Linux Certified p.48 Ubuntu Women p.45 Letters p.39 Graphics The articles contained in this magazine are released under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. This means you can adapt, copy, distribute and transmit the articles but only under the following conditions: you must attribute the work to the original author in some way (at least a name, email or URL) and to this magazine by name ('Full Circle Magazine') and the URL www.fullcirclemagazine.org (but not attribute the article(s) in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). -
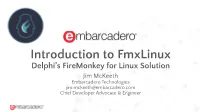
Introduction to Fmxlinux Delphi's Firemonkey For
Introduction to FmxLinux Delphi’s FireMonkey for Linux Solution Jim McKeeth Embarcadero Technologies [email protected] Chief Developer Advocate & Engineer For quality purposes, all lines except the presenter are muted IT’S OK TO ASK QUESTIONS! Use the Q&A Panel on the Right This webinar is being recorded for future playback. Recordings will be available on Embarcadero’s YouTube channel Your Presenter: Jim McKeeth Embarcadero Technologies [email protected] | @JimMcKeeth Chief Developer Advocate & Engineer Agenda • Overview • Installation • Supported platforms • PAServer • SDK & Packages • Usage • UI Elements • Samples • Database Access FireDAC • Migrating from Windows VCL • midaconverter.com • 3rd Party Support • Broadway Web Why FMX on Linux? • Education - Save money on Windows licenses • Kiosk or Point of Sale - Single purpose computers with locked down user interfaces • Security - Linux offers more security options • IoT & Industrial Automation - Add user interfaces for integrated systems • Federal Government - Many govt systems require Linux support • Choice - Now you can, so might as well! Delphi for Linux History • 1999 Kylix: aka Delphi for Linux, introduced • It was a port of the IDE to Linux • Linux x86 32-bit compiler • Used the Trolltech QT widget library • 2002 Kylix 3 was the last update to Kylix • 2017 Delphi 10.2 “Tokyo” introduced Delphi for x86 64-bit Linux • IDE runs on Windows, cross compiles to Linux via the PAServer • Designed for server side development - no desktop widget GUI library • 2017 Eugene -

Installing Airtime and Icecast Server on Ubuntu Server
Installing Airtime and Icecast server on Ubuntu Server Base system Install 32-bit Ubuntu Server 10.04 LTS (“Lucid”). Latest version is 10.04.3 Just do a minimum installation. You may want to add the openssh package for remote access, but other than that don't install any package sets during server installation. Update the system after installation, and install any editors or utilities you like to have available. Network setup Skip this section if using DHCP. Edit /etc/network/interfaces to provide static IP settings. For example: # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static ← change from iface eth0 inet dhcp address 10.224.1.208 netmask 255.255.255.0 gateway 10.224.1.1 Then restart the interface (or reboot): ifdown eth0 ifup eth0 Install Icecast Icecast is available in the Ubuntu repositories, so installation is just: apt-get install icecast2 When you install Airtime, the Icecast configuration files will be replaced, so you can skip the following unless you want to use Icecast without Airtime. Check the Icecast configuration file /etc/icecast2/icecast.xml and note or change the default passwords. To have the icecast server start at system boot, edit /etc/default/icecast2 and set ENABLE=true. Install Airtime Airtime is a Debian package and relies on the gdebi installer program, which is not part of the default Ubuntu server installation. So install this first: apt-get install gdebi Then download the Airtime installer package: wget http://apt.sourcefabric.org/mics/airtime-easy-setup.deb Use gdebi to install the installer package (which adds some repositories and helper scripts to your system) gdebi airtime-easy-setup.deb Now update the package list and install airtime: apt-get update apt-get install airtime Source clients Ices The ices2 client that handles ogg-vorbis streaming is in the Ubuntu repository. -
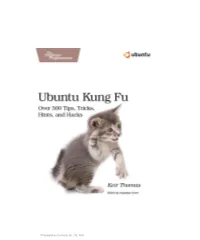
Ubuntu Kung Fu.Pdf
Prepared exclusively for J.S. Ash Beta Book Agile publishing for agile developers The book you’re reading is still under development. As part of our Beta book program, we’re releasing this copy well before we normally would. That way you’ll be able to get this content a couple of months before it’s available in finished form, and we’ll get feedback to make the book even better. The idea is that everyone wins! Be warned. The book has not had a full technical edit, so it will con- tain errors. It has not been copyedited, so it will be full of typos and other weirdness. And there’s been no effort spent doing layout, so you’ll find bad page breaks, over-long lines with little black rectan- gles, incorrect hyphenations, and all the other ugly things that you wouldn’t expect to see in a finished book. We can’t be held liable if you use this book to try to create a spiffy application and you somehow end up with a strangely shaped farm implement instead. Despite all this, we think you’ll enjoy it! Throughout this process you’ll be able to download updated PDFs from your account on http://pragprog.com. When the book is finally ready, you’ll get the final version (and subsequent updates) from the same address. In the meantime, we’d appreciate you sending us your feedback on this book at http://books.pragprog.com/titles/ktuk/errata, or by using the links at the bottom of each page. -

Orange Pi R1 User Manual
Orange Pi Manual Copy right by Shenzhen Xunlong Software Co., Ltd Orange Pi R1 User Manual V1.1 www.orangepi.org I www.xunlong.tv Orange Pi Manual Copy right by Shenzhen Xunlong Software Co., Ltd Contents I. Orange Pi R1 Introduction..................................................................................................................... 1 1. What is Orange Pi R1?..............................................................................................................1 2. What can I do with Orange Pi R1?........................................................................................... 1 3. Whom is it for?......................................................................................................................... 1 4. Hardware specification of Orange Pi R1.................................................................................. 1 5. GPIO Specifications..................................................................................................................3 II. Using Method Introduction...................................................................................................................5 1. Step 1: Prepare Accessories Needed.........................................................................................5 2. Step 2: Prepare a TF Card.........................................................................................................6 3. Step 3: Boot your Orange Pi.................................................................................................. -

The Official Ubuntu Book
Praise for Previous Editions of The Official Ubuntu Book “The Official Ubuntu Book is a great way to get you started with Ubuntu, giving you enough information to be productive without overloading you.” —John Stevenson, DZone book reviewer “OUB is one of the best books I’ve seen for beginners.” —Bill Blinn, TechByter Worldwide “This book is the perfect companion for users new to Linux and Ubuntu. It covers the basics in a concise and well-organized manner. General use is covered separately from troubleshooting and error-handling, making the book well-suited both for the beginner as well as the user that needs extended help.” —Thomas Petrucha, Austria Ubuntu User Group “I have recommended this book to several users who I instruct regularly on the use of Ubuntu. All of them have been satisfied with their purchase and have even been able to use it to help them in their journey along the way.” —Chris Crisafulli, Ubuntu LoCo Council, Florida Local Community Team “This text demystifies a very powerful Linux operating system . In just a few weeks of having it, I’ve used it as a quick reference a half-dozen times, which saved me the time I would have spent scouring the Ubuntu forums online.” —Darren Frey, Member, Houston Local User Group This page intentionally left blank The Official Ubuntu Book Seventh Edition This page intentionally left blank The Official Ubuntu Book Seventh Edition Matthew Helmke Amber Graner With Kyle Rankin, Benjamin Mako Hill, and Jono Bacon Upper Saddle River, NJ • Boston • Indianapolis • San Francisco New York • Toronto • Montreal • London • Munich • Paris • Madrid Capetown • Sydney • Tokyo • Singapore • Mexico City Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. -

The Cursor — Page 2 — June 18, 2011 Continued from Page 1 Bio: Stan Has Been Active with Personal Computers Behavior
TThhee CCuurrssoorr Monthly Newsletter of the Washington Area Computer User Group Meeting Location: Next Meeting: OLLI, 4210 Roberts Road June 18, 2011 Fairfax, VA Presidential Bits by Geof Goodrum President, Washington Area Computer User Group In May, Paul Howard and Bill Walsh demonstrated the Skype videoconferencing and PC screen sharing system with help from Mel Mikosinki, Roger Fujii and others. Paul showed how the free Skype software (http://www.skype.com/) on a PC allowed several people to make video phone calls and have a meeting over the Internet and local network with tiled live video feeds from each. Several tips, though: invest in a good quality headset (headphone/microphone) to make PC Problem? video or phone calls; mute your microphone when you walk away from Bring it to the PC Clinic! your computer or don’t need to talk. Likewise, don’t forget that you are June 18 on “candid camera,” so mind your appearance and anything behind that you that might not want visible. And if you are doing a Skype demo Table of Contents with two systems in the same room with a speaker system like we Lloyd’s Web Sites...............2 were, definitely use headphones or mute your mikes – our apologies to User’s View of the iMac.....3 those who experienced the thrill of audio feedback when Mel joined the Linux News........................ 3 Skype video call with Paul across the room! GNU/Linux Distributions...4 The Skype demo was particularly timely, given Microsoft’s May 10th Linux Software...................5 announcement that it entered a deal to acquire Skype for an estimated Word Tips.......................... -
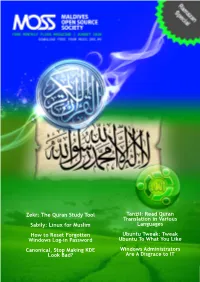
Zekr: the Quran Study Tool Sabily: Linux for Muslim How to Reset
Zekr: The Quran Study Tool Tanzil: Read Quran Translation in Various Sabily: Linux for Muslim Languages How to Reset Forgotten Ubuntu Tweak: Tweak Windows Log‐in Password Ubuntu To What You Like Canonical, Stop Making KDE Windows Administrators Look Bad? Are A Disgrace to IT ISSUE #8 Ramazan Mubarik Contents Let me start with a riddle, who are the beings that, in a sense, grant your wish instantly without asking for anything back in return? Appear when you need help, provide 04 Zekr : The Quran Study Tool free favors and magical tricks? Angels. Worldover there is significant interest in angels, pictures of angels, stories of angels, 09 Tanzil: Read Quran Translations In Various Languages and popular spirituality of angels which have put the images and imaginations of angels in our collective unconscious. In this Holy month of ramazan, we as Muslims, we 11 Sabily : Linux for Muslim have lot of room to believe in angels. Though the word angels literally means 16 messenger, today in the popular literature Ubuntu Tweak : Tweak Ubuntu To What You Like and movies angels have become more involved with tangible needs of this world. From glass slippers and ballroom dressess to 21 How to reset forgotten Windows log‐in password feeding the hungry, rickety places are preserved from disasters and even coded for you by angels. All in all angels represent help from an unknown and unseeable origin 24 Windows Administrators Are A Disgrace to IT to survive a difficult situation. Have you ever turned out into the unknown, expecting help from beyond your actual Canonical, Stop Making KDE Look Bad? means, wish‐projected? If you believe in 25 angels or if you have wish‐projected than it would not be hard to understand what Free Libre Open Source Software (FLOSS) is all about. -
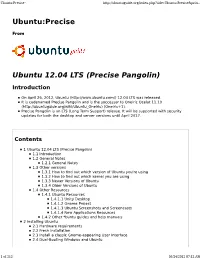
Ubuntu:Precise Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)
Ubuntu:Precise - http://ubuntuguide.org/index.php?title=Ubuntu:Precise&prin... Ubuntu:Precise From Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) Introduction On April 26, 2012, Ubuntu (http://www.ubuntu.com/) 12.04 LTS was released. It is codenamed Precise Pangolin and is the successor to Oneiric Ocelot 11.10 (http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Oneiric) (Oneiric+1). Precise Pangolin is an LTS (Long Term Support) release. It will be supported with security updates for both the desktop and server versions until April 2017. Contents 1 Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) 1.1 Introduction 1.2 General Notes 1.2.1 General Notes 1.3 Other versions 1.3.1 How to find out which version of Ubuntu you're using 1.3.2 How to find out which kernel you are using 1.3.3 Newer Versions of Ubuntu 1.3.4 Older Versions of Ubuntu 1.4 Other Resources 1.4.1 Ubuntu Resources 1.4.1.1 Unity Desktop 1.4.1.2 Gnome Project 1.4.1.3 Ubuntu Screenshots and Screencasts 1.4.1.4 New Applications Resources 1.4.2 Other *buntu guides and help manuals 2 Installing Ubuntu 2.1 Hardware requirements 2.2 Fresh Installation 2.3 Install a classic Gnome-appearing User Interface 2.4 Dual-Booting Windows and Ubuntu 1 of 212 05/24/2012 07:12 AM Ubuntu:Precise - http://ubuntuguide.org/index.php?title=Ubuntu:Precise&prin... 2.5 Installing multiple OS on a single computer 2.6 Use Startup Manager to change Grub settings 2.7 Dual-Booting Mac OS X and Ubuntu 2.7.1 Installing Mac OS X after Ubuntu 2.7.2 Installing Ubuntu after Mac OS X 2.7.3 Upgrading from older versions 2.7.4 Reinstalling applications after -

Digital Anthropology
Digital Anthropology Digital Anthropology Edited by Heather A. Horst and Daniel Miller London • New York English edition First published in 2012 by Berg Editorial offi ces: 50 Bedford Square, London WC1B 3DP, UK 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010, USA © Heather A. Horst & Daniel Miller 2012 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the written permission of Berg. Berg is an imprint of Bloomsbury Publishing Plc. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the Library of Congress. British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN 978 0 85785 291 5 (Cloth) 978 0 85785 290 8 (Paper) e-ISBN 978 0 85785 292 2 (institutional) 978 0 85785 293 9 (individual) www.bergpublishers.com Contents Notes on Contributors vii PART I. INTRODUCTION 1. The Digital and the Human: A Prospectus for Digital Anthropology 3 Daniel Miller and Heather A. Horst PART II. POSITIONING DIGITAL ANTHROPOLOGY 2. Rethinking Digital Anthropology 39 Tom Boellstorff 3. New Media Technologies in Everyday Life 61 Heather A. Horst 4. Geomedia: The Reassertion of Space within Digital Culture 80 Lane DeNicola PART III. SOCIALIZING DIGITAL ANTHROPOLOGY 5. Disability in the Digital Age 101 Faye Ginsburg 6. Approaches to Personal Communication 127 Stefana Broadbent 7. Social Networking Sites 146 Daniel Miller PART IV. POLITICIZING DIGITAL ANTHROPOLOGY 8. Digital Politics and Political Engagement 165 John Postill – v – vi • Contents 9. Free Software and the Politics of Sharing 185 Jelena Karanović 10. -

Installing Multimedia Codecs and Drivers Matthew Helmke
Installing Multimedia Codecs and Drivers Matthew Helmke buntu 8.10 comes standard with free them is of questionable legality for anyone and open software. This includes com- other than the company that has written Umunity developed drivers for hard- them. ware, where the source code for the software is available to be downloaded, viewed, and Hardware Drivers distributed legally. You can even modify it le- Some companies, like Intel, are choosing to re- gally, if you know how, as long as you either lease the specifications for their hardware or do not distribute your changes, or you license even writing and releasing drivers themselves your work in the same manner as the work as free or open source software, in both cases you are using. This software works with most inviting users to participate in the process of hardware, and also includes the ability to play writing or improving them. This is wonderful, and view some media types. and development of drivers for this hardware There are a couple of issues with doing tends to go quickly and the software tends things this way; you may not have access to all to be very good. Most of the time, you won’t of the features of some hardware while using notice anything except that the hardware just the free and open drivers, and some of the works, because the device drivers are included most commonly used sound and video files in the free and open source Linux kernel. require codecs, coder and decoder software Some hardware has special features which translates between binary data and that the production company does not wish sound or pictures, that are not free to be le- to make known, often because no one else gally distributed with the operating system.