YY Del Ist Vom Typ EB 3 F
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
![Arxiv:2006.10868V2 [Astro-Ph.SR] 9 Apr 2021 Spain and Institut D’Estudis Espacials De Catalunya (IEEC), C/Gran Capit`A2-4, E-08034 2 Serenelli, Weiss, Aerts Et Al](https://docslib.b-cdn.net/cover/3592/arxiv-2006-10868v2-astro-ph-sr-9-apr-2021-spain-and-institut-d-estudis-espacials-de-catalunya-ieec-c-gran-capit-a2-4-e-08034-2-serenelli-weiss-aerts-et-al-1213592.webp)
Arxiv:2006.10868V2 [Astro-Ph.SR] 9 Apr 2021 Spain and Institut D’Estudis Espacials De Catalunya (IEEC), C/Gran Capit`A2-4, E-08034 2 Serenelli, Weiss, Aerts Et Al
Noname manuscript No. (will be inserted by the editor) Weighing stars from birth to death: mass determination methods across the HRD Aldo Serenelli · Achim Weiss · Conny Aerts · George C. Angelou · David Baroch · Nate Bastian · Paul G. Beck · Maria Bergemann · Joachim M. Bestenlehner · Ian Czekala · Nancy Elias-Rosa · Ana Escorza · Vincent Van Eylen · Diane K. Feuillet · Davide Gandolfi · Mark Gieles · L´eoGirardi · Yveline Lebreton · Nicolas Lodieu · Marie Martig · Marcelo M. Miller Bertolami · Joey S.G. Mombarg · Juan Carlos Morales · Andr´esMoya · Benard Nsamba · KreˇsimirPavlovski · May G. Pedersen · Ignasi Ribas · Fabian R.N. Schneider · Victor Silva Aguirre · Keivan G. Stassun · Eline Tolstoy · Pier-Emmanuel Tremblay · Konstanze Zwintz Received: date / Accepted: date A. Serenelli Institute of Space Sciences (ICE, CSIC), Carrer de Can Magrans S/N, Bellaterra, E- 08193, Spain and Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Carrer Gran Capita 2, Barcelona, E-08034, Spain E-mail: [email protected] A. Weiss Max Planck Institute for Astrophysics, Karl Schwarzschild Str. 1, Garching bei M¨unchen, D-85741, Germany C. Aerts Institute of Astronomy, Department of Physics & Astronomy, KU Leuven, Celestijnenlaan 200 D, 3001 Leuven, Belgium and Department of Astrophysics, IMAPP, Radboud University Nijmegen, Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen, the Netherlands G.C. Angelou Max Planck Institute for Astrophysics, Karl Schwarzschild Str. 1, Garching bei M¨unchen, D-85741, Germany D. Baroch J. C. Morales I. Ribas Institute of· Space Sciences· (ICE, CSIC), Carrer de Can Magrans S/N, Bellaterra, E-08193, arXiv:2006.10868v2 [astro-ph.SR] 9 Apr 2021 Spain and Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), C/Gran Capit`a2-4, E-08034 2 Serenelli, Weiss, Aerts et al. -

Orbits and Pulsations of the Classical Aurigae Binaries
The Astrophysical Journal, 679:1490Y1498, 2008 June 1 A # 2008. The American Astronomical Society. All rights reserved. Printed in U.S.A. ORBITS AND PULSATIONS OF THE CLASSICAL AURIGAE BINARIES Joel A. Eaton,1 Gregory W. Henry,1 and Andrew P. Odell2 Received 2007 October 12; accepted 2008 January 23 ABSTRACT We have derived new orbits for Aur, 32 Cyg, and 31 Cyg with observations from the Tennessee State University (TSU) Automatic Spectroscopic Telescope, and used them to identify nonorbital velocities of the cool supergiant components of these systems. We measure periods in those deviations, identify unexpected long-period changes in the radial velocities, and place upper limits on the rotation of these stars. These radial-velocity variations are not obviously consistent with radial pulsation theory, given what we know about the masses and sizes of the components. Our concurrent photometry detected the nonradial pulsations driven by tides (ellipsoidal variation) in both Aur and 32 Cyg, at a level and phasing roughly consistent with simple theory to first order, although they seem to require moderately large gravity darkening. However, the K component of 32 Cyg must be considerably bigger than ex- pected, or have larger gravity darkening than Aur, to fit its amplitude. However, again there is precious little evi- dence for the normal radial pulsation of cool stars in our photometry. H shows some evidence for chromospheric heating by the B component in both Aur and 32 Cyg, and the three stars show among them a meager 2Y3 outbursts in their winds of the sort seen occasionally in cool supergiants. -
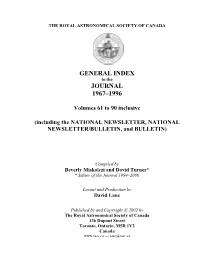
Index to JRASC Volumes 61-90 (PDF)
THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY OF CANADA GENERAL INDEX to the JOURNAL 1967–1996 Volumes 61 to 90 inclusive (including the NATIONAL NEWSLETTER, NATIONAL NEWSLETTER/BULLETIN, and BULLETIN) Compiled by Beverly Miskolczi and David Turner* * Editor of the Journal 1994–2000 Layout and Production by David Lane Published by and Copyright 2002 by The Royal Astronomical Society of Canada 136 Dupont Street Toronto, Ontario, M5R 1V2 Canada www.rasc.ca — [email protected] Table of Contents Preface ....................................................................................2 Volume Number Reference ...................................................3 Subject Index Reference ........................................................4 Subject Index ..........................................................................7 Author Index ..................................................................... 121 Abstracts of Papers Presented at Annual Meetings of the National Committee for Canada of the I.A.U. (1967–1970) and Canadian Astronomical Society (1971–1996) .......................................................................168 Abstracts of Papers Presented at the Annual General Assembly of the Royal Astronomical Society of Canada (1969–1996) ...........................................................207 JRASC Index (1967-1996) Page 1 PREFACE The last cumulative Index to the Journal, published in 1971, was compiled by Ruth J. Northcott and assembled for publication by Helen Sawyer Hogg. It included all articles published in the Journal during the interval 1932–1966, Volumes 26–60. In the intervening years the Journal has undergone a variety of changes. In 1970 the National Newsletter was published along with the Journal, being bound with the regular pages of the Journal. In 1978 the National Newsletter was physically separated but still included with the Journal, and in 1989 it became simply the Newsletter/Bulletin and in 1991 the Bulletin. That continued until the eventual merger of the two publications into the new Journal in 1997. -
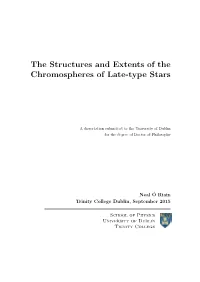
The Structures and Extents of the Chromospheres of Late-Type Stars
The Structures and Extents of the Chromospheres of Late-type Stars A dissertation submitted to the University of Dublin for the degree of Doctor of Philosophy Neal O´ Riain Trinity College Dublin, September 2015 School of Physics University of Dublin Trinity College Declaration I declare that this thesis has not been submitted as an exercise for a degree at this or any other university and it is entirely my own work. I agree to deposit this thesis in the University's open access institu- tional repository or allow the library to do so on my behalf, subject to Irish Copyright Legislation and Trinity College Library conditions of use and acknowledgement. Name: Neal O´ Riain Signature: ........................................ Date: .......................... Summary The chromosphere is the region of a star, above what is traditionally defined as the stellar surface, from which photons freely escape. As the definition implies, this region is characterised by complexity, non- equilibrium, and specifying its structure is a vastly non-linear, non- local problem. In this work we are concerned with the chromospheres of late-type stars, objects of spectral type K to M, the thermodynamic structure, extent, and heating mechanisms of whose chromospheres are not well understood. We use a number of observational and computa- tional methods in order to gain a detailed quantitative understanding of these chromospheres. We construct a model to compute the mm, thermal bremsstrahlung flux from the chromospheres of late-type objects, based on a number of simplifying assumptions concerning their thermodynamic structure. We compare this model with archival and recent observations, and find that the model is capable of reproducing the observed flux from objects of spectral type K to mid-M in the frequency range 100 GHz { 350 GHz. -

Arxiv:1108.4369V1
THE ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2011, IN PRESS Preprint typeset using LATEX style emulateapj v. 03/07/07 TESTING A PREDICTIVE THEORETICAL MODEL FOR THE MASS LOSS RATES OF COOL STARS STEVEN R. CRANMER AND STEVEN H. SAAR Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 Draft version February 7, 2018 ABSTRACT The basic mechanisms responsible for producing winds from cool, late-type stars are still largely unknown. We take inspiration from recent progress in understanding solar wind acceleration to develop a physically motivated model of the time-steady mass loss rates of cool main-sequence stars and evolved giants. This model follows the energy flux of magnetohydrodynamic turbulence from a subsurface convection zone to its eventual dissipation and escape through open magnetic flux tubes. We show how Alfvén waves and turbulence can produce winds in either a hot corona or a cool extended chromosphere, and we specify the conditions that determine whether or not coronal heating occurs. These models do not utilize arbitrary normalization factors, but instead predict the mass loss rate directly from a star’s fundamental properties. We take account of stellar magnetic activity by extending standard age-activity-rotation indicators to include the evolution of the filling factor of strong photospheric magnetic fields. We compared the predicted mass loss rates with observed values for 47 stars and found significantly better agreement than was obtained from the popular scaling laws of Reimers, Schröder, and Cuntz. The algorithm used to compute cool-star mass loss rates is provided as a self-contained and efficient computer code. We anticipate that the results from this kind of model can be incorporated straightforwardly into stellar evolution calculations and population synthesis techniques. -

Models for Sixty Double-Lined Binaries Containing Giants
Mon. Not. R. Astron. Soc. 000, 000–000 (2016) Printed 17 November 2016 (MN LATEX style file v2.2) Models for Sixty Double-Lined Binaries containing Giants Peter P. Eggleton1⋆ Kadri Yakut2 1 Lawrence Livermore National Laboratory, 7000 East Ave, Livermore, CA94551, USA 2 Department of Astronomy & Space Sciences, University of Ege, 35100, Bornova–Izmir,˙ Turkey Received ABSTRACT The observed masses, radii and temperatures of 60 medium- to long-period binaries, most of which contain a cool, evolved star and a hotter less-evolved one, are compared with theoretical models which include (a) core convective overshooting, (b) mass loss, possibly driven by dynamo action as in RS CVn binaries, and (c) tidal friction, in- cluding its effect on orbital period through magnetic braking. A reasonable fit is found in about 42 cases, but in 11 other cases the primaries appear to have lost either more mass or less mass than the models predict, and in 4 others the orbit is predicted to be either more or less circular than observed. Of the remaining 3 systems, two (γ Per and HR 8242) have a markedly ‘over-evolved’ secondary, our explanation being that the primary component is the merged remnant of a former short-period sub-binary in a former triple system. The last system (V695 Cyg) defies any agreement at present. Mention is also made of three other systems (V643 Ori, OW Gem and V453 Cep), which are relevant to our discussion. Key words: Stellar evolution – binaries – composite-spectrum binaries 1 INTRODUCTION be more like 10% than 3%. One such study was made by Schr¨oder et al. -

International Astronomical Union Commission 42 BIBLIOGRAPHY
International Astronomical Union Commission 42 BIBLIOGRAPHY OF CLOSE BINARIES No. 74 Editor-in-Chief: C.D. Scarfe Editors: H. Drechsel D.R. Faulkner V.G. Karetnikov E. Lapasset C. Maceroni Y. Nakamura P.G. Niarchos R.G. Samec W. Van Hamme M. Wolf Material published by March 15, 2002 BCB issues are available via URL: http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/ftp/bcb or via anonymous ftp from: ftp://www.sternwarte.uni-erlangen.de/pub/bcb This issue is also available via URL: http://www.astro.washington.edu/szkody/c42/ The bibliographical entries for Individual Stars and Collections of Data are categorized according to the following coding scheme: 1. Observational data a. Photometry b. Spectroscopy c. Spectrophotometry d. Polarimetry e. Astrometry, interferometry f. Times of minima g. γ-ray data i. Infrared data o. Optical data p. Photographic data r. Radio data u. Ultraviolet data v. Visual estimates x. X-ray data 2. Derived physical data a. Orbital elements b. Absolute dimensions, masses c. New or improved ephemeris, period variations d. Apsidal motion e. Physical properties of stellar atmospheres f. Chemical abundances g. Accretion disks and accretion phenomena 3. Catalogues, discoveries, charts a. Catalogues b. Discoveries of new binaries and novae c. Identification of optical counterparts of X-ray, IR, or radio sources d. Finding charts 4. Observational techniques 5. Theoretical investigations 6. Statistical investigations 7. Miscellaneous a. Abstract b. Addenda or errata Abbreviations AD accretion disk HMXB high-mass x-ray binary QPO quasi-periodic oscillation BH black hole IP intermediate polar RV radial velocity CB close binary LC light curve SB spectroscopic binary CV cataclysmic variable LMXB low-mass x-ray binary WD white dwarf EB eclipsing binary NS neutron star WR Wolf-Rayet star Several entries of this issue use the abbreviation: OAP | Odessa Astronomical Publications (issue of the Odessa Astronomical Observatory of the Odessa State University, Ukraine), Astroprint Publishing Company, Ukraine Individual Stars Z And Kilpio, E.Y. -

8207258.Pdf (6.19
INFORMATION TO USERS This was produced from a copy of a document sent to us for microfilming. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or notations which may appear on this reproduction. 1. The sign or “target” for pages apparently lacking from the document photographed is “ Missing Page(s)” . If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages to assure you of complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark it is an indication that the film inspector noticed either blurred copy because of movement during exposure, or duplicate copy. Unless we meant to delete copyrighted materials that should not have been filmed, you will find a good image of the page in the adjacent frame. If copyrighted materials were deleted you will find a target note listing the pages in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photo graphed the photographer has followed a definite method in “sectioning" the material. It is customary to begin filming at the upper left hand corner of a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, sectioning is continued again-beginning below the first row and continuing on until complete. -

Other Kuiper Belts
OTHER KUIPER BELTS M. Jura Department of Physics and Astronomy, University of California, Los Angeles CA 90095-1562; [email protected] ABSTRACT When a main sequence star evolves into a red giant and its Kuiper Belt Object’s (KBO’s) reach a temperature of ∼170 K, the dust released during the rapid ice-sublimation of these cometary bodies may lead to a detectable infrared excess at 25 µm, depending upon the mass of the KBO’s. Analysis of IRAS data for 66 first ascent red giants with 200 L⊙ <L< 300 L⊙ within 150 pc of the Sun provides an upper limit to the mass in KBO’s at 45 AU orbital radius that is usually less than ∼0.1 M⊕. With improved infrared data, we may detect systems of KBO’s around first ascent red giants that are analogs to our Solar System’s KBO’s. Subject headings: circumstellar matter – comets – stars, red giants 1. INTRODUCTION The formation and evolution of large solids such as comets, asteroids and planets in astrophysical environments is of great interest. Here, we investigate whether other stars arXiv:astro-ph/0311629v1 28 Nov 2003 possess Kuiper Belt Objects (KBO’s) similar to those found in the Solar System. We assume that the hypothetical KBO’s around other stars resemble those in our Solar System and have a composition of ice and dust similar to that of comets (see Luu & Je- witt 2002). During the main sequence phase of the star’s evolution, the KBO’s quiescently remain in stable orbits. However, when the star becomes a red giant, the KBO’s become sufficiently hot that ice sublimates and previously embedded dust particles are ejected into the surroundings. -

PHOST Abstractbook.Pdf
PHOST Physics of Oscillating Stars WHAT PHYSICS CAN WE LEARN FROM OSCILLATING STARS? A conference in honour of Professor Hiromoto Shibahashi. Most of what we know of the universe comes from studying stars. From the birth and evolution of galaxies to the nature of planets, obtaining reliable results needs precise knowledge of the stellar outer parameters, as well as their internal structure and evolution. Until recently, this information only came from the observations and analysis of stellar light, by either spectroscopy or photometry. From these observations, we could derive the atmospheric temperature and pressure, the surface gravity, the magnetic field and the surface abundances of the chemical elements, by using model atmospheres. It was possible to measure the radius of nearby stars by using interferometry and we had access to surface rotation and activity from the study of spectral lines. However, the stellar internal structure could only be derived through evolutionary models. The advent of helioseismology, in the 1970s, and asteroseismology, twenty years later, represented a revolution for stellar studies. The detection and analysis of stellar oscillation modes led to direct insight of the deep layers of the Sun and the stars. This gave access to their internal structure, depth of the convection zones, internal temperature, pressure and density, internal rotation, and more. Asteroseismology provided tools to distinguish hydrogen shell-burning from helium core burning red giant stars, as well as the evolution of their rotating cores. It also yielded precise values of the radii, masses, and ages of exoplanet-host stars, needed for a good determination of the parameters of the planets and a good characterization of their internal structure. -

List of Publications
R.F. Griffin — list of publications 1958 Coronal lines in post-maximum spectra of RS Oph 1958. Observatory, 78, 245. (With A.D. Thackeray.) 1960 Photoelectric measurements of the λ 4200 A˚ CN band and the G band in G8–K5 spectra. Mon. Not. R. Astr. Soc., 120, 287. (With R.O. Redman.) 1961 Photoelectric measurements of the λ 5250 A˚ Fe I triplet and the D lines in G and K stars. Mon. Not. R. Astr. Soc., 122, 181. 1963 Positions of optical objects in the fields of 42 radio sources. Astr. J., 68, 421. Short-term changes in the spectrum of Arcturus. Observatory, 83, 255. 1964 The spectrum of Arcturus in the far infrared. Mon. Not. R. Astr. Soc., 128, 187. Very broad features in the spectra of late-type stars. Observatory, 84, 154. Resolving power of the 100-inch coud´espectrograph in the infrared. Astrophys. J., 139, 1387. 1966 The spectroscopic binary 73 Leonis. Observatory, 86, 145. 1967 A photoelectric radial-velocity spectrometer. Astrophys. J., 148, 465. Hyperfine structure in the spectrum of Arcturus. Observatory, 87, 253. (With R.E.M. Griffin.) Curve-of-growth analysis of the spectrum of Arcturus. Mon. Not. R. Astr. Soc., 137, 253. (With R.E.M. Griffin.) 1968 A photometric atlas of the spectrum of Arcturus. (Cambridge Philosophical Society.) 1969 Forbidden Ca II in Arcturus. Observatory, 89, 9. (With R.E.M. Griffin.) Rubidium in Arcturus. Observatory, 89, 62. (With R.E.M. Griffin.) Some effects of the imstrumental profile in stellar spectrophotometry, with particular reference to the Arcturus Atlas. Mon. -

Books on Variable Stars - Storm Dunlop 17 BAA Journal Papers on Variable Stars 19 Fadars - Dr David Pike 22 Ζ Aurigae Binary Stars - Dr R.F
The British Astronomical Association VARIABLE STAR SECTION JULY CIRCULAR 69 1989 ISSN 0267-9272 Office: Burlington House, Piccadilly, London, W1V 9AG VARIABLE STAR SECTION CIRCULAR 69 CONTENTS Editorial 1 UK Nova/Supemova Patrol Report - Guy Hurst 1 Forthcoming VSS Reports 4 Visual Observations of Alpha Comae Berenices in 1989 February - Tristram Brelstaff 4 The VSS Programme (letter) - Norman Kieman 7 Publication of Eclipsing Binary Report: 1987 8 VSSC 68 - Errata and Notes 8 Replacement illustrations for Pro-Am Meeting report (VSSC 68 pp. 13-22) 9-16 Books on Variable Stars - Storm Dunlop 17 BAA Journal papers on variable stars 19 Fadars - Dr David Pike 22 ζ Aurigae Binary Stars - Dr R.F. Griffin 23 Professional-Amateur Exchanges 1988 Jun-Dec - Guy Hurst 26 European Meeting of the AAVSO (Brussels, 1990 Jly 24-28) 29 V Arietis 29 Chart of V Arietis 30 Telescopic Stars - 1987 31 Professional-Amateur Liason Committee Newsletter No. 2 centre pages Castle Printers of Wittering Editorial We would like to thank the many members who have sent appreciative comments on the layout and appearance of the last Circular. Several of the items in this Circular have been submitted by electronic mail, which certainly makes the Editor’s life easier, and particular thanks must go to Jean Felles (again) for patiently typing out lots of unfamilar material and forwarding it by email. All contributions are welcome, however, even those hand-written or typed. If submitting diagrams or charts, please do n o t plo t them on grey grid graph paper - eith er blue o r orange grids can b e lo s t' in reproduction, grey cannot and the result is often an unreadable diagram that has to be redrawn before reproduction.