Satzung Des Teckids Ev I Amtlicher Satzungstext
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Software Package Data Exchange (SPDX®) Specification
Software Package Data Exchange (SPDX®) S pecification – Draft 2.0rc320150303 ® Software Package Data Exchange (SPDX) Specification Draft: 2.0rc320150303 ` Copyright © 20102015 Linux Foundation and its Contributors. Licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 Unported. All other rights are expressly reserved. Page 1 of 91 Software Package Data Exchange (SPDX®) S pecification – Draft 2.0rc320150303 Copyright © 20102015 Linux Foundation and its Contributors. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 Unported (CCBY3.0) reproduced in its entirety in Appendix V herein. All other rights are expressly reserved. With thanks to Adam Cohn, Andrew Back, Ann Thornton, Bill Schineller, Bruno Cornec, Ciaran Farrell, Daniel German, Debra McGlade, Dennis Clark, Ed Warnicke, Eran Strod, Eric Thomas, Esteban Rockett, Gary O'Neall, Guillaume Rousseau, Hassib Khanafer, Jack Manbeck, Jaime Garcia, Jeff Luszcz, Jilayne Lovejoy, John Ellis, Karen Copenhaver, Kate Stewart, Kim Weins, Kirsten Newcomer, Liang Cao, MarcEtienne Vargenau, Mark Gisi, Marshall Clow, Martin Michlmayr, Martin von Willebrand, Matt Germonprez, Michael J. Herzog, Michel Ruffin, Nuno Brito, Paul Madick, Peter Williams, Phil Robb, Philip Odence, Philip Koltun, Pierre Lapointe, Rana Rahal, Sameer Ahmed, Scott K Peterson, Scott Lamons, Scott Sterling, Shane Coughlan, Steve Cropper, Stuart Hughes, Tom Callaway, Tom Vidal, Thomas F. Incorvia, Venkata Krishna and Zachary McFarland for their contributions and assistance. Copyright -

1 Agreement Between Rothschild Patent Imaging
DocuSign Envelope ID: 830AE77C-41F6-46CC-9DAA-945BD199B6E3 AGREEMENT BETWEEN ROTHSCHILD PATENT IMAGING, LLC, LEIGH ROTHSCHILD, AND THE GNOME FOUNDATION. This Agreement (“Agreement”), dated as of the date of signature of the last signatory below (the “Effective Date”), is entered into by and between, on the one hand, Leigh Rothschild, an individual (“Rothschild”), and Rothschild Patent Imaging LLC, a Texas limited liability company with a principal place of business at 1400 Preston Road, Suite 400, Plano, Texas 75093 (“Grantor”) and, on the other hand, the Gnome Foundation, with a principal place of business at #117 21 Orinda Way C, Orinda, CA 94563 (“Grantee”) (Grantor and Grantee may be individually referred to as “Party” and collectively as “Parties”); WHEREAS, Grantor owns all right, title, and interest in and to United States Patent No. 9,936,086 (“the ’086 patent”); WHEREAS, Rothschild is the named inventor on more than 100 patents and applications, and has the right and authority to grant, or cause other entities to grant, binding covenants not to sue, releases and licenses with respect to the patents and patent applications on which he is a named inventor; WHEREAS Rothschild desires to support the open source community generally and the Parties view this support to be a material part of this Agreement NOW THEREFORE, for valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is acknowledged, and other consideration as set forth below, Grantor, Rothschild, and Grantee agree as follows: DEFINITIONS “Affiliate(s)” of an Entity shall mean any and all Entities, past, present, or future, that are or were Controlled, directly, by the Entity, but only for so long as such Control existed or exists. -
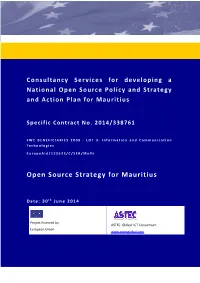
Open Source Strategy for Mauritius
Consultancy Services for developing a National Open Source Policy and Strategy and Action Plan for Mauritius Specific Contract No. 2014/338761 FWC BENEFICIARIES 2009 - LOT 3: Information and Communication Technologies EuropeAid/132633/C/SER/Multi Open Source Strategy for Mauritius D a t e : 3 0 t h J u n e 2 0 1 4 Project financed by ASTEC Global ICT Consortium European Union www.astecglobal.com National Open Source Software Strategy for the Republic of Mauritius National Open Source Software Strategy for the Republic of Mauritius “Open Mauritius, like you have never experienced IT before!” National Open Source Software Strategy for the Republic of Mauritius Prepared for the Ministry of Information and Communication Technology with the support of European Union by: Andrej Kositer CEO, Agenda Open Systems; www.agenda.si coordinator, COKS Slovenian Open Source Competence Center IPROK, Institut for Research and development of Open Source [email protected] Olivier Alais Co-founder, Soukeina; www.soukeina.com [email protected] National Open Source Software Strategy for the Republic of Mauritius Table of Contents VISION.........................................................................................................................1 Principles of implementation of OSS policy and strategy..............................................................2 Definitions....................................................................................................................................3 Open Source Software...............................................................................................................3 -

SPDX 1.0 Specification
Software Package Data Exchange (SPDX™) Specification Version: 1.0 Software Package Data Exchange (SPDX™) Specification TABLE OF CONTENTS 1 RATIONALE.....................................................................................................5 1.1 CHARTER.................................................................................................................................... 5 1.2 DEFINITION.................................................................................................................................. 5 1.3 WHY IS A COMMON FORMAT FOR DATA EXCHANGE NEEDED?............................................................................5 1.4 WHAT DOES THIS SPECIFICATION COVER?.................................................................................................5 1.5 WHAT IS NOT COVERED IN THE SPECIFICATION?..........................................................................................6 1.6 FORMAT REQUIREMENTS:...................................................................................................................6 1.7 CONFORMANCE.............................................................................................................................. 7 2 SPDX DOCUMENT INFORMATION......................................................................8 2.1 SPDX VERSION ........................................................................................................................... 8 2.2 DATA LICENSE ........................................................................................................................... -

Turpeinen Timo.Pdf (1.285Mt)
AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMIA PAIKKATIETOAINEISTON KÄSITTELYSSÄ Turpeinen Timo Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Maanmittaustekniikka Insinööri (AMK) 2017 Opinnäytetyön tiivistelmä Tekniikka ja liikenne Maanmittaustekniikka Insinööri (AMK) Tekijä Timo Turpeinen Vuosi 2017 Ohjaaja(t) Jaakko Lampinen Työn nimi Avoimen lähdekoodin ohjelmia paikkatietoaineiston käsittelyssä Sivu- ja liitesivumäärä 30 + 3 Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu yleisimpiä avoimen lähdekoodin lisensse- jä sekä avoimen lähdekoodin ohjelmia paikkatietoaineistojen käsittelyyn liittyen. Ensisijaisesti on keskitytty QGIS-ohjelmiston toimintaan ja sen käyttökelpoisuu- teen. Opinnäytetyö on syntynyt tekijän oman kiinnostuksen pohjalta avoimen lähde- koodin ohjelmiin sekä avoimeen aineistoon. Työssä on pyritty selvittämään tar- jolla olevia ohjelmistoja Open Source Geospatial-paikkatietoportaalista ja tes- taamaan ohjelmia käyttämällä avointa aineistoa. Työssä havaittiin QGIS-ohjelmiston laaja-alaisuus ja skaalattavuus eri käyttö- tarpeisiin, etenkin jos on valmis panostamaan ohjelmien koodaamiseen. Ohjel- man haittapuolena voidaan toisaalta pitää sen monipuolisuutta, joka vaatii pal- jon perehtymistä. Avainsanat avoin lähdekoodi, OSGeo, QGIS Abstract of Thesis Technology, Communication and Transport Degree Programme in Land Surveying Bachelor of Engineering Author Timo Turpeinen Year 2017 Supervisor Jaakko Lampinen Subject of thesis Open Source Software for Processing Spatial Data Number of pages 30 + 3 This study concentrated on the most common open source licenses and open source software for handling spatial data. The main focus was on the viability of the QGIS software and its functions. The study was done because of the author’s own interest in the open source software and open data. The aim was to study the software available in the Open Source Geospatial portal and run tests using open data. In this study it was found that the QGIS software can be applied for wide spec- trum of different tasks, especially if someone is prepared to learn coding pro- grams. -

Licensing-In Keep Track of Third-Party Components; Manage Their Compatibility
Challenges in Software Licensing You can do IT. Entrepreneurship in IT and Maths Saarbrücken, 06 June 2018 Sigmar Lampe Counsel IP and Licensing European Patent and Trademark Attorney Technology Transfer Office University of Luxembourg 1 Outline 1. Defining software – what is it? 2. Intellectual property rights (IPR) in software 3. Free and open source software (FOSS) vs. proprietary software 4. Software licence compliance 5. Licensing models 6. Examples 7. Take home messages 2 1. Defining software 3 Computer System HARDWARE SOFTWARE (physical) (logial) 4 ASTP-Proton Annual Conference 2016 25 – 27 May, Copenhagen, Denmark Software:Software: broad broaD meaningmeaning Software: narrow meaning Databases Data Databases Data Graphic Graphic Document Document user user libraries libraries interface interface Computer Software Computer Software … … programs (electronic) programs (electronic) 5 Elements of computer program Functionality Data files Preparatory Computer Design work programs Programming statements Algorithms IPR IN SOFTWARE Programming language 2 ASTP-Proton Annual Conference 2016 25 – 27 May, Copenhagen, Denmark Software: broaD meaning Software:Software: narrow narrow meaningmeaning Databases Data Databases Data Graphic Graphic Document Document user user libraries libraries interface interface Computer Software Computer Software … … programs (electronic) programs (electronic) 6 Elements of computer program Functionality Data files Preparatory Computer Design work programs Programming statements Algorithms IPR IN SOFTWARE Programming language 2 ASTP-Proton Annual Conference 2016 25 – 27 May, Copenhagen, Denmark Software: broaD meaning Software: narrow meaning Databases Data Databases Data Graphic Graphic Document Document user user libraries libraries interface interface Computer Software Computer Software … … programs (electronic) programs (electronic) ElementsElements of of a computerComputer program Program Functionality Data files Preparatory Computer Design work programs Programming statements Algorithms IPR IN SOFTWARE Programming language 7 2 2. -

Filozofija Slobodnog Softvera
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN Mario Cvrtila FILOZOFIJA SLOBODNOG SOFTVERA ZAVRŠNI RAD Varaždin, 2012. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN Mario Cvrtila Redoviti student Broj indeksa: 37438/08-R Smjer: Informacijski sustavi Preddiplomski studij FILOZOFIJA SLOBODNOG SOFTVERA ZAVRŠNI RAD Mentor: Doc. dr. sc. Markus Schatten Varaždin, rujan 2012. Sadržaj 1. UVOD ....................................................................................................................................................................... 1 2. SLOBODAN SOFTVER ........................................................................................................................................ 2 3. POVIJEST SLOBODNOG SOFTVERA .............................................................................................................. 3 3.1. UC BERKELEY I BSD ......................................................................................................................................... 3 3.2. RICHARD STALLMAN I GNU .............................................................................................................................. 4 3.3.LINUS TORVALDS I LINUX ................................................................................................................................... 7 4. FILOZOFIJA SLOBODNOG SOFTVERA ....................................................................................................... 11 4.1. COPYLEFT ....................................................................................................................................................... -

Specification Version 2.2
Software Package Data Exchange (SPDX®) Specification Version 2.2 SPDX Specification – Version 2.2 Table of Contents The Software Package Data Exchange (SPDX®) Specification Version 2.2 ................................... 7 1 Rationale ............................................................................................................................................................... 8 1.1 Charter .......................................................................................................................................................... 8 1.2 Definition ...................................................................................................................................................... 8 1.3 Why is a common format for data exchange needed? ................................................................ 8 1.4 What does this specification cover?................................................................................................... 8 1.5 What is not covered in the specification? ........................................................................................ 9 1.6 What does “Package” mean in the context of SPDX? ................................................................ 10 1.7 Format Requirements .......................................................................................................................... 10 1.8 Conformance ........................................................................................................................................... -

Software Package Data Exchange (SPDX ) Specification
Software Package Data Exchange (SPDX®) Specification Version: 1.2 Software Package Data Exchange (SPDX®) Specification - Version 1.2 Copyright © 2010-2013 Linux Foundation and its Contributors. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 Unported (CC-BY-3.0) reproduced in its entirety in Appendix IV herein). All other rights are expressly reserved. With thanks to Adam Cohn, Andrew Back, Ann Thornton, Bill Schineller, Bruno Cornec, Ciaran Farrell, Daniel German, Debra McGlade, Ed Warnicke, Eran Strod, Eric Thomas, Esteban Rockett, Gary O'Neall, Guillaume Rousseau, Jack Manbeck, Jaime Garcia, Jeff Luszcz, Jilayne Lovejoy, John Ellis, Karen Copenhaver, Kate Stewart, Kim Weins, Kirsten Newcomer, Liang Cao, Marc-Etienne Vargenau, Mark Gisi, Marshall Clow, Martin Michlmayr, Martin von Willebrand, Matt Germonprez, Michael J. Herzog, Michel Ruffin, Peter Williams, Phil Robb, Philip Odence, Philip Koltun, Pierre Lapointe, Rana Rahal, Sameer Ahmed, Scott K Peterson, Scott Lamons, Shane Coughlan, Steve Cropper, Stuart Hughes, Tom Callaway, and Thomas F. Incorvia for their contributions and assistance. Copyright © 2010-2013 Linux Foundation and its Contributors. Licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 Unported. All other rights are expressly reserved. Page 2 of 72 Software Package Data Exchange (SPDX®) Specification - Version 1.2 TABLE OF CONTENTS 1 Rationale .......................................................................................................................................5 1.1 Charter -

Android Open Source Licenses
/kernel /root/file_contexts /root/init /root/property_contexts /root/sbin/adbd /root/seapp_contexts /root/sepolicy /system/app/Browser.apk /system/app/CertInstaller.apk /system/app/CubeLiveWallpapers.apk /system/app/HTMLViewer.apk /system/app/PackageInstaller.apk /system/app/Provision.apk /system/app/UserDictionaryProvider.apk /system/bin/adb /system/bin/am /system/bin/app_process /system/bin/applypatch /system/bin/atrace /system/bin/bu /system/bin/chat /system/bin/content /system/bin/debuggerd /system/bin/dhcpcd /system/bin/dnsmasq /system/bin/drmserver /system/bin/dumpsys /system/bin/fsck_msdos /system/bin/gzip /system/bin/ip /system/bin/linker /system/bin/logcat /system/bin/logwrapper /system/bin/make_ext4fs /system/bin/media /system/bin/mediaserver /system/bin/mksh /system/bin/mtpd /system/bin/netcfg /system/bin/ping /system/bin/ping6 /system/bin/pppd /system/bin/racoon /system/bin/requestsync /system/bin/run-as /system/bin/service /system/bin/tc /system/bin/toolbox /system/bin/wm /system/etc/dhcpcd/dhcpcd-hooks/20-dns.conf /system/etc/dhcpcd/dhcpcd-hooks/95-configured /system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks /system/etc/mkshrc /system/etc/security/cacerts/00673b5b.0 /system/etc/security/cacerts/03e16f6c.0 /system/etc/security/cacerts/08aef7bb.0 /system/etc/security/cacerts/0d188d89.0 /system/etc/security/cacerts/10531352.0 /system/etc/security/cacerts/111e6273.0 /system/etc/security/cacerts/1155c94b.0 /system/etc/security/cacerts/119afc2e.0 /system/etc/security/cacerts/11a09b38.0 -
![End-User License Agreement [Español]](https://docslib.b-cdn.net/cover/2797/end-user-license-agreement-espa%C3%B1ol-11812797.webp)
End-User License Agreement [Español]
Acuerdo de licencia y declaración de software de terceros EULA04200001 Esta documentación y los programas pertinentes (denominados conjuntamente "Software" en lo sucesivo) están protegidos por derechos de autor. Los autores acogen con agrado cualquier información relativa a contenidos incorrectos u obsoletos a través de [email protected] El Software se entrega únicamente en formato legible por máquina (formato de código objeto). En virtud de todos los derechos de propiedad intelectual que posee Televes, esta otorga por la presente al licenciatario un derecho no exclusivo a utilizar el Software. El derecho de utilización del Software se concede para un período de tiempo ilimitado, a menos que se disponga lo contrario. El licenciatario tendrá derecho a realizar una copia exclusivamente con fines de copia de seguridad personal (copia de respaldo). Salvo que la legislación establezca otra cosa, el licenciatario no tendrá derecho a modificar, desmontar, realizar labores de ingeniería inversa, descompilar o alterar de cualquier otro modo el Software en todo o en parte. Televes se reserva todos los derechos de propiedad intelectual, salvo los expresamente otorgados en virtud de la presente. El licenciatario no tendrá derecho a modificar o eliminar códigos alfanuméricos u otros códigos de identificación sobre soportes de datos, y transferirá dichos códigos de identificación a cualquier copia de respaldo que realice lícitamente. El licenciatario no tendrá derecho a transmitir cualquier información incluida en este documento sin contar con la autorización previa por escrito de Televes. Las modificaciones del software propietario de Televes para su propio uso y la ingeniería inversa para la depuración de dichas modificaciones están permitidas en la medida en que dichos componentes de software estén vinculados a las bibliotecas de programas bajo la Licencia Pública General Menor de GNU (LGPL). -

Software Package Data Exchange (SPDX)
® Software Package Data Exchange (SPDX ) Specification Version: 2.1 ` Copyright © 20102016 Linux Foundation and its Contributors. Licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 Unported. All other rights are expressly reserved. ® Software Package Data Exchange (SPDX ) Specification – Version 2.1 Copyright © 20102016 Linux Foundation and its Contributors. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 Unported (CCBY3.0) reproduced in its entirety in Appendix V herein. All other rights are expressly reserved. With thanks to Adam Cohn, Andrew Back, Ann Thornton, Bill Schineller, Bruno Cornec, Ciaran Farrell, Daniel German, David Wheeler, Debra McGlade, Dennis Clark, Ed Warnicke, Eran Strod, Eric Thomas, Esteban Rockett, Gary O'Neall, Guillaume Rousseau, Hassib Khanafer, Jack Manbeck, Jaime Garcia, Jeff Luszcz, Jilayne Lovejoy, John Ellis, Karen Copenhaver, Kate Stewart, Kevin Mitchell, Kim Weins, Kirsten Newcomer, Kris Reeves, Liang Cao, MarcEtienne Vargenau, Mark Gisi, Marshall Clow, Martin Michlmayr, Martin von Willebrand, Matt Germonprez, Michael J. Herzog, Michel Ruffin, Nuno Brito, Oliver Fendt, Paul Madick, Peter Williams, Phil Robb, Philip Odence, Philip Koltun, Phillippe Ombredanne, Pierre Lapointe, Rana Rahal, Robin Gandhi, Sam Ellis, Sameer Ahmed, Scott K Peterson, Scott Lamons, Scott Sterling, Shane Coughlan, Steve Cropper, Stuart Hughes, Tom Callaway, Tom Vidal, Thomas F. Incorvia, Venkata Krishna, Yev Bronshteyn, and Zachary McFarland for their contributions and assistance.