Sammelrezension
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Anti-Semitism: a History
ANTI-SEMITISM: A HISTORY 1 www.counterextremism.com | @FightExtremism ANTI-SEMITISM: A HISTORY Key Points Historic anti-Semitism has primarily been a response to exaggerated fears of Jewish power and influence manipulating key events. Anti-Semitic passages and decrees in early Christianity and Islam informed centuries of Jewish persecution. Historic professional, societal, and political restrictions on Jews helped give rise to some of the most enduring conspiracies about Jewish influence. 2 Table of Contents Religion and Anti-Semitism .................................................................................................... 5 The Origins and Inspirations of Christian Anti-Semitism ................................................. 6 The Origins and Inspirations of Islamic Anti-Semitism .................................................. 11 Anti-Semitism Throughout History ...................................................................................... 17 First Century through Eleventh Century: Rome and the Rise of Christianity ................. 18 Sixth Century through Eighth Century: The Khazars and the Birth of an Enduring Conspiracy Theory AttacKing Jewish Identity ................................................................. 19 Tenth Century through Twelfth Century: Continued Conquests and the Crusades ...... 20 Twelfth Century: Proliferation of the Blood Libel, Increasing Restrictions, the Talmud on Trial .............................................................................................................................. -

The Frankfurt Judengasse in Eyewitness Accounts from the Seventeenth to the Nineteenth Century
Provided by the author(s) and NUI Galway in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title The Frankfurt Judengasse in Eyewitness Accounts from the Seventeenth to the Nineteenth Century Author(s) Bourke, Eoin Publication Date 1999 Bourke, E. (1999) The Frankfurt Judengasse in Eyewitness Publication Accounts from the Seventeenth to the Nineteenth Century. In Information A. Fuchs & F. Krobb (eds.) Ghetto Writing: Traditional and Eastern Jewry in German-Jewish Literature from Heine to Hilsenrath. (pp.11-24). Columbia, SC: Camden House. Publisher Camden House Item record http://hdl.handle.net/10379/589 Downloaded 2021-09-23T16:41:53Z Some rights reserved. For more information, please see the item record link above. Eoin Bourke The Frankfurt Judengasse in Eyewitness Accounts from the Seventeenth to the Nineteenth Century In Der Rabbi von Bacherach [The Rabbi of Bacherach, 1824/40] Hein rich Heine synopsises the pre-history of the Judengasse in Frankfurt from the point of view of a fictitious narrator of the fifteenth century: Vor jener Zeit wohnten die Juden zwischen dem Dom und dem Mainufer, nämlich von der Brücke bis zum Lumpenbrunnen und von der Mehlwaage bis zu Sankt Bartholomäi. Aber die katholischen Priester erlangten eine päpstliche Bulle, die den Juden verwehrte in solcher Nähe der Haupt kirche zu wohnen, und der Magistrat gab ihnen einen Platz auf dem Wollgraben, wo sie das heutige Judenquartier erbauten.' The time referred to was 1462, when both Kaiser Friedrich III and Pope Pius II -
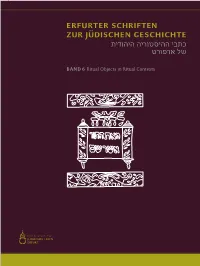
BAND 6 Ritual Objects in Ritual Contexts 236 Imprint / Impressum
BAND 6 Ritual Objects in Ritual Contexts 236 imPRint / imPRessum Imprint / Impressum he RausgebeRinnen Claudia D. Bergmann und Maria Stürzebecher im Auftrag der Landeshauptstadt Erfurt 99111 Erfurt www.erfurt.de sowie der Universität Erfurt Nordhäuser Str. 63 99089 Erfurt Redaktion Frank Bussert Gestaltung papenfuss | Atelier für Gestaltung, Weimar Umschlagmotiv Illustration nach Thorawimpel, TLMH Inv. Nr. S23d. papenfuss | Atelier für Gestaltung Weimar Verlag Bussert & Stadeler, Jena · Quedlinburg 1. Auflage 2020 Für den Inhalt der Beiträge sind die Autoren verantwortlich. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung sowie Speicherung in elektronischen Medien bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Herausgebers. Copyright 2020 ISBN 978-3-942115-82-7 12 ritual objEcts from mEdiEval Erfurt The Erfurt Judeneid between Pragmatism and Ritual: Some Aspects of Christian and Jewish Oath-Taking in Medieval Germany andreaS lehnertz The thing you are accused of, [you swear that] you are not 1 Erfurt, Municipal Archives, 0-0/A XLVII, n.1: »Des dich dirre sculdegit, des guilty [of it]. So help you God. The God who created bistur unschuldic. So dir got helfe. Der heaven and earth, leaves, and grass, which have never existed got der himel unde erdin gescuf. Loub, before. And if you swear falsely, the earth that swallowed blumen unde gras, das da uore nine was. Unde ob du unrechte sweris, daz Datan and Aviram shall swallow you. And if you swear falsely, dich dir erde uirslind, di Datan unde leprosy that left Naaman and befell Gehazi shall befall upon Abiron uirslant. Unde ob du unrechte you. And if you swear falsely, the laws which God gave Moses sveris, daz dich di muselsucht biste, on Mount Sinai, which God himself wrote with his fingers di Naamenen liz und Iezi bestunt. -

Anti-Semitic Bigotry : a Retrospective As Chronicled by Historical Medals
Anti-Semitic Bigotry : A Retrospective As Chronicled By Historical Medals by Benjamin Weiss Anti-Semitic Bigotry: A Retrospective As Chronicled By Historical Medals Benjamin Weiss Anti-Semitic Bigotry : A Retrospective As Chronicled By Historical Medals 1 Published by Kunstpedia Foundation Haansberg 19 4874NJ Etten-Leur the Netherlands t. +31-(0)76-50 32 797 www.kunstpedia.org Text : Benjamin Weiss Design : Kunstpedia Foundation Publication : 2015 Copyright Benjamin Weiss. Anti-Semitic Bigotry: A Retrospective As Chronicled By Historical Medals by Benjamin Weiss is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.kunstpedia.org. Anti-Semitic Bigotry : A Retrospective As Chronicled By Historical Medals 2 BIGOT A person who is obstinately or intolerantly devoted to his or her own opinions and prejudices; especially one who regards or treats the members of a group (as a racial or ethnic group) with hatred and intolerance. Merriam Webster.com 2013 HISTORICAL BACKGROUND hile prejudice exists towards many religious and ethnic groups (Endnote 1), over the ages bigoted acts against the Jews have been among the most prevalent, severe and unrelenting. W This intolerance has manifested itself from the relatively inconsequential, such as slurs, insults and distribution of anti-Semitic paraphernalia (Eisler, 2014), to the devastating, including confiscation of property, expulsion from countries, and mass slaughter. Volumes have been written about anti-Semitism and its effects, but the question still remains as to the root causes of anti-Semitic attitudes: Why have they existed for centuries? and How have they been passed on from generation to generation? This article will attempt to examine this issue using historical medals as a backdrop and primary source of information. -

Judaica Olomucensia
Judaica Olomucensia 2016/2017 Special Issue Kurt Schubert, the Founder 1 – 2016/2017 Table of Content Judaica Olomucensia 2016/2017 Special Issue Kurt Schubert, the Founder This special issue is a last and final volume of biannual peer-reviewed journal Judaica Olomucensia. Editor-in-Chief Ingeborg Fiala-Fürst Editor Ivana Cahová, Matej Grochal ISSN 1805-9139 (Periodical) ISBN 978-80-244-5289-0 (Proceedings) Table of Content 5 Introduction Ingeborg Fiala-Fürst 6 The Jewish Community in Olomouc Reborn Josef Jařab 8 Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies Ivana Cahová – Ingeborg Fiala-Fürst 27 The Importance of Feeling Continuity Eva Schubert 30 Interreligious Dialogue as The Mainstay of Kurt Schubert’s Research Petrus Bsteh 33 Kurt and Ursula Schubert Elisheva Revel-Neher 38 The Jewish Museum as a Physical, Social and Ideal Space – a Jewish Space? Felicitas Heimann-Jelinek 47 The Kurt and Ursula Schubert Archive at the University of Vienna Sarah Hönigschnabel 52 The Institute for Jewish Studies in Vienna – From its Beginnings to The Presen Gerhard Langer 65 Between Jewish Tradition and Early Christian Art Katrin Kogman-Appel – Bernhard Dolna 4 – 2016/2017 Introduction Ingeborg Fiala-Fürst The anthology we present to the readers fulfills a dual function: the authors of the individual articles both recall Prof. Kurt Schubert (2017 marked the 10th anniversary of his death) and the institutions which were co-founded by Kurt Schubert and his wife, Ursula Schubert. This double function is reflected in the title of the anthology, "Kurt Schubert, the Founder". One of the youngest institutions that Kurt Schubert helped to found, the Center for Jewish Studies at the Faculty of Arts at Palacký University, is allowed the bear the Schuberts' name since 2008. -

Masterarbeit / Master's Thesis
MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master‘s Thesis „Jüdische Stadtgemeinden im Europa des 17. Jahrhunderts – Frankfurt am Main, Hamburg und Wien im Vergleich“ verfasst von / submitted by Jakob Jorda, BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 805 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Masterstudium Globalgeschichte und Global Studies degree programme as it appears on UG 2002 the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Privatdoz. Mag. Dr. phil. Peter Rauscher Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................................................................. 1 1.1 Fragestellung .......................................................................................................................................... 1 1.2 Aufbau ..................................................................................................................................................... 3 1.3 Forschungsstand und Quellen ............................................................................................................ 4 2. Die Entwicklung Frankfurts, Hamburgs und Wiens vor und während des 17. Jahrhunderts................ 7 2.1 Frankfurt – Messe-, Wahl- und Krönungsstadt .............................................................................. -

Spitäler Im Frankfurter Judenghetto
Spitäler im Frankfurter Judenghetto Die Errichtung des Ghettos In Frankfurt am Main wurden jüdische Einwohner/innen bereits im Jahre 1074 urkundlich erwähnt (Mayer 1966, S. 9). Die Pogrome von 1241 und 1349 vernichteten die ersten Frankfurter jüdischen Gemeinden. Nach ihrer Wiederansiedlung lebten die Jüdinnen und Juden weiterhin ungesichert, rechtlich diskriminiert und ständig bedroht von einem auf Vertreibung abzielenden christlichen Antijudaismus. Es gab jedoch kein Verbot für Juden, in christliche Stadtviertel zu ziehen, ebenso wohnten christliche Frankfurter/innen auch im Judenviertel. Wie sich das jüdische Pflegewesen in dieser Zeit gestaltete, ist weitgehend unbekannt, doch gab es wohl keine strikte Trennung, so dass bei Bedarf gewiss Juden von Christen und Christen von Juden versorgt werden konnten. Schon im 14. Jahrhundert betreuten jüdische Ärzte auch christliche Patienten. Solche Formen der Koexistenz (vgl. aber Grebner 2009) endeten abrupt, als der Frankfurter Rat 1460 – über ein Jahrhundert nach dem letzten Pogrom – die Errichtung eines Judenghettos beschloss (vgl. zu den Gründen Backhaus u.a. 2006). Zwei Jahre später mussten die jüdischen Familien ihre Wohnungen verlassen und wurden dorthin umgesiedelt. Näheres erfahren wir aus der online zugänglichen Informationsdatenbank des Museums Judengasse in Frankfurt am Main: „Die Judengasse, das Frankfurter Judenghetto, lag in der heutigen östlichen Innenstadt. Sie begann an der Konstablerwache, lief entlang der Staufenmauer und führte über die heutige Kurt-Schumacher-Straße bis zu dem Gelände, auf dem jetzt das Gebäude der Stadtwerke steht. Die Judengasse war ganz von Mauern umgeben und so von der übrigen Stadt abgetrennt. Am Nord- und am Südende sowie in der Mitte der zur Innenstadt hin gelegenen Westseite, am so genannten Judenbrückchen, gab es Tore. -

Frankfurter Judaistische Beiträge
Frankfurter Judaistische Beiträge Frankfurt Jewish Studies Bulletin Begründet von Arnold Goldberg im Auftrag der Gesellschaft zur Förderung judaistischer Studien in Frankfurt am Main e. V. herausgegeben vom Seminar für Judaistik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 40·2015 VIII Preface The editors of the "Frankfurt Jewish Studies Bulletin," Elisabeth Hollender Inhalt and Annelies Kuyt, have kindly offered us the opportunity of publishing this collection as a first special issue of the journal; they also devoted much time and energy on editorial issues. We are confident that the present collection will significantly enhance schalarship on Johann Jacob Schudt and his world, and it is our sincere hope that it will not be the last occasion for collaboration between the two research centres at Frankfurt and Trier. Rebekka Voß Christoph Cluse; Rebekka Voß Johann Jacob Schudt's "Jewish Notabilia": Historical Context and Historiographie Significance . I. Describing the "Other": Ethnography, Hebraism and Orientalism in the Eighteenth Century Yaacov Deutsch Schudt and Ethnography of Jews and Judaism in the Early Modern Period . 37 Stephen G. Burnett Schudt and German Christian Hebraism 47 Ivan Kalmar Early Orientalism and the Jews: Baroque Ethnography and Johann Jacob Schudt's "Jewish Memorabilia" . 63 Il. Mo des of Collecting and W riting Jewish History David Schnur Frankfurter Archivalien in den »Jüdischen Merckwürdigkeiten«: Beobachtungen zu Schudts spätmittelalterlicher Quellengrundlage und ihrer Stellung im Gesamtwerk . 79 Sirnon Neuberg Some Philological and Bibliographical Aspects of Yiddish Texts in Schudt . I03 Maria Diemling About Bakers, Butchers, Geese and Pigs: Food and the Negotiating of Boundaries Between Jews and Christians in Johann Jacob Schudt's "Jüdische Merckwürdigkeiten" . -

Dez 2021 Begrüßung Begrüßung
PROGRAMM Sep – Dez 2021 Begrüßung Begrüßung Liebe Freundinnen und Freunde WELCOME BACK des Jüdischen Museums Frankfurt, mehr als fünf Jahre lang haben wir an der Ausstellung „Unser Mut: Juden in Europa 1945-48“ gearbeitet. Nun dürfen wir MIT NEUEM MUT sie Ihnen endlich zeigen. Tauchen Sie ein in die Vielfalt jüdi- scher Erfahrungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es IN DEN HERBST ist die erste transeuropäische Schau, die einen persönlichen und ortsspezifischen Blick auf eine Zeit eröffnet, die von Flucht, Trauer und Überlebenswillen sowie bedeutenden poli- tischen Weichenstellungen geprägt war. Sie wird von einem umfangreichen Beiprogramm begleitet und ist außerordent- lich aktuell. Neben der digital übertragenen Konferenz „Das Jüdische Frankfurt: Geistes- und Kulturgeschichte von der Emanzipa- tion bis zum Nationalsozialismus“, mit welcher wir ursprüng- lich das Museum eröffnen wollten, möchte ich Ihnen auch unser Pop-up-Event „Mapping Memories“ vom 9. - 12. Sep- tember ans Herz legen. An vier Tagen werden wir den Frank- furter Börneplatz mit einem temporären Bau, Performances, Gesprächen, Führungen und neuen digitalen Anwendungen in einen lebendigen Verhandlungsraum verwandeln, in dem es sowohl um zeitgenössische Bezüge auf die jüdische Re- nais sance geht, als auch darum, wie und was wir heute vor Ort erinnern. Wir freuen uns darauf, Ihnen wieder persönlich zu begegnen, Ihre Prof. Dr. Mirjam Wenzel und das Team des Jüdischen Museums Frankfurt Prof. Dr. Mirjam Wenzel © Sandra Hauer Sandra © Mirjam Wenzel Dr. Prof. 2 3 Inhalt Inhalt -

The Judengasse in Frankfurt
Edited by Fritz Backhaus, Raphael Gross, Sabine Kößling and Mirjam Wenzel Translated into English by Adam Blauhut and Michael Foster The Judengasse in Frankfurt Catalog of the History permanent exhibition Politics of the Jewish Culture Museum Frankfurt C.H.BECK With 81 illustrations Translations: Michael Foster (Essay Backhaus), Adam Blauhut (all other texts) 1. Edition. 2016 © Verlag C.H.Beck oHG, Munich 2016 Cover design: surface Gesellschaft für Gestaltung mbH, Frankfurt Cover illustration: Hanukkah lamp by Rötger Herfurth, Jewish Museum Frankfurt ISBN Buch 978 3 406 69097 6 ISBN eBook 978 3 406 69109 6 Contents 7 Foreword, Felix Semmelroth 8 Introduction, Fritz Backhaus, Raphael Gross, Sabine Kößling, Mirjam Wenzel 15 The Judengasse in Frankfurt, Fritz Backhaus 40 The Judengasse Museum – a place of memory, Felicitas Heimann-Jelinek 63 Catalog, Sabine Kößling, Felicitas Heimann-Jelinek 64 Judengasse 65 Jews and Christians 79 Images in the Judengasse 97 Professions 117 Court Jews – the upper class in the Judengasse 125 The trade in used clothing 129 School and lessons 135 Learning – rabbis and students 143 Jewish literature – a history in fragments 169 A life devoted to the community 179 The cemetery 197 The emperor, the city council and the Jews 206 Steinernes Haus 210 Warmes Bad 214 Sperber 218 Roter Widder 222 Weißer Widder 227 Selected bibliography 230 Authors 231 Lenders, Illustration credits 232 Contributors to the exhibition Foreword Felix Semmelroth The Jewish Museum Frankfurt was opened in 1988 in a former mansion of the Rothschild family. It was the first Jewish museum in Germany to develop a comprehensive exhibition of Jewish history and culture after the Holocaust. -

List of Publications Dr.Mirjam Thulin
ABT. FÜR ABENDLÄNDISCHE RELIGIoNSGESCHICHTE DR. MIRJAM THULIN Tel.: +49 (0)6131 - 3939477 Fax: +49 (0)6131 - 3930153 e-mail: [email protected] LIST OF PUBLICATIONS DR. MIRJAM THULIN Monograph Kaufmanns Nachrichtendienst. Ein jüdisches Gelehrtennetzwerk im 19. Jahrhundert, Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht 2012. Editorships (with Markus Krah und Bianca Pick) PaRDeS – die Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien 24 (2018): “200 Jahre Wissenschafts-Kulturen des Judentums”/ “Cultures of Wissenschaft des Judentums at 200”, online: http://v-j-s.org/zeitschrift-pardes/ (forthcoming, peer-reviewed journal). (with Christian Wiese) Wissenschaft des Judentums in Europe: Comparative and Transnational Perspectives, Berlin: Walter de Gruyter (forthcoming). (with Björn Siegel) Jewish Culture and History, Special Issue 19 (2018): „Transformations and Intersections of Shtadlanut and Tzedakah in the Early Modern and Modern Period“, online: http://www.tandfonline.com/eprint/3aY2aZJ6y9tI5dmt6ZJP/full (peer-reviewed journal). (with Fabian Klose) Humanity: A History of European Concepts in Practice from the Sixteenth Century to the Present, Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht 2016. Articles Resuming Contact after World War I: Epistolary Networks of Wissenschaft des Judentums, in: Jewish Quarterly Review 108.1 (Winter 2018) (forthcoming, peer-reviewed). Generations of Wissenschaft des Judentums. The Correspondence between David Kaufmann and Leopold Zunz, in: PaRDeS 24 (2018) (forthcoming, peer-reviewed). Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) Tel. +49 (0)6131 - 3939360 [email protected] Alte Universitätsstraße 19 . 55116 Mainz . Germany Fax: +49 (0)6131 - 3930154 www.ieg-mainz.de 2 Articles “Familie Wertheimer”, “Samson Wertheimer,” and “Simon Wolf Wertheimer”, all in: Neue Deutsche Biographie (NDB), ed. by Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Berlin: Duncker and Humblot (forthcoming). -

Pardes : Zeitschrift Der Vereinigung Für Jüdische Studien Ev
PaRDeS ZEITSCHRIFT DER VEREINIGUNG FÜR JÜDISCHE STUDIEN E.V. HERAUSGEGEBEN VON REBEKKA DENZ UND GRAYNA JUREWICZ IM AUFTRAG DER VEREINIGUNG FÜR JÜDISCHE STUDIEN E.V. IN VERBINDUNG MIT DEM INSTITUT FÜR JÜDISCHE STUDIEN DER UNIVERSITÄT POTSDAM Geographical Turn (2010) HEFT 16 UNIVERSITÄTSVERLAG POTSDAM ISSN (print) 1614-6492 ISSN (online) 1862-7684 ISBN 978-3-86956-055-7 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb. de abrufbar. Universitätsverlag Potsdam 2010 Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam http://info.ub.uni-potsdam.de/verlag.htm Tel.: +49 (0)331 977 4623 | Fax: - 3474 E-Mail: [email protected] Redaktion: Rebekka Denz ([email protected]) Grayna Jurewicz ([email protected]) Daniel Jütte (Rezensionen, [email protected] ) Dr. Sigrid Senkbeil (Lektorat und Layout, [email protected]) Redaktionsadresse: Universität Potsdam, Institut für Jüdische Studien Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, http://v-j-s.org/ Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt. Redaktionsschluss: Heft 17 (2011): 15.01.2011 Es wird um Einsendung von Beiträgen gebeten. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge abzulehnen, in geteilter Form zu drucken oder nach Rückspra- che zu kürzen. Die veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der Autoren. Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Ge- samtredaktion wieder. Alle in PaRDeS veröffentlichten Artikel sind in „Rambi. In- dex of Articles on Jewish Studies“ nachgewiesen. Umschlagabbildung: Das Titelbild zeigt eine aktuelle Landkarte Osteuropas. Es wird Mathias Kruck für die Bereitstellung der digitalen Vorlage gedankt.