Masterarbeit / Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

155158452006.Pdf
Revista de Administração de Empresas ISSN: 0034-7590 ISSN: 2178-938X Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de S.Paulo BOAVENTURA, PATRICIA SILVA MONTEIRO; ABDALLA, CARLA CAIRES; ARAÚJO, CECILIA LOBO; ARAKELIAN, JOSÉ SARKIS VALUE CO-CREATION IN THE SPECIALTY COFFEE VALUE CHAIN: THE THIRD-WAVE COFFEE MOVEMENT Revista de Administração de Empresas, vol. 58, no. 3, 2018, May-June, pp. 254-266 Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de S.Paulo DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-759020180306 Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155158452006 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative RAE-Revista de Administração de Empresas (Journal of Business Management) FORUM Submitted 07.31.2017. Approved 12.26.2017 Evaluated through a double-blind review process. Guest Scientific Editors: Marina Heck, Jeffrey Pilcher, Krishnendu Ray, and Eliane Brito Original version DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020180306 VALUE CO-CREATION IN THE SPECIALTY COFFEE VALUE CHAIN: THE THIRD-WAVE COFFEE MOVEMENT Cocriação de valor na cadeia do café especial: O movimento da terceira onda do café Cocreación de valor en la cadena del café especial: El movimiento de la tercera ola del café ABSTRACT Brazil represents approximately 29% of the world’s coffee exports, with 15% of that being “specialty coffee.” Most Brazilian coffee exports are composed of commoditized green beans, influencing the value chain to be grounded on an exchange paradigm. -

TRADITIONAL RETAILERS by ALISON ROSENBLUM BA
SPECIALTY COFFEE EXPANSION IN TRADITIONAL RETAIL: LESSONS FROM NON- TRADITIONAL RETAILERS by ALISON ROSENBLUM B.A., Hamilton College, 1994 A THESIS Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree MASTER OF AGRIBUSINESS Department of Agricultural Economics College of Agriculture KANSAS STATE UNIVERSITY Manhattan, Kansas 2015 Approved by: Major Professor Dr. Vincent Amanor-Boadu ABSTRACT Despite at least three waves of transformations in the US coffee retail market, traditional retailers have not altered their merchandizing approaches for decades. This may be due primarily to the fact that there are still margins being made in selling canned coffee, the initial coffee wave in this research. Yet, because of their significant role in the retail segment, traditional retailers cannot be ignored by coffee suppliers. This implies that with each shift in the coffee industry, it is important for the participants to find ways of enabling the traditional retailer to make the necessary transformation – at least with their products – so that they can secure their market share and their continuing success. The research develops a number of case studies of different coffee retailers who are developing innovative processes for merchandizing new coffee formats, such as Keurig K- Cups and Ready to Drink (RTD) products. The research shows that coffee merchandizers can learn from these retailers to develop support programs for their traditional retail customers to leverage their importance in the coffee market to enhance their own sales and profitability. We identify a number of value innovation strategies that may be used to achieve this objective of enhancing performance in traditional coffee merchandizing. -

Effects of Transparency Marketing on Firms' Ability to Create and Capture
Effects of Transparency Marketing on Firms’ Ability to Create and Capture Value Sidarth Iyer An honors thesis submitted to the faculty of the Kenan-Flagler Business School at the University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill 2018 Approved by________________________ Approved by________________________ Approved by________________________ ABSTRACT Sidarth Iyer Effects of Transparency Marketing on Firms’ Ability to Create and Capture Value (Under the direction of Dr. Kristin Wilson) Transparency marketing is the act of including intentionally shared information in the value proposition of a good or service. Business research is incomplete in demonstrating how transparency marketing strengthens firms’ ability to create and capture value. Despite the success of companies like Patagonia and Everlane, transparency marketing is a relatively new phenomenon. Supported by previous academic literature, this research hypothesizes that when firms use transparency marketing strategically, they can indirectly create and capture additional value by influencing consumer cognitive processes. These cognitive mechanisms are trust perceptions of a firm and its products and psychological closeness between consumers and a firm. To validate this hypothesis, this research utilizes a mixed methodology including a quantitative consumer survey experiment and qualitative firm manager interviews. Thus, this research finds evidence from both the receiving and sending perspectives of transparency marketing of an indirect, mediated causal relationship between transparency marketing and willingness to buy. ii ACKNOWLEDGEMENTS This research would not have been possible without several key individuals. Thank you. Dr. Kristin Wilson – Thank you for your endless guidance, knowledge, and support. I am forever grateful for your belief in me throughout this project. Dr. Shimul Melwani – Thank you for engaging with my research and providing invaluable expertise during my first foray into the world of consumer behavior. -

View / Open Ott Oregon 0171A 12136.Pdf
SENSE WORK: INEQUALITY AND THE LABOR OF CONNOISSEURSHIP by BRIAN OTT A DISSERTATION Presented to the Department of Sociology and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy June 2018 DISSERTATION APPROVAL PAGE Student: Brian Ott Title: Sense Work: Inequality and the Labor of Connoisseurship This dissertation has been accepted and approved in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy degree in the Department of Sociology by: Eileen Otis Chairperson Jocelyn Hollander Core Member Jill Ann Harrison Core Member Stephen Wooten Institutional Representative and Sara D. Hodges Interim Vice Provost and Dean of the Graduate School Original approval signatures are on file with the University of Oregon Graduate School. Degree awarded June 2018 ii © 2018 Brian Ott This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (United States) License. iii DISSERTATION ABSTRACT Brian Ott Doctor of Philosophy Department of Sociology June 2018 Title: Sense Work: Inequality and the Labor of Connoisseurship This dissertation examines the intersections of the body, senses, and labor within a Post-Fordist, consumption based economy. Data was collected via ethnographic research of specialty coffee baristas. The concepts of “sense work,” “taste frameworks,” and “minimum wage connoisseurship” are introduced for identifying the social components of sensory experience. The specialty coffee industry serves as one examples of a larger “taste economy.” This research demonstrates how sensory experience can fall under management control and aid in the development of a new, niche “consumer market” (Otis 2011), characteristic of Post-Fordism. Additionally, an examination of the boundary work and identity formation within the specialty coffee industry provides new insights into how the body and the senses are implicated in the production and reproduction of class inequality. -
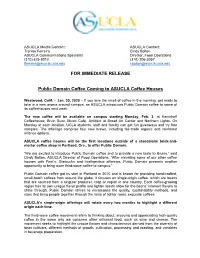
FOR IMMEDIATE RELEASE Public Domain Coffee Coming to ASUCLA
ASUCLA Media Contact: ASUCLA Contact: Trenise Ferreira Cindy Bolton ASUCLA Communications Specialist Director, Food Operations (310) 825-8012 (310) 206-3057 [email protected] [email protected] FOR IMMEDIATE RELEASE Public Domain Coffee Coming to ASUCLA Coffee Houses Westwood, Calif. – Jan. 30, 2020 – If you love the smell of coffee in the morning, get ready to take in a new aroma around campus, as ASUCLA introduces Public Domain coffee to some of its coffeehouses next week. The new coffee will be available on campus starting Monday, Feb. 3, at Kerckhoff Coffeehouse, Bruin Buzz, Music Café, Untitled, at Broad Art Center and Northern Lights. On Monday at each location, UCLA students, staff and faculty can get fun giveaways and try free samples. The offerings comprise four new brews, including fair-trade organic and rainforest alliance options. ASUCLA coffee houses will be the first locations outside of a standalone brick-and- mortar coffee shop in Portland, Ore., to offer Public Domain. “We are excited to introduce Public Domain coffee and to provide a new taste to Bruins,” said Cindy Bolton, ASUCLA Director of Food Operations. “After elevating some of our other coffee houses with Peet’s, Starbucks and Intelligentsia offerings, Public Domain presents another opportunity to bring more third-wave coffee to campus.” Public Domain coffee got its start in Portland in 2010 and is known for providing hand-crafted, small-batch coffees from around the globe. It focuses on single-origin coffee, which are beans that are sourced from a singular producer, crop or region in one country. Each coffee-growing region has its own unique flavor profile and lighter roasts allow for the beans’ inherent flavors to shine through. -

Black Gold Coffee – Ethics in the Coffee Industry the Impact of the Cash Crop on Countries of the South Vs
Kathrin Brunner Black Gold Coffee – Ethics in the Coffee Industry The Impact of the Cash Crop on Countries of the South vs. Increasing Ethical Awareness of Northern Roasters and Consumers in terms of CSR, Coffee Certification and Direct Trade Master’s Thesis To be awarded the degree of Master of Arts in Global Studies at the University of Graz, Austria Supervised by Univ.-Prof. Dr. Leopold Neuhold Department of Ethics and Social Studies Graz, May 2016 Master’s Thesis Brunner Author´s Declaration Unless otherwise indicated in the text or references, or acknowledged above, this thesis is entirely the product of my own scholarly work. Any inaccuracies of fact or faults in reasoning are my own and accordingly I take full responsibility. This thesis has not been submitted either in whole or part, for a degree at this or any other university or institution. This is to certify that the printed version is equivalent to the submitted electronic one. Date: Signature: I Master’s Thesis Brunner Acknowledgements I would like to express my sincere appreciation to all the people who supported me over the course of my studies and who contributed to the completion of this thesis. First, I would like to thank my thesis advisor Prof. Leopold Neuhold of the Department of Ethics and Social Studies at the University of Graz. The door to his office was always open whenever I had a question about my research or writing and I am very grateful for his input. In addition, assistance provided by Prof. Bernhard Ungericht and Prof. Peter Teibenbacher during the final steps of the Global Studies program, was highly appreciated. -

Barista Cool: Espresso Fashion Transformed
ZoneModa Journal. Vol.10 n.1S (2020) Essays S.I. Be Cool! Aesthetic Imperatives and Social Practices https://doi.org/10.6092/issn.2611-0563/10567 ISSN 2611-0563 Barista Cool: Espresso Fashion Transformed Wendy Pojmann* Published: May 20, 2020 Abstract In many parts of the world today, being a barista is cool. Young, bearded hipsters, tattooed artists, and pretty but disaffected teenage girls serve up their latte art specialties while dressed in attire wor- thy of fashion blogs. Some coffee brands prefer a distinctive uniform that reflects their marketing strategies while others recommend a look or allow for self-expression. Barista cool is a relatively new phenomenon, however. It appears to have been launched in youth-oriented cultures, such as in the United States and Australia and then re-crafted, like artisan coffee, in trend-setting countries, such as Japan, and re-imagined in countries with long-standing coffee cultures, such as Italy, the birthplace of espresso. Historic Italian espresso producers now encourage branding through uniforms that com- bine personal style and Italian fashion. New espresso bars in Italy moreover reflect the influences of third wave coffee and global fashion trends. This article seeks to analyze how and why espressoand cool fashion have only recently converged through the use of a variety of sources, such as archival re- search, interviews, and participant observation. Keywords: Espresso; Barista; Third Wave Coffee; Coffee Fashion; Made in Italy. Acknowledgements A special thanks to Matthew W. Woodworth who helped with research as part of an Italian Studies Independent Study at Siena College in Albany, New York, spring semester 2019. -

Direct and Tast ... Cialty Coffee Industry.Pdf
UNIVERSITY OF HELSINKI Department of Political and Economic Studies International Master’s program of Democracy and Global Transformation Direct and Tasty coffee: a Case Study of Specialty Coffee Industry in Helsinki. by Meng-Han,Chau Master’s Thesis May 2018 a Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Laitos/Institution– Department Faculty of Social Science. Department of Political and Economic Studies Tekijä/Författare – Author Meng-Han, Chau Työn nimi / Arbetets titel – Title Direct and Tasty coffee: a Case Study of Specialty Coffee Industry in Helsinki. Oppiaine /Läroämne – Subject Political Science Työn laji/Arbetets art – Level Aika/Datum – Month and year Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages Master’s thesis 05/2018 88 Tiivistelmä/Referat – Abstract According to the study done by International Coffee Organization, the years between 1964 to 2013, the volume of coffee consumption has grew on an average 1,9% per year and it grew from 57.9 million bags in 1964 to 142 million bags in 2012 (ICO, 2014). On the other hand, study has also shown the positive relationship between growth of GDP per capita and the growth of national consumption of coffee, in another words, with emerging economies like India, China and other South East Asian countries there will be more demand for coffee in the future (Grigg, 2002). However, the global demand and supply for coffee market has never been bigger but also way more stratified than ever. It is because of the parallel developments of specialty coffee market and ethical consumerism in coffee, the two most recent developments of coffee market used to operate in two different segments, the specialty coffee market is smaller in total volumes and puts more emphasis on taste and quality, for ethical consumerism like fair trade movement it focuses more on the commodity market and targeting multinational companies like Starbucks and Nestles. -

Identification of Consumer Decision Journey in Choosing Third Wave Coffee Shop in Bandung by Youth Market Segment
JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT Vol. 6 No.1, 2017: 88-100 IDENTIFICATION OF CONSUMER DECISION JOURNEY IN CHOOSING THIRD WAVE COFFEE SHOP IN BANDUNG BY YOUTH MARKET SEGMENT Fajar Eka Putranto and Herry Hudrasyah School of Business and Management Institut Teknologi Bandung, Indonesia [email protected] Abstract. Background: The growth of third wave coffee shop in Bandung increasing the competition among competitor. By understand what consumers prioritize in choosing third wave coffee shop can help the industry to be more sustainable. Methods: Qualitative approach like interview with professional worker, focus group discussion with key informants, and direct observation. Also this research use quantitative approach via questionnaire to find the flow of decision journey. This method was given to the Bandung’s third wave coffee consumer from 15- 24 years old. Results: The majority of consumers agree with the variables that are shown in pre-purchase and on purchase phase. Thus, there are exist gap which is knowledge gap. Conclusion:The consumer decision journey helps to map how the consumer path in terms of choosing a third wave coffee shop. Then, after the industry find and understand the path, it can pratically implement to their business. Keywords: consumer decision journey, service marketing, third wave coffee Introduction Coffee is one of commodity that growth successfully in Indonesia. Even thought that the coffee crop itself wasn’t a native crop from Indonesia, the role of Dutch occupation in 17th century gives big impact towards coffee plantation and development in Indonesia (Roosebooms, 2014). The coffee crop was successfully planted in Indonesia and The Dutch use coffee from Indonesia as their trading commodity that successful in Europe and make Indonesia coffee famous and well-known until now. -

Micro Mills, Specialty Coffee and Relationships
Micro mills, specialty coffee and relationships Following the supply chain from Costa Rica to Norway Benedicte Gyllensten Master thesis in Culture, Environment and Sustainability Centre for Development and Environment UNIVERSITY OF OSLO June 2017 II © Benedicte Gyllensten June 2017 Micro mills, specialty coffee and relationships. Following the supply chain from Costa Rica to Norway. http://www.duo.uio.no/ Print: Reprosentralen, University of Oslo III Abstract 2.25 billion cups of coffee are consumed every single day, and an increasing amount of this is specialty coffee. The third wave of coffee focuses on quality, taste and variety and consumers demand socially responsible coffee, but despite many initiatives to return more value to producers, most of the world’s coffee producers still struggle to make a living. The majority of the value of a cup of coffee is created and remains in consuming countries. This thesis looks at the phenomenon of micro mills in Costa Rica, which started as a reaction to the coffee crisis in the early 2000s. Since then, around 150 micro mills have popped up around the country, run by small-scale coffee producers. These are aimed at the specialty coffee industry, which demands high-quality coffee and transparency in the supply chain. This thesis is based on interviews and participant observation with coffee producers, exporters, importers, roasters and other members of the coffee industry. Data has been collected in Costa Rica and Norway by using qualitative research methods. Three different case studies that follow the supply chain of coffee all the way from Costa Rica to Norway are used to illustrate what effects micro mills have on the lives of coffee producers and what they mean to other actors in the industry. -
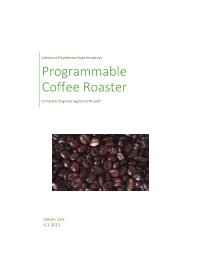
Programmable Coffee Roaster
California Polytechnic State University Programmable Coffee Roaster Computer Engineering Senior Project Steven Jack 6-1-2015 Table of Contents Introduction .......................................................................................................................................1 Background ....................................................................................................................................1 Roasting Process .............................................................................................................................1 Home Roasting ...............................................................................................................................1 Problem Statement .........................................................................................................................2 Project Overview ............................................................................................................................2 Mechanical ........................................................................................................................................2 Toaster Oven ..................................................................................................................................2 Drum..............................................................................................................................................3 Motor ............................................................................................................................................4 -

Baristas: the Artisan Precariat
http://researchcommons.waikato.ac.nz/ Research Commons at the University of Waikato Copyright Statement: The digital copy of this thesis is protected by the Copyright Act 1994 (New Zealand). The thesis may be consulted by you, provided you comply with the provisions of the Act and the following conditions of use: Any use you make of these documents or images must be for research or private study purposes only, and you may not make them available to any other person. Authors control the copyright of their thesis. You will recognise the author’s right to be identified as the author of the thesis, and due acknowledgement will be made to the author where appropriate. You will obtain the author’s permission before publishing any material from the thesis. Baristas: The Artisan Precariat A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Labour Studies at The University of Waikato by Gemma L Piercy 2018 i ABSTRACT My research on the work identit(ies) of baristas demonstrates that different workplaces, in conjunction with individual biographies, produce different kinds of work identities. Connected to these differences are the actual and perceived levels of skill and/or social status ascribed to workers within the service work triadic relationship (customers, co- workers/managers and workers). The higher the level of skill or social status, the greater the capacity of workers to experience more autonomy in their work and/or access improved working conditions. These findings are informed by my research approach, which incorporates three key methods: key informant interviews; observation/participant observation; life history interviews; all of which is underpinned by the mystory approach and autoethnography.