Appropriated Landscapes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
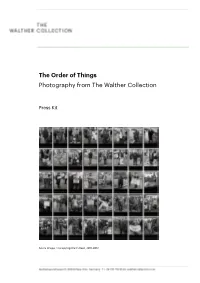
The Order of Things Photography from the Walther Collection
The Order of Things Photography from The Walther Collection Press Kit Accra Shepp, Occupying Wall Street, 2011-2012 The Order of Things Photography from The Walther Collection Dates May 17, 2015 – September 27, 2015 Press Conference Friday, May 15, at 2:30pm Curator Brian Wallis Photography by Dieter Appelt, Nobuyoshi Araki, Richard Avedon, Martina Bacigalupo, Bernd and Hilla Becher, Karl Blossfeldt, William Christenberry, Song Dong, Samuel Fosso, Zhang Huan, Zhuang Hui, Hiroh Kikai, Les Krims, Ma Liuming, Zanele Muholi, Duane Michals, Eadweard Muybridge, J.D. ‘Okhai Ojeikere, Thomas Ruff, Ed Ruscha, August Sander, Accra Shepp, Stephen Shore, Thomas Struth, Guy Tillim, Ai Weiwei, Huang Yan, Luo Yongjin, Kohei Yoshiyuki, and Unknown Photographers Opening Hours By appointment and guided tour. Contact: [email protected] Address The Walther Collection Reichenauerstrasse 21 89233 Neu-Ulm/Burlafingen Germany www.walthercollection.com Facebook: facebook.com/thewalthercollection Twitter: @walthercollect Media Contact The Walther Collection Daniela Baumann Tel.: +49 731 1769143 Email: [email protected] The Order of Things Photography from The Walther Collection The Walther Collection presents The Order of Things: Photography from The Walther Collection, a survey exhibition exploring how the organization of photographs into systematic sequences or typologies has affected modern visual culture. The Order of Things investigates the production and uses of serial portraiture, conceptual structures, vernacular imagery, and time-based performance in photography from the 1880s to the present, bringing together works by artists from Europe, Africa, Asia, and North America. The exhibition, curated by Brian Wallis, former Chief Curator at the International Center of Photography in New York, will be on view at The Walther Collection in Neu-Ulm, Germany, beginning May 17, 2015, and will be accompanied by a catalogue published by Steidl/The Walther Collection. -

Walther Collection Press Kit 010 06 07 A4
Events of the Self: Portraiture and Social Identity Press Kit Yto Barrada, Girl in Red, Tangier from „A Life full of Holes: „The Strait Project“, 1999, © Yto Barrada, courtesy the artist Seydou Keïta, Untitled, 1959, Gelatin silver print © Seydou Keïta, photo: Steven Bates, Courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, Geneva Content Facts The Collection About Artur Walther Location The First Year Program: Events of the Self: Portraiture and Social Identity Artists in Events of the Self: Portraiture and Social Identity Publication Willis E. Hartshorn and Artur Walther in Conversation Facts Title of the first exhibition Events of the Self: Portraiture and Social Identity Curator Okwui Enwezor Address The Walther Collection Reichenauerstrasse 21 89233 Neu-Ulm / Germany walthercollection.com Opening Hours Thurs. - Sun., by appointment only. Please contact [email protected] Contact The Walther Collection Maria Schindelegger Reichenauerstrasse 21 89233 Neu-Ulm / Germany Tel.: +49 -731 - 1769143 [email protected] Press Contact Markus Müller Bureau Mueller Alte Schönhauser Strasse 35 10119 Berlin Tel.: +49 - 30 - 20188432, Fax: +49 - 30 - 20188575 [email protected] The Collection The Walther Collection is an international art collection dedicated to collecting and exhibiting contemporary photography and video art across recent historical periods and geographic regions. Its mission is to collect and present, through in-depth, annual exhibitions and a vigorous publishing program, works of historical and contemporary significance from artists working in Africa, Asia, and other parts of the world, whose enduring contributions to photography significantly expand the understanding, conception, and history of the medium. In addition, The Walther Collection also carefully collects a segment of modern and contemporary European and American photography, uniting the various focuses of the collection in lively, rigorous curatorial dialogue through thematic and conceptual relationships. -

Walther Collection Distance and Desire-Media Kit 2013 4 9__Final
African Photography from The Walther Collection Distance and Desire: Encounters with the African Archive Press Kit Unidentified photographer, Portrait of King Khama III, South Africa, early twentieth century Distance and Desire: Encounters with the African Archive Dates June 9, 2013 – May 17, 2015 Curator Tamar Garb Historical Photographs by C. J. Aldham, Samuel Baylis Barnard, Barnett & Co, E. J. Bundy, Caney Brothers, B W. Caney, Crewes & Van Laun, Felix Coutinho, Coutinho Brothers, A. M. Duggan-Cronin, George T. Ferneyhough, A. C. Gomes & Sons, H. F. Gros, Gray Brothers, A. James Gribble, Kimberley Studio, Lawrence Brothers, T. Frederick Lewis, J. E. Middlebrook, William Moore, Henri Noyer, W. Rausch, John Salmon, M. Veniery, C. Vincenti, G. F. Williams, W. D. Young, and Unidentified Photographers Contemporary Photography and Video by Philip Kwame Apagya, Jodi Bieber, Sammy Baloji, Candice Breitz, Kudzanai Chiurai, Samuel Fosso, Attilio Gatti, David Goldblatt, Zwelethu Mthethwa, Zanele Muholi, Sabelo Mlangeni, Santu Mofokeng, Andrew Putter, Jo Ractliffe, Berni Searle, Guy Tilim, Carrie Mae Weems, and Sue Williamson Opening Hours Thursday–Sunday By appointment and guided tour only. Contact: [email protected] Address The Walther Collection Reichenauerstrasse 21 89233 Neu-Ulm/Burlafingen www.walthercollection.com Facebook: facebook.com/thewalthercollection Twitter: @walthercollect Contact Press Contact The Walther Collection Markus Müller/Bureau Mueller Maria Schindelegger Alte Schönhauser Straße 35 Tel.: +49 731 1769143 10119 Berlin [email protected] Tel.: +49 30 20188432 [email protected] Distance and Desire: Encounters with the African Archive The Walther Collection is pleased to present Distance and Desire: Encounters with the African Archive, the third exhibition devoted to African photography and video art. -

2/12/2016 Time and Again: Press Release
Pressrelease 1/3 Time and Again: Photography from The Walther Collection Fotografiska 12 February–15 May Collecting photography is a growing phenomenon these days, whether the motive For more images, please contact is self-expression or investment. Fotografiska is proud to present an exhibition Fotografiska’s PR/Marketing Manager drawn from one of the world’s leading collections of photography and video art, Margita Ingwall +46 (0)70 456 14 61 The Walther Collection. This exhibition, titled Time and Again: Photography For further information please contact from The Walther Collection, opens February 12 and comprises more than 800 Lili Assefa, lili@assefa +46(0)70 727 77 43 photographs from the last century to the present, including vibrant contemporary works made in Europe, Asia, Africa and the United States. Fotografiska is pleased to presentTime and Again: Photography from The Walther Collection, a comprehensive exhibition documenting photography’s exciting history and current status. The Walther Collection is one of the world’s largest private collections of photography and video art. Formed over the past twenty years by Artur Walther, a German-American businessman based in New York, the collection is housed in a museum open to the public in his hometown of Neu-Ulm in Germany. »For me photography is about incessantly searching and exploring. Photography provides the opportunity to discover and learn from each other; to create dialogue, regardless of ethnicity, gender, age, class or culture«, says Artur Walther. Walther has focused on collecting photography and video art since the 1990s. His collection takes as its starting point the German school, represented by, among others, August Sander, Karl Blossfeldt, Bernd and Hilla Becher and Thomas Ruff. -

Appropriated Landscapes
Contemporary African Photography from The Walther Collection Appropriated Landscapes Press Kit David Goldblatt, Structures: Speculative investment by a property developer in a house which he claimed was 'authentic Cape Dutch' but which was, in fact, a grossly corrupted version of that form, Agatha, Tzaneen district, 10 April 1989 © David Goldblatt. Courtesy The Goodman Gallery, Johannesburg Content Facts The Exhibition: Appropriated Landscapes Artists in the Exhibition Exhibition Publication Collection Location Project Space New York About Artur Walther The Walther Family Foundation Exhibition Program 2011–2013 Fact Sheet Title of the exhibition Appropriated Landscapes Artists Jane Alexander, Mitch Epstein, Ângela Ferreira, Peter Friedl, David Goldblatt, Christine Meisner, Sabelo Mlangeni, Santu Mofokeng, Zanele Muholi, Jo Ractliffe, Penny Siopis, Mikhael Subotzky/Patrick Waterhouse and Guy Tillim Curator Corinne Diserens Dates June 16, 2011 – May 13, 2012 Opening Hours Thurs. – Sun. 11 a.m. – 5 p.m. By appointment only. Please contact [email protected] Address The Walther Collection Reichenauerstrasse 21 89233 Neu-Ulm/Burlafingen walthercollection.com Contact The Walther Collection Maria Schindelegger Tel.: +49 -731 – 1769143 [email protected] Press Contact Markus Müller/Bureau Mueller Alte Schönhauser Straße 35 10119 Berlin Tel.: +49 - 30 - 20188432 [email protected] The exhibition: Appropriated Landscapes Appropriated Landscapes explores landscape typologies, mainly of Southern Africa, presenting works by fourteen artists: Jane Alexander, Ângela Ferreira, Peter Friedl, David Goldblatt, Christine Meisner, Sabelo Mlangeni, Santu Mofokeng, Zanele Muholi, Jo Ractliffe, Penny Siopis, Mikhael Subotzky/Patrick Waterhouse, Guy Tillim, and—with his North American landscapes—Mitch Epstein. The concept of landscape in Appropriated Landscapes is not exclusively linked to the historical perception of the picturesque and the sublime but considers landscape as a prism of experience, a reflection of ideology, and an embodiment of memory. -

TWC Structures of Identity Portfolio
Structures of Identity Photography from The Walther Collection Curated by Simon Njami In collaboration with FOTOMÉXICO 2017 Museo Amparo, Puebla, Mexico October 21, 2017 – February 5, 2018 Museo MARCO, Monterrey, Mexico February 23 – June 3, 2018 Structures of Identity Photography from The Walther Collection Structures of Identity examines how photographers, across a range of cultures and historical periods, have used their images to affirm or challenge social stereotypes, particularly those constructed around notions of race, gender, class, and nationality. Emphasizing the work of artists—and sitters—who use the medium to subvert visual expectations, and challenge markers of identification, Structures of Identity questions notions of a stable, authentic self. In particular, it focuses on how photographers have used serial imagery—related sequences of photographs, rather than individual images—to explore the political and cultural factors that shape individual and collective subjectivities. This exhibition includes series and sequences made by artists from Europe, the United States, Asia, and several countries in Africa, as well as earlier documentary and vernacular photography. In many cases, these investigations have focused on portraiture, with particularly evocative self- representations used to question the social construction of identity. Other photographers have examined landscapes, the built environment and public space, exposing the social and physical underpinnings that inform both collective and individual identities. All of these efforts reflect the ways in which visual forms and archival structures construct and reinforce social attitudes. Structures of Identity highlights the different ways that subjectivity and social identity are shaped and regarded within the history of the photographic medium, and illustrates the constant efforts of The Walther Collection to discuss and consider the history of photography beyond conventional cultural, geographic, and temporal boundaries. -
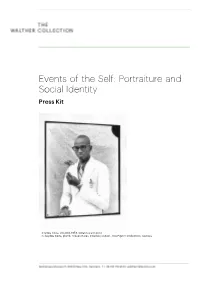
6/17/2010 Events of the Self: Press Release Read
Events of the Self: Portraiture and Social Identity Press Kit Yto Barrada, Girl in Red, Tangier from „A Life full of Holes: „The Strait Project“, 1999, © Yto Barrada, courtesy the artist Seydou Keïta, Untitled, 1959, Gelatin silver print © Seydou Keïta, photo: Steven Bates, Courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, Geneva Content Facts The Collection About Artur Walther Location The First Year Program: Events of the Self: Portraiture and Social Identity Artists in Events of the Self: Portraiture and Social Identity Publication Willis E. Hartshorn and Artur Walther in Conversation Facts Title of the first exhibition Events of the Self: Portraiture and Social Identity Curator Okwui Enwezor Open to the Public from Thursday, June 17th, 2010 Address The Walther Collection Reichenauerstrasse 21 89233 Neu-Ulm / Germany walthercollection.com Contact The Walther Collection Maria Schindelegger Reichenauerstrasse 21 89233 Neu-Ulm / Germany Tel.: +49 -731 - 1769143 [email protected] Press Contact Markus Müller Bureau Mueller Alte Schönhauser Strasse 35 10119 Berlin Tel.: +49 - 30 - 20188432, Fax: +49 - 30 - 20188575 [email protected] Opening Hours Thurs. - Sun. 11 a.m. - 5 p.m., by appointment only. Please contact [email protected] The Collection The Walther Collection is an international art collection dedicated to collecting and exhibiting contemporary photography and video art across recent historical periods and geographic regions. Its mission is to collect and present, through in-depth, annual exhibitions and a vigorous publishing program, works of historical and contemporary significance from artists working in Africa, Asia, and other parts of the world, whose enduring contributions to photography significantly expand the understanding, conception, and history of the medium.