Getrenntes Zusammenbringen. Blicke Auf Das Alte Testament
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
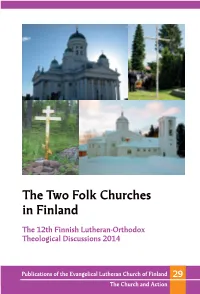
The Two Folk Churches in Finland
The Two Folk Churches in Finland The 12th Finnish Lutheran-Orthodox Theological Discussions 2014 Publications of the Evangelical Lutheran Church of Finland 29 The Church and Action The Two Folk Churches in Finland The 12th Finnish Lutheran-Orthodox Theological Discussions 2014 Publications of the Evangelical Lutheran Church of Finland 29 The Church and Action National Church Council Department for International Relations Helsinki 2015 The Two Folk Churches in Finland The 12th Finnish Lutheran-Orthodox Theological Discussions 2014 © National Church Council Department for International Relations Publications of the Evangelical Lutheran Church of Finland 29 The Church and Action Documents exchanged between the churches (consultations and reports) Tasknumber: 2015-00362 Editor: Tomi Karttunen Translator: Rupert Moreton Book design: Unigrafia/ Hanna Sario Layout: Emma Martikainen Photos: Kirkon kuvapankki/Arto Takala, Heikki Jääskeläinen, Emma Martikainen ISBN 978-951-789-506-4 (paperback) ISBN 978-951-789-507-1 (PDF) ISSN 2341-9393 (Print) ISSN 2341-9407 (Online) Unigrafia Helsinki 2015 CONTENTS Foreword ..................................................................................................... 5 THE TWELFTH THEOLOGICAL DISCUSSIONS BETWEEN THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF FINLAND AND THE ORTHODOX CHURCH OF FINLAND, 2014 Communiqué. ............................................................................................. 9 A Theological and Practical Overview of the Folk Church, opening speech Bishop Arseni ............................................................................................ -

CH 710 Pietism in the Christian Tradition J
Asbury Theological Seminary ePLACE: preserving, learning, and creative exchange Syllabi eCommons 1-1-2005 CH 710 Pietism in the Christian Tradition J. Steven O'Malley Follow this and additional works at: http://place.asburyseminary.edu/syllabi Recommended Citation O'Malley, J. Steven, "CH 710 Pietism in the Christian Tradition" (2005). Syllabi. Book 1376. http://place.asburyseminary.edu/syllabi/1376 This Document is brought to you for free and open access by the eCommons at ePLACE: preserving, learning, and creative exchange. It has been accepted for inclusion in Syllabi by an authorized administrator of ePLACE: preserving, learning, and creative exchange. For more information, please contact [email protected]. CH 710XL Pietism in the Christian Tradition J. Steven O’Malley, Instructor Asbury Theological Seminary Fall Semester, 2005 Email address: steven_o’[email protected] Office Phone: (859)858-2260 Online Office Hours: Monday and Friday, 12-2 pm Welcome I am delighted to be joining with you in this new learning venture. It is our privilege here to join together in exploring and sharing in the odyssey of a remarkable company of women and men, whose common heritage is in bearing witness to the living Christ as the ground for personal salvation and social and historical transformation. It is to acknowledge that we are not alone in ministry; rather, it is to discover vital resources from the past that can empower and gide us who seek to become pertakes in that vital company of the committed. In the annals of church history, the Pietist movement stands out as a peak period of light and renewal. -

The Rhetoric of Self-Denial in the Mystical Theologies of Anna Maria Van Schurman and Madame Jeanne Guyon Franciscanum
Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu ISSN: 0120-1468 [email protected] Universidad de San Buenaventura Colombia Lee, Bo Karen Sacrifice and Desire: The Rhetoric of Self-Denial in the Mystical Theologies of Anna Maria van Schurman and Madame Jeanne Guyon Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu, vol. LI, núm. 151, enero-junio, 2009, pp. 207-239 Universidad de San Buenaventura Bogotá, Colombia Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343529805009 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 207 Sacrifice and Desire: The Rhetoric of Self-Denial in the Mystical Theologies of Anna Maria van Schurman and Madame Jeanne Guyon Bo Karen Lee* Resumen Anna Maria van Schurman (1607-1678), calvinista holandesa, y Madame Jeanne Guyon (1648-1717), católica francesa, desafiaron la organización religiosa en la Europa del siglo XVII y transgredieron las fronteras institucionales en medio del conflicto religioso. ¿Qué tenían en común estas dos mujeres, a pesar de la controversia teoló- gica entre católicos y calvinistas? Tanto van Schurman como Madame Guyon argumentaban que “el fin último de la humanidad” es “gozar a Dios”, y su preocupación principal era cómo lograr la unión con el objeto de deseo y disfrutar ese summum bonum. Asimismo, las dos consideraban que la unión con Dios es posible, en esta vida, negán- dose a sí mismo/a o autodestrucción y las dos encontraban placer en esta autonegación, integrando una a teología del sacrificio con una teología del deseo y del placer. -

Anna Maria Van Schurman and Antoinette Bourignon As Contrasting Examples
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Groningen Digital Archive Gender, genre and authority in seventeenth-century religious writing: Anna Maria van Schurman and Antoinette Bourignon as contrasting examples Mirjam de Baar (University of Groningen) Publishing entails publicity or at least an intervention in the public sphere. Wo- men in the early modern period, however, were not allowed to speak in public. In accordance with the admonitions of the apostle Paul (I Cor. 14:34 and I Tim. 2:11-12) they were meant to observe silence. A woman who wanted to publish her thoughts was suspected of being willing to make her body available as well. This injunction to female silence was so strong that the majority of women who did publish felt the need to justify their audacity. In addition to these cultural admonitions advocating female silence, Merry Wiesner, author of Women and Gender in Early Modern Europe , mentions two other barriers that prevented women in early modern Europe from publishing: their relative lack of educational opportunities and economic factors. 1 These barriers might explain why women throughout the early modern period repre- sented only a tiny share of the total amount of printed material, though their share did increase during this period. Patricia Crawford has shown that in England between 1600 and 1640 publications by women accounted for only 0.5 percent of the total, increasing in the next six decades to 1.2 percent. 2 The majority of early modern women’s published works were religious, particularly in the sixteenth and seventeenth centuries when the vast majority of all publications were religious. -

Calvin and World Mission
edition afem mission classics 6 edition afem • mission classics 6 At the end of the ‘Calvin-Year’, in which Christians all over the world celebrate Calvin’s 500th birthday, this books emphasizes Calvin’s role for establishing a Protestant mission theology which later led to a worldwide expansion of Protestant Christianity. The book Thomas Schirrmacher (Ed.) presents major articles on the topic through 125 years of history and from different viewpoints from 1882 to 2002. Some of the articles discuss Calvin and his writings and thinking on mission alone. Some add the question, what kind of mission has been organized from Geneva during Calvins time, because Calvin did not only speak about evangelism and mission, but also helped establish it in reality, even though on a quite small scale compared to later centuries. CalvinCalvin and and Some articles go further, and follow the students and followers of Calvin and their relation to mission through history. Thus sometimes the wider topic of ‘Calvinism and Mission’is included. This book has not been edited to defend ‘Calvinism’ and its dogmatic system. This has WorldWorld Mission Mission even from Calvinism’s own firm position to be done on exegetical grounds. Nevertheless some of the authors wrote their articles as a defence of Calvinism or at least as very convinced Calvinists. Others write more from a neutral point of view as historical researchers. Schirrmacher (Ed.) • Calvin and W THOMAS SCHIRRMACHER (*1960) earned doctorates in Theology (Dr. Theol., 1985, Netherlands), in Cultural Anthropology (PhD, 1989, USA), in Ethics (ThD, 1996, USA), and in Sociology of Religions (Dr. -

Phillip Jacob Spener's Contribution to Protestant Ecclesiology
Phillip Jacob Spener's Contribution to Protestant Ecclesiology Author: Dennis McCallum Introduction In 1666 a young pastor was called to become the head Lutheran pastor in Frankfurt am Main. He was well educated, holding the Doctor of Theology from the University of Strassbourg, and he had some strong notions that would soon galvanize Europe into another surge of reforming zeal-- eventually reaching millions in every corner of the globe. The pastor's name was Philip Jacob Spener. Nine years into his first pastorate, Spener would set forth his call for reform in the Lutheran church in a forward to a collection of sermons by Johannes Arndt. The title of the introduction was Pia Desideria, (Pious Desires) and within weeks this remarkable little tractate set off an astounding reaction throughout most of Europe.1 Modern members of primitive New Testament-style churches will quickly recognize several important themes in this tract, which have stirred strong sentiments today, as they have throughout church history. These ideas include the need for small meetings in the local church that will allow the re-introduction of the inter-active style of koinonia described in I Cor. 14, the need for the laity to learn the Bible and use it, the necessity of congregational review of the public teacher's positions, a vigorous critique of the institutional church and others. It is the purpose of this paper to identify the key themes of Spener's theology, focusing in the area of ecclesiology. Then, a further attempt will be made to understand the connection between Spener's ecclesiological position and those streams that gave rise to it, as well as those that flowed out from it. -

Titelgegevens / Bibliographic Description
Titelgegevens / Bibliographic Description Titel From pure church to pious culture. The further Reformation in the sevemteenth-century Dutch Republic / Fred A. van Lieburg. Auteur(s) Lieburg, F.A. van In Later calvinism. International perspectives / red.: W. Fred Graham. (Kirksville, Sixteenth Century Journal Publisher, 1994), p. 409-429. (Sixteenth century essays & studies; 22). Copyright 2006 / F.A. van Lieburg | Sixteenth Century Journal Publisher | Claves pietatis. Producent Claves pietatis / 2007.08.30; versie 1.0 Bron / Source Onderzoeksarchief / Research Archive Nadere Reformatie Website Sleutel tot de Nadere Reformatie Nummer B98013607 De digitale tekst is vrij beschikbaar voor The digital text is free for personal use, persoonlijk gebruik, voor onderzoek en for research and education. Each user onderwijs. Respecteer de rechten van de has to respect the rights of the copyright rechthebbenden. Commercieel gebruik holders. Commercial use is prohibited. is niet toegestaan. Het 'Onderzoeksarchief Nadere The 'Research Archive Nadere Reformatie' bevat digitale documenten Reformatie' contains digital documents over het gereformeerd Piëtisme en de about reformed Pietism and the Nadere Nadere Reformatie in Nederland tot Reformatie in the Netherlands until 1800. Het is doorzoekbaar met de 1800. These can be retrieved by 'Bibliografie van het gereformeerd searching the 'Bibliography of the Piëtisme in Nederland (BPN)' op de reformed Pietism in the Netherlands website 'Sleutel tot de Nadere (BPN)' database at the 'Sleutel tot de Reformatie'. Nadere Reformatie' website. 408 Later Calvinism The Netherlands 1550 Chapter 20 From Pure Church to Pious Culture: The Further Reformation in the Seventeenth-Century Dutch Republic Fred A. van Lieburg The Further Reformation was a pietistic movement within the Dutch Reformed Church during the seventeenth century. -
Anna Maria Van Schurman (1607–1678). a Learned Maid and Her Quest for Authentic Spirituality1
STUDIA PODLASKIE tom XXVIII BIAŁYSTOK 2020 MARGRIET GOSKER ORCID: 0000–0002–2104–6804 ANNA MARIA VAN SCHURMAN (1607–1678). A LEARNED MAID AND HER QUEST FOR AUTHENTIC SPIRITUALITY1 DOI: 10.15290/sp.2020.28.01 Abstract. I investigate Van Schurman’s spiritual and scientific life by studying her biography. What is the balance between both? Her Christian faith tried to understand intellectually the essence of Christian truth. Contemporaries complained that she was quite a different person after her decision to join the Labadist movement. In her Εὐκληρία she does indeed speak of her ‘change’. She renounced the importance of her former scientific activities and stressed the need for a pious life in Christ. But was it really such a radical break? This article will show a lot of continuity both in her life and in her work. Key words: Anna Maria Van Schurman, spirituality, scientific life, biography Abstrakt. Artykuł opisuje życie duchowe i działalność naukową Anny Marii van Schurman poprzez pryzmat jej biografii. W jaki sposób uczona godziła ze sobą religię i naukę? Es- encję prawdy chrześcijańskiej pragnęła poznać poprzez połączenie myśli naukowej i wiary. Ówcześnie komentowano, że po wstąpieniu do sekty Labadystów, jej osobowość uległa drasty- cznej przemianie. W Εὐκληρία, uczona rzeczywiście opisuje osobistą „przemianę”. Po tym wydarzeniu uznała swą dotychczasową działalność naukową za nieważną, podkreślając konieczność cnotliwego życia w Chrystusie. Czy jednak ta zmiana rzeczywiście była prawdzi- wie fundamentalna? Autorka artykułu podkreśla trwałe elementy w życiu i dorobku uczonej. Słowa kluczowe: Anna Maria van Schurman, duchowość, życie naukowe, biografia Introduction Anna Maria van Schurman is one of the most interesting figures in Dutch history 2. -
This “Rends in Pieces All the Barriers Between Virtue and Vice”: Tennentists, Moravians, and the Antinomian Threat in the Delaware Valley
This “rends in Pieces all the Barriers between Virtue and Vice”: Tennentists, Moravians, and the Antinomian Threat in the Delaware Valley N THE SUMMER OF 1745, Gilbert Tennent, one of the middle colonies’ leading revivalist preachers, was preparing a sermon in his IPhiladelphia study during a fierce thunderstorm, when a bolt of light- ning struck the house and sent a surge of electricity through his body, blowing out the soles of his shoes and melting the buckles.1 Although Tennent would later explain this frightening experience as a random act I would like to thank the Pietism Studies Group, which meets each year in conjunction with the American Historical Association, for inviting me to present a paper on this material for the 2008 annual meeting in Washington, DC. This article is a revised version of that presentation delivered as “Anglo-Moravians and Tennentist Propaganda: The Nature of Moravian–New Light Relations in the Delaware Valley, 1741–1748.” I am also indebted to Paul Peucker and Lanie Graf for their assistance at the Moravian Archives in Bethlehem, Lisa Jacobson at the Presbyterian Historical Society in Philadelphia, as well as several people who have reviewed and offered comments on this piece. Among them are Craig Atwood, Ned Landsman, and Mark Norris. This article is much improved because of comments I received from these individuals and those of an anonymous reviewer. I am, however, solely responsible for those deficiencies that remain. 1 Gilbert Tennent (1703–1764) was arguably the most significant revivalist in the mid-Atlantic colonies. He was instrumental in creating a temporary split with “Old Side” Presbyterians in 1741 and best known for his controversial 1739 sermon, “The Danger of an Unconverted Ministry.” THE PENNSYLVANIA MAGAZINE OF HISTORY AND BIOGRAPHY Vol. -
Vetenskap Och Upplysning Inom Den Tidiga Pietismen: Några Ledmotiv Till Adeptskapets Historia
Inlaga 2007-03-30 09.25 Page 110 Vetenskap och upplysning inom den tidiga pietismen: Tomas några ledmotiv till Mansikka adeptskapets historia Åren närmast efter decennieskiftet 1780 cirkulerade i Stockholm rykten om att staden hölls under kontroll av mystiska adepter. I ett brev daterat den 4 maj 1781 skrev den bekante swedenborgaren och hovalkemisten August Nordenskjöld (1754–1792) till sin bror i Finland att han har fått spår här på värkel. Adepter, som länge hafva uppehållit sig här i Sverige; men jag har ej ännu kom- mit i connexion med dem och jag vet ej el. om Herren tillåter det; ty de ställa allt under strängaste tysthet med de aldrastarkaste eder och då blefve aldrig denna saken af mig upptäckt, som likväl torde vara i Herrens ordning. Orsaken till Nordenskjölds aningar står närmast att hämta i en annons inflikad i dag- bladen från den 7 mars i vilken ett mystiskt sällskap vid namn Metatron offentligt hade kungjort om sin existens. Annonsen hade av allt att döma väckt en inte så liten upp- ståndelse och ryktesspridning i staden, som under denna tid var ett betydande centrum för mysticism och hemliga ordenssammanslutningar. Sällskapet Metatron var på många sätt tidstypiskt i detta klimat och hade kabba- la, alkemi och rosenkreutzianism som främsta komponenter. Enligt annonsen skulle sällskapet ha existerat i Sverige och verkat i det dolda i drygt 40 år. Efter att stiftaren, som var svensk, avlidit år 1740 hade till ledare utnämnts en »berömd prästman» som verkat fram till sin död 1759. Såsom Jan Häll har visat, kan man med stor säkerhet identifiera denne prästman med den kände och älskade pietisten Eric Tolstadius (1693–1759). -

CH 710 Pietism in the Christian Tradition J
Asbury Theological Seminary ePLACE: preserving, learning, and creative exchange Syllabi eCommons 1-1-2003 CH 710 Pietism in the Christian Tradition J. Steven O'Malley Follow this and additional works at: http://place.asburyseminary.edu/syllabi Recommended Citation O'Malley, J. Steven, "CH 710 Pietism in the Christian Tradition" (2003). Syllabi. Book 2359. http://place.asburyseminary.edu/syllabi/2359 This Document is brought to you for free and open access by the eCommons at ePLACE: preserving, learning, and creative exchange. It has been accepted for inclusion in Syllabi by an authorized administrator of ePLACE: preserving, learning, and creative exchange. For more information, please contact [email protected]. CH 710XL Pietism in the Christian Tradition Course Theme: Continental Pietism and German-American Religious Traditions J. Steven O’Malley, Instructor Asbury Theological Seminary Fall Semester, 2003 Email address: steven_o’[email protected] Office Phone: (859)858-2260 Online Office Hours: Monday and Friday, 12-2 pm Welcome I am delighted to be joining with you in this new learning venture. It is our privilege here to join together in exploring and sharing in the odyssey of a remarkable company of women and men, whose common heritage is in bearing witness to the living Christ as the ground for personal salvation and social and historical transformation. It is to acknowledge that we are not alone in ministry; rather, it is to discover vital resources from the past that can empower and guide us who seek to become partakes in that vital company of the committed. In the annals of church history, the Pietist movement stands out as a peak period of light and renewal. -
Die Kirche in Der Pietistischen Geschichtsschreibung
The Church according to pietist historiography Die Kirche in der pietistischen Geschichtsschreibung Anne Lagny Ecole Normale Supérieure de Lyon Fecha recepción 21.11.2013 I Fecha aceptación 6.10.2014 Zusammenfassung Abstract In diesem Beitrag wird das Bild der Kirche in der pie- This contribution analyses how Church is de- tistischen Geschichtsschreibung dargelegt. 1675 verö- picted through the Pietistic historiography. Pu- ffentlicht Philipp Jacob Spener seine Pia Desideria, die blished in 1675 Pastor Philipp Jacob Spener’s Pia als Manifest des lutherischen Pietismus gelten. Ausge- Desideria is a proclamation to Lutheran pietism. hend von der festgestellten Verdorbenheit der Kirche Observing the corruption of the current Church, seiner Zeit, schlägt er die Reform der Institution vor: he proposes a reform of this institution: parishio- die Gläubigen sollen sich auf die praxis pietatis konzen- ners should focus on practicing faith just like the trieren nach dem Vorbild der Christen der ursprün- original Christians did; the Church, on the other glichen Kirche; was die Kirche angeht, so soll sie den hand, if banishing the sterile controversy of reli- unfruchtbaren Geist der Kontroverse und der religiö- gious disagreement could bring back the utopia sen Streitigkeiten bannen und wird somit das Ideal der of Holy piety. The history of the Church and the evangelischen Frömmigkeit wieder herstellen. Gott- heresies of Gottfried Arnold (Unpartheyische Kir- fried Arnolds Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhis- chen- und Ketzerhistorie) published in 1699-1700 torie (1699-1700) ist die Umsetzung dieses Reformpro- is a transposition of this religious program. By gramms in der Geschichtsschreibung. Indem auf die focusing on the presence of the Church hidden Gegenwart der unsichtbaren wahren Kirche fokussiert » amongst the populations, the Church will go back » Revista de Historiografía 21, 2014, pp.