Das Daybook Der Documenta 14
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

When Crisis Becomes Form: Athens As a Paradigm Theophilos Tramboulis and Yorgos Tzirtzilakis
When Crisis Becomes Form: Athens as a Paradigm Theophilos Tramboulis and Yorgos Tzirtzilakis Documenta 14 in Athens: a glossary Documenta 14 (d14) was an undoubtedly important exhibition which triggered endless debate and controversy that continues today.1 The choice of Athens as a topological paradigm by Adam Szymczyk, an ingenious curator with expected and unexpected virtues, initially fired people’s appetite and enthusiasm. Yet what it ultimately managed to do was demythicize the event itself in a way, as well as demonstrate a series of dangers in the operation of the institution. At the same time it brought to light a series of innate ailments and fantasies of contemporary culture in Greece, which manifested themselves in a distorted and sometimes aggressive fashion. This is not without significance, since it functioned complementarily to—rather than independently of—the exhibition. In short, d14 served as a kind of double mirror with which we could see the cultural relation of Greece with Europe and the world, but also the reverse: that of Europe with Greece. So what was d14 in Athens? For now we must necessarily sidestep its contribution to making Athens and Greek culture a temporary center of international attention in order to focus on what must not be overlooked. The series of arguments below can be read individually or successively as a network of alternating commentary, but also through their diagonal intersections, ruptures, disagreements, and connections, where meaning is produced in a syncretic or dialectical way. D14 is the symptom from which all discourse around it begins. 1/11 A political metonymy The critical reception of d14 in Greece focused mainly on the institution and its operation; on its discursive and political context rather than the works, concerts, or lectures— generally speaking, the actual art and discourse presented by the exhibition. -

News Documenta 14, a German Art Show's Greek
ART & DESIGN | ART REVIEW Documenta 14, a German Art Show’s Greek Revival By JASON FARAGO | April 9, 2017 A piece by the Mexican artist Guillermo Galindo at Documenta 14 in Athens. CREDIT Eirini Vourloumis for The New York Times ATHENS — Even today, in a supersaturated calendar of worldwide art events, no show matters more than Documenta, a colossal German exhibition of contemporary art, reinvented every five or so years as a “museum of 100 days.” Of 13 editions so far, two have become touchstones in recent art history: the freewheeling fifth edition, curated by the Swiss Harald Szeemann in 1972, which equalized painting and sculpture with conceptual art and happenings; and the erudite 11 th edition, organized by the Nigerian Okwui Enwezor in 2002, which propounded a global art ecosystem with Europe no longer at the center. But every Documenta, since the first in 1955, has served as a 10 HAWTHORNE STREET SAN FRANCISCO CA 94105 TEL 415 781 4629 INFO @BERGGRUEN.COM BERGGRUEN.COM manifesto about art’s current relevance and direction, and every one has taken place in Kassel, an unlovely town north of Frankfurt destroyed by Allied bombs in World War II. Naeem Mohaiemen’s “Tripoli Cancelled” installation. CREDIT Mathias Völzke Until this year. The 14th edition of Documenta, led by the 46- year-old Polish curator Adam Szymczyk, is being shared by Kassel and Athens, a city with intertwined crises of finance and migration, and the capital of a country whose recent relations with Germany have been anything but collaborative. Mr. Szymczyk and the bulk of his curatorial team have been living in Greece for years, and the Athenian half of this two-city show opened on Saturday, in the presence of the presidents of both countries. -

Fit to Print May 1 – June 30, 2021
FOR IMMEDIATE RELEASE April 20, 2021 CONTACT: Mikaela Hawk, [email protected] Fit to Print May 1 – June 30, 2021 PHILADELPHIA, PA – (April 20, 2021) The Print Center is pleased to present Fit to Print, an online exhibition which explores the use of newspapers in art from the post-war era to the present day. It addresses how artists work with the medium of newsprint as a nexus where the studio, everyday life and current events perennially merge and collide. This exploration is particularly timely in an age when truth in news is fractured and suspect, due to the proliferation of sensationalist stories pitted against traditional sources of journalism. Fit to Print features Lisa Blas, Jennifer Bolande, Chryssa, Laura Fields, Jef Geys, Beatriz González, Helena Hernmarck, Rita Maas, Dan Perjovschi, Donna Ruff, Soledad Salamé and Paul Thek. The works of these twelve modern and contemporary artists reveal slippages between everyday life and what is depicted and recounted on the printed, published page. In this exhibition, they present visual spaces of rupture as sites for re-inscription, socio-political critique and material transformation. In each artwork, image and language oscillate, stretching notions of time and triggering memories. The urgency and implications of our engagement with the news is highlighted, asking viewers, “What do you read, what do you retain, what do you share?” Lisa Blas, First(s), Monday’s image, v. 2, Fit to Print is inspired by the legacy of artists who have harnessed the 2021, dye sublimation print, 40” x 32”. Courtesy of the Artist potency of newspaper’s form and surface. -

Beyond Nationalism? Blank Spaces at the Documenta 1955 – the Legacy of an Exhibition Between Old Europe and New World Order
Artl@s Bulletin Volume 9 Issue 1 “Other Modernities”: Art, Visual Culture Article 3 and Patrimony Outside the West 2020 Beyond Nationalism? Blank Spaces at the documenta 1955 – The Legacy of an Exhibition Between Old Europe and New World Order Mirl Redmann University of Geneva, [email protected] Follow this and additional works at: https://docs.lib.purdue.edu/artlas Part of the African History Commons, Holocaust and Genocide Studies Commons, Islamic World and Near East History Commons, Modern Art and Architecture Commons, Other German Language and Literature Commons, Other Italian Language and Literature Commons, and the Women's Studies Commons Recommended Citation Redmann, Mirl. "Beyond Nationalism? Blank Spaces at the documenta 1955 – The Legacy of an Exhibition Between Old Europe and New World Order." Artl@s Bulletin 9, no. 1 (2020): Article 3. This document has been made available through Purdue e-Pubs, a service of the Purdue University Libraries. Please contact [email protected] for additional information. This is an Open Access journal. This means that it uses a funding model that does not charge readers or their institutions for access. Readers may freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles. This journal is covered under the CC BY-NC-ND license. “Other Modernities” Beyond Nationalism? Blank Spaces at the documenta 1955 – The Legacy of an Exhibition Between Old Europe and New World Order Mirl Redmann* Université de Genève Abstract Was the first documenta really beyond nationalism? documenta 1955 has been widely regarded as conciliation for the fascist legacy of the exhibition “Degenerate Art” (1937), and as an attempt to reintegrate Germany into the international arts community. -

Is Documenta a Decolonising Force?
Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences Review Article Open Access Is documenta a decolonising force? Abstract Volume 3 Issue 3 - 2018 As one of the most important contemporary art mega-projects in the world, the Erzsébet Tatai Documenta of Kassel is particularly suitable for examining the changes that have Art historian, Senior Research Fellow, Hungarian Academy of taken place in art and in the way it is presented in the artistic field. Back in 1955, Sciences, Hungary political motivations played a part in the Documenta’s founding, but it was only in 1992, during its ninth edition edition, that Jan Hoet first criticised the hegemony of Correspondence: Erzsébet Tatai, Art historian, Senior European and North American art (at the time, only 7% of the featured artists were Research Fellow, Hungarian Academy of Sciences, Hungary, from Africa, Asia and Oceania). And it was not until 1997 that, under the artistic Email [email protected] directorship of Catherine David, this criticism were treated theoretically in the form of lectures. The first Documenta that can be regarded as postcolonial was held in 2002, Received: February 26, 2018 | Published: May 16, 2018 with Enwezor taking charge as artistic director. In my paper, I will examine the shifts that have occurred in the way global art is represented in Kassel from Documenta 11, when the postcolonial discourse finally came to the fore, until the present day (Documenta 14). The questions I touch upon are whether there has been a strengthening of postcolonial representation; whether there is evidence of cultural decolonisation as cultural colonisation is dismantled that is, as postcolonial theories are put into practice; whether or not a decolonisation of art has taken place during the Documenta exhibitions; and whether there has been a change in the postcolonialist content of art. -

STEPHEN ANTONAKOS Laconia, Greece 1926 — New York 2013
STEPHEN ANTONAKOS Laconia, Greece 1926 — New York 2013 Antonakos’s work with neon since 1960 has lent the medium new perceptual and formal meanings in hundreds of gallery and museum exhibitions first in New York and then internationally. His use of spare, complete and incomplete geometric neon forms has ranged from direct 3-D indoor installations to painted Canvases, Walls, the well known back- lit Panels with painted or gold surfaces, his Rooms and Chapels. Starting in the 1970s he installed over 55 architecturally-scaled permanent Public Works in the USA, Europe, Israel, and Japan. Throughout, he conceived work in relation to its site — its scale, proportions, and character — and to the space that it shares with the viewer. He called his art, “real things in real spaces,” intending it to be seen without reference to anything outside the immediate visual and kinetic experience. Colored pencil drawings on paper and vellum, often in series, have been a major, rich practice since the 1950s; as has his extensive work with collage. Other major practices include the conceptual Packages, small-edition Artist’s Books, silver and white Reliefs, prints, and — since 2011 — several series of framed and 3-D Gold Works. Antonakos was born in the small Greek village of Agios Nikolaos in 1926 and moved to New York with his family in 1930. In the late 1940s, after returning from the US Army, he established his first studio in New York’s fur district. From the early 1960s forward, until the end in 2013, he worked in studios in Soho. EXHIBITIONS 2018 to 2019 “Antonakos: The Room Chapel” Curated by Elaine Mehelakes — Allentown Art Museum, Allentown, PA, May 6, 2018 - May 5, 2019 2018 “Antonakos: Proscenium” Curated by Helaine Posner — Neuberger Museum of Art, SUNY Purchase, NY, Jan. -

Statement from the Artistic Director and Team of Documenta 14
Statement from the Artistic Director and Team of documenta 14 We read with astonishment the articles that were published on September 12 in the HNA newspaper in Kassel. Presenting their opinions as objective facts, reiterating speculations and half-truths, the authors portrayed Adam Szymczyk, the Artistic Director of documenta 14, and Annette Kulenkampff, the CEO of documenta gGmbH, as responsible for what they described as the imminent bankruptcy of documenta. According to them, this was caused by a lack of managerial capacity and a failure of financial oversight on the part of the team of documenta gGmbH. None of the journalists took their responsibility to check their facts with the two protagonists nor seek to gain a more complex picture of the situation. We acknowledge the responsibility that comes with organizing an exhibition that is partly financed with public funds. Furthermore, documenta 14 is made public in a collective and transnational way, beyond the mechanisms of local, regional and national identities and the funding systems associated with them. The argument of responsibility and accountability has to be understood in these terms. With this in mind, we wish to correct the misleading impressions given by this misguided journalism. The dimensions and planned content of the documenta 14 project were proposed by Adam Szymczyk in late 2013. His concept of two venues, in Athens and Kassel, was clearly communicated to all responsible parties at the time, namely all the stakeholders, the Supervisory Board of documenta gGmbH, and the international selection committee. Since the moment of his appointment, all these stakeholders have continually expressed their support for the project and stood behind all steps taken in the process of this two-venue documenta 14. -
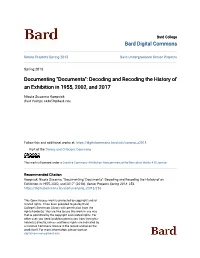
Documenta": Decoding and Recoding the History of an Exhibition in 1955, 2002, and 2017
Bard College Bard Digital Commons Senior Projects Spring 2018 Bard Undergraduate Senior Projects Spring 2018 Documenting "Documenta": Decoding and Recoding the History of an Exhibition in 1955, 2002, and 2017 Nicola Susanna Koepnick Bard College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2018 Part of the Theory and Criticism Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Koepnick, Nicola Susanna, "Documenting "Documenta": Decoding and Recoding the History of an Exhibition in 1955, 2002, and 2017" (2018). Senior Projects Spring 2018. 253. https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2018/253 This Open Access work is protected by copyright and/or related rights. It has been provided to you by Bard College's Stevenson Library with permission from the rights-holder(s). You are free to use this work in any way that is permitted by the copyright and related rights. For other uses you need to obtain permission from the rights- holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/or on the work itself. For more information, please contact [email protected]. Documenting documenta: Decoding and Recoding the History of an Exhibition in 1955, 2002, and 2017 Senior Project Submitted to The Division of Social Studies of Bard College by Nicola Koepnick Annandale-on-Hudson, New York May 2018 Acknowledgements I am indebted to everyone who helped me through this process. Especially, I would like to thank Tom Keenan, for challenging me with thoughtful questions, allowing me the freedom to find my voice, and pushing me to do the best I can. -

Documenta 14: Unlearned Predictability Anaïs Castro
Document generated on 09/26/2021 10:28 p.m. Espace Art actuel Documenta 14: Unlearned Predictability Anaïs Castro Blessures Wounds Number 118, Winter 2018 URI: https://id.erudit.org/iderudit/87375ac See table of contents Publisher(s) Le Centre de diffusion 3D ISSN 0821-9222 (print) 1923-2551 (digital) Explore this journal Cite this article Castro, A. (2018). Documenta 14: Unlearned Predictability. Espace, (118), 62–65. Tous droits réservés © Le Centre de diffusion 3D, 2018 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ 62 events évènements Emeka Ogboh, The Way Earthly Things Are Going, 2017. Installation view, Multichannel sound installation and real-time LED display of world stock indexes, Athens Conservatoire (Odeion), documenta 14. Photo: Mathias Völzke. 63 évènements events In October 2014, when Adam Szymczyk, documenta 14’s Artistic Director, announced that the world-renowned symposium would be shared between two cities, Kassel and Athens, his bold move generated intrigue. His explanation for this decision laid out his concern for a didactic consideration of the divisions and tensions between northern and southern Europe. The title Learning from Athens promised to address some of the current social and political issues facing Europe today, questioning its foundations such as colonialism, patriarchy, gender-normativity and capitalism amongst others. -

Postmedialne Reinterpretacje Europejskiej Czasoprzestrzeni
Kultura i Historia nr 32/2017 POSTMEDIALNE REINTERPRETACJE EUROPEJSKIEJ CZASOPRZESTRZENI. DOCUMENTA 14 W KASSEL 35 | Ewa Wójtowicz Abstrakt Tekst jest studium przypadku, jakim była wystawa documenta 14 (2017), przede wszystkim jej część zorganizowana w Kassel. Podjęte przez kuratora wystawy, Adama Szymczyka decyzje o lokalizacji wystawy w Atenach i Kassel oraz jej hasło „Ucząc się od Aten” kierują uwagę w stronę problematyki historii, tak dawnej, jak i najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem niełatwych relacji między Grecją a Niemcami na tle kultury europejskiej. Zaproszeni do udziału w wystawie artyści występują w roli badaczy europejskiej czasoprzestrzeni w tym jej przeszłości, wchodząc w role archiwistów, historyków, archeologów, czy antropologów oraz podejmują role eksploratorów przestrzeni jako podróżnicy, scenarzyści wydarzeń performatywnych, czy etnografowie. Postmedialnie uwarunkowane obszary niepewności, dociekań spekulatywnych, czy nawet konfabulacji, są korzystne dla sztuki, otwierając generowane przez nią znaczenia na nowe możliwości (re)interpretacji. Abstract This text is a case study of documenta 14 (2017), particularly the part of the exhibition organised in Kassel. Adam Szymczyk curatorial decision of locating the documenta 14, equally in Athens and Kassel and naming the exhibition “Learning from Athens”, enables an analysis of historical issues, both ancient and contemporary (the latter being particularly uneasy, when it comes to Greek-German relations in the perspective of European culture). The artists taking part in the exhibition play various roles, focusing on European history (as archivists, historians, archeologists, anthropologists) and geography (as explorers, travelers, authors of performative scenarios and ethnographers). The postmedia condition of uncertainty, speculative thinking or even confabulation are advantageous for art, as they direct the meanings thus generated towards the new possibilities of (re)interpretation. -

Approximations and Distancing Between
NINO, ALDONES. (2019). Approximations and distancing between contemporary art and decolonial thinking: DOCUMENTA 14 and MASP, The Overarching Issues of the European Space- a strategic (re)positioning of environmental and socio..., Porto, Fac.Letras Univ. Porto. pp. 112-125 (DOI: 10.21747/9789898969149/appr) APPROXIMATIONS AND DISTANCING BETWEEN CONTEMPORARY ART AND DECOLONIAL THINKING: DOCUMENTA 14 AND MASP1 Aldones NINO University of Granada / Federal University of Rio de Janeiro. [email protected] Abstract This article aims to analyze recent artistic proposals that work with categories such as post coloniality and decoloniality. The present research analyzes the institutional places and platforms of diffusion of this recent production, a dynamic process that is creating new cultural manifestations, in several geographies, with interest to question the remaining of the cultural submission, starting from a work of interpretation and visibility based on mechanisms linked to politics and resistance. We will seek a transnational dialogue, based on the public programs of documenta 14 and the São Paulo Museum of Art (MASP), highlighting the commitment that these programs have in evidencing the emergence of new narratives starting from the booming of themes that involve histories, establishing the possibility of creating debates in which the remnants of colonial structures that are sometimes questioned, sometimes evidenced. Such programs can be seen as a set of elements that help to reflect on a new political, social and global order. Keywords: -

Documenta 14
Documenta 14 The Greek Show What a surprise it was to find the contemporary Athens Museum installed in the Fridericianum in Kassel, the central museum location of Documenta for 71 years. But there it is, a rousing and delightful look at contemporary Greek art. ANTIDORON. The EMST Collection “Antidoron” (αντίδωρον, literally the return of a gift). The small part of the Athens collection (about 15%), 82 artists and 180 works, shown here also includes some Americans, such as Janine Antoni, Lynda Benglis, Joseph Kosuth, Bill Viola, and others, each with very expressive works that represent them well. These American works are old hat to art world lookers. The real prize here is all Greek. The works here are an exciting introduction for an outsider. In spite of the occupation of Documenta’s ancestral home, none of these artists are listed in the Documenta catalogue. This is not a Documenta show, but a truly memorable exhibit of Greek contemporary art created over the last 60 years. Even this rather small example of the museum’s holdings makes one anxious to know more about the unseen. Great appreciation is due to the museum’s Founding Director, Anna Kafetsi, without whom, most of this wonderful collection would not exist. Anna Kafetsi, Ph.D in Aesthetics-Art History and former curator for 17 years of the 20th century collection at the National Gallery of Athens, which became the collection of The National Museum of Contemporary Art (EMST), was appointed Founding Director of and probably assembled most of the collection. Anna Kafetsi is certainly the heroine of the birth of this museum, a little like Marcia Tucker at The New Museum in New York.