Baunetzwoche#82
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Arthur Ovaska
Arthur Ovaska March 6, 1951 – March 26, 2018 Arthur Ovaska, an Associate Professor in the Department of Architecture, died at the age of 67 on March 26, 2018 at his home in Ithaca, New York after a long struggle with cancer. He is survived by his wife, Sherri, his two sons, Eric and Alan, and his daughter, Wynter. Originally hailing from the coast of Massachusetts's Cape Cod Bay, Arthur began his study of Architecture at Cornell as an undergraduate student in 1968, graduating with a B.Arch. in 1974. Two years later he went on to his Master of Architecture degree, with Oswald Mathias Ungers and Colin Rowe as his initial advisors. From 1974 to 1978, he collaborated with Ungers in Ithaca and in Cologne, Germany, on a number of international architectural competitions, as well as on three landmark Cornell Summer programs: “The Urban Block” in Ithaca, and both “The Urban Villa” and “The Urban Garden” in Berlin. He was a major contributor to The City in the City: Berlin, A Green Archipelago, a 1977 manifesto by O.M.Ungers and Rem Koolhaas. In 1978, he co-founded the office Kollhoff & Ovaska with Hans Kollhoff, who had also been engaged with Cornell's graduate program and a collaborator on "The City in the City" project. Their office produced significant designs for Berlin's International Building Exposition 1979- 1984/87, including the original master plan as well as several constructions including the Lindenstrasse Apartments and the Museum Gardens (near the Berlin/Jewish Museum) and the Luisenplatz Development (near the Charlottenburg Castle), to name a few. -

Architectsnewspap
THE ARCHITECTSNEWSPAP WWW.ARCHPAPER.COM $3.95 ARCHITECTURE CRITIC LEADS LONDON,^TITUTION INTO EXPANSION PHASE HE GREAT APPEARING ACT HH I- 10 LU REMEMBERING SIMON UN6ERS O O 19 RETHINKING NEW ORLEANS 05 EAVESDROP 18 DIARY SUDJICTO 22 MARKETPLACE LEAD DESIGN ARCHITECT AND LITIGIOUS What do you do with the last vacant lot The proposed building for Greenwich Avenue MUSEUM CLIENT SETTLE OUT OF COURT available in the Greenwich Village Historic and 8th Avenue. District? For Hines Development Company ground-floor retail spaces if all goes as The Design Museum in London has and the architecture firm Kohn Pedersen planned. appointed critic and curator Deyan Sudjic Fox Associates (KPF), you build an icon. The At a March 7'" public hearing, the Landmarks as its new director. His appointment comes Vinolyin building's site, adjacent to Jackson Square Preservation Commission (LPC) received less than two months after the abrupt at 122 Greenwich Avenue and currently public testimony on the project. The project departure of Alice Rawsthorn, who served a parking lot, will become an 11-story, needs the IPC's approval before proceed• as director from 2002 until late January 128-foot-tall residential glass tower with ing because it is within continued on page 9 this year. When Sudjic starts his new job the Clear on September 1, he will be leaving his current positions as architecture and More than three months after filing suit OBRAIS SELECTED TO DESIGN design critic of the Observer (the Sunday against Rafael Viholy Architects for breach THIS YEAR'S SUMMER PAVILION edition of the daily Guardian) and dean of of contract, Philadelphia's Kimmel Center the faculty of art, architecture and design has settled with the New York-based firm. -

Oswald Mathias Ungers
Oswald Mathias Ungers Oswald Mathias Ungers 00_COUVERTURES.indd 1 08/01/2019 14:50 Oswald Mathias Ungers 01_UNGERS.indd 1 08/01/2019 15:39 01_UNGERS.indd 2 08/01/2019 15:39 I / Projets 1. Formation et renommé - Eléments bibliographiques - Haus Belvederestrasse 2. Rationalisation de l’existant - Studentenwohnheim Enschede - Köln Grünzug Süd 3. TU Berlin II / Textes Grossformen im Wohnungsbau 1966 L’après-guerre et la question résurgente des masses - Grossform = Quantité Critères de défnition - Grossform = Forme III / Epilogue Die Stadt in der Stadt, 1977 01_UNGERS.indd 3 08/01/2019 15:39 01_UNGERS.indd 4 08/01/2019 15:39 01 01_UNGERS.indd 5 08/01/2019 15:39 Préhistoire de Grossform Formation et renommé Préhistoire de Grossform chez OMU D’une maison simple à l’étude des infrastructures Formation et renommé Oswald Mathias Ungers naît à Kaisersesch en Allemagne le 12 juillet 1926 dans une famille modeste. Dans son en- fance, il est en contact avec de nombreuses réalisations romanes de la région, notamment la cathédrale de Trier ou encore l’abbaye Maria Laach situé à Glees, dont la géométrie strict trouve souvent une résonance dans les projets de Ungers. Puis, de sa petite ville natale de Rhé- nanie-Palatinat, il emménage à Karlsruhe dans le but d’y faire ses études à la Technische Hochschule (TU). Porté par « un intérêt émotionnel pour la modernité »1, Ungers décide rapidement de se plonger dans un cursus d’ar- chitecture. Dès 1950, à l’âge de 24 ans, il obtient son di- plôme sous la direction de Egon Eiermann et l’année qui suit, ouvre son bureau à Cologne. -

Oswald Mathias Ungers: Dialectical Principles of Design
OSWALD MATHIAS UNGERS: DIALECTICAL PRINCIPLES OF DESIGN Sam Jacoby Architectural Association School of Architecture, UK This is an Accepted Manuscript by Taylor & Francis for publication in The Journal of Architecture on 29.05.2018 1 ABSTRACT An important contributor to the post-war debate on architecture’s relationship to the city was the German architect Oswald Mathias Ungers (1926–2007). Starting in the early 1960s, he became increasingly interested in questions of typological organisation and morphological transformation, positing their relationship in dialectical principles. This paper traces some of the shifts in Ungers’s understanding of architecture through a utilisation of typology as a design theme, the morphological transformation of architectural form, and the coincidence of opposites in urban building complexes by reviewing a selection of closely linked pieces of design research (lectures, writings, and large-scale housing projects) from the 1960s to 80s. This paper examines how Ungers’s interest in rational design as a problem of serial formal and social transformations led him to new understandings of architectural and urban design. The concepts of typology and morphology hereby played a central role in reclaiming architecture as a formal and intellectual, but also a social and imaginative project, through which the city could be reasoned, however, always through the problems arising from architectural form itself. 2 INTRODUCTION Oswald Mathias Ungers (1926–2007) was an influential post-war German architect and important -

9054 MAM MNM Gallery Notes
Museums for a New Millennium Concepts Projects Buildings October 3, 2003 – January 18, 2004 MUSEUMS FOR A NEW MILLENNIUM DOCUMENTS THE REMARKABLE SURGE IN MUSEUM BUILDING AND DEVELOPMENT AT THE TURN OF THE NEW MILLENNIUM. THROUGH MODELS, DRAWINGS, AND PHOTOGRAPHS, IT PRESENTS TWENTY-FIVE OF THE MOST IMPORTANT MUSEUM BUILDING PROJECTS FROM THE PAST TEN YEARS. THE FEATURED PROJECTS — ALL KEY WORKS BY RENOWNED ARCHITECTS — OFFER A PANORAMA OF INTERNATIONAL MUSEUM ARCHITECTURE AT THE OPENING OF THE 21ST CENTURY. Thanks to broad-based public support, MAM is currently in the initial planning phase of its own expansion with Museum Park, the City of Miami’s official urban redesign vision for Bicentennial Park. MAM’s expansion will provide Miami with a 21st-century art museum that will serve as a gathering place for cultural exchange, as well as an educational resource for the community, and a symbol of Miami’s role as a 21st-century city. In the last decade, Miami has quickly become known as the Gateway of the Americas. Despite this unique cultural and economic status, Miami remains the only major city in the United States without a world-class art museum. The Museum Park project realizes a key goal set by the community when MAM was established in 1996. Santiago Calatrava, Milwaukee Art Museum, 1994-2002, Milwaukee, At that time, MAM emerged with a mandate to create Wisconsin. View from the southwest. Photo: Jim Brozek a freestanding landmark building and sculpture park in a premiere, waterfront location. the former kings of France was opened to the public, the Louvre was a direct outcome of the French Revolution. -

Modern Domestic Architcture in and Around Ithaca, Ny: the “Fallingwaters” of Raymond Viner Hall
MODERN DOMESTIC ARCHITCTURE IN AND AROUND ITHACA, NY: THE “FALLINGWATERS” OF RAYMOND VINER HALL A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts by Mahyar Hadighi January 2014 © 2014 Mahyar Hadighi ABSTRACT This research examines the role of Modern architecture in shaping the American dream through the work of a particular architect, Raymond Viner Hall, a Frank Lloyd Wright follower, in Ithaca, NY. Modernists’ ideas and Modern architecture played significant roles in the twentieth century post-depression urban history. Although the historic part of historic preservation does not commonly refer to twentieth century architecture, mid-century Modern architecture is an important part of the history and its preservation is important. Many of these mid-century Modern examples have already been destroyed, mainly because of lack of documentation, lack of general public knowledge, and lack of activity of advocacy groups and preservationists. Attention to the recent past history of Ithaca, New York, which is home of Cornell University and the region this research survey focuses on, is similarly not at the level it should be. Thus, in an attempt to begin to remedy this oversight, and in the capacity of a historic preservation-planning student at Cornell (with a background in architecture), a survey documenting the Modern architecture of the area was conducted. In the process of studying the significant recent history of Ithaca, a very interesting local adaptation of Wrightian architecture was discovered: the projects of Raymond Viner Hall (1908-1981), a semi-local Pennsylvanian architect, who was a Frank Lloyd Wright follower and son of the chief builder of Fallingwater. -

Oswald Mathias Ungers | Eine Intellektuelle Biographie Carlo Scarpa
32 Kalender Bauwelt 5|2008 Bauwelt 5 | 2008 Rezensionen 33 b beginnt diese Woche e endet diese Woche Finsterlin und dessen Fantasien fand. Dem folgt eine VERANSTALTUNGEN ARCHITEKTURTHEORIE MONOGRAFIE Wende um 180 Grad. Beim Berufungsvortrag 1963 Aachen Rasmus Wærn und Gerd Wingårdh 28.01. Kármán Auditorium, Hörsaal F01, RWTH Aachen Oswald Mathias Ungers | Eine intellektuelle in Berlin gibt sich Ungers als Morphologist, dem es Carlo Scarpa – Layers Aachener Montagabendgespräch 19.45 Uhr x www.rwth-aachen.de Biographie ausschließlich um Körper und Raum geht. „Inzwi- schen gilt sein Interesse nicht mehr den Architekten Wenn es das Genie überhaupt gibt, dann fällt es ganz Berlin b Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße 28.01.–09.02. Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3 Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse (Heft 3.08) Mo–Sa 12–19 Uhr Kann eine Biographie spannend sein? Wie ein Aben- und deren Kunst, es gilt den Strukturen der Städte.“ sicher nicht vom Himmel. Obwohl werkimmanente teuerroman! Gibt es über Ungers noch Neues zu er- Sechs Jahre intensive Lehre – wer dabei war, Analysen, die in den 90er Jahren auch in der Archi- Istanbul. In die Stadt – Byzans, Konstantinopel, Istanbul 29.01. Humboldt–Universität zu Berlin, Hauptgebäude Raum 2097 zählen? In diesem Buch auf fast jeder Seite! Wer ist wird sie nicht vergessen – enden im Chaos der Stu- tekturkritik en vogue waren, das Gegenteil vermit- Vortrag in der Reihe: Das Konzept Stadt 19–21 Uhr Unter den Linden 6 x www.antikezentrum.hu-berlin.de der Autor, und was ist eine intellektuelle Biographie? dentenrevolte und in der massiven Kritik am Märki- teln, sind selbst solche Ausnahmephänomene wie Jasper Cepl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am schen Viertel, an dem Ungers beteiligt war. -

Die Abwesende Utopie Skizze Zu Einer Kritischen Geschichte Der Städtebaulichen Leitbilder 1965-19851
33 Vittorio Magnago Lampugnani Die abwesende Utopie Skizze zu einer kritischen Geschichte der städtebaulichen Leitbilder 1965-19851 Konkrete Utopie steht am Horizont jeder Realität. Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung.2 Eine Wasserscheide in der Entwicklung der avantgardistischen urbanisti- schen Kultur bildete das Treffen vom Team 10,3 das 1966 in Berlin stattfand. Dies ist scheinbar doppelt paradox: denn institutionell begann mit dieser Tagung der Verlust der Führungsposition der ehemals revolu- tionären Architektengruppe innerhalb der fortschrittlichen Produzenten städtebaulicher Leitbilder, ein Verlust, der 1971 auf dem letzten Kongreß in Toulouse le Mirail endgültig und allgemein feststellbar werden sollte; und inhaltlich standen kaum neue konzeptionelle Ansätze im Mittel- punkt der Diskussion. In der Tat traten die bedeutsamen und innovativen Impulse marginal, sozusagen neben der Hauptveranstaltung auf, und darüber hinaus durch zwei Außenseiter. Der erste war Oswald Mathias Ungers, der bereits Anfang der sechziger Jahre begonnen hatte, mit Peter Smithson zusammenzuarbeiten, und mit diesem Treffen den Vorstellungen des Team 10 näherrückte. Sein 1964 in Angriff genommenes Projekt »Berlin 1995«, das noch die technologi- sche Utopie der Megastruktur verfolgte und die Grundidee von Smith- sons »urban infrastructure« übernahm, schlug anstelle des Verkehrswege- Systems für Automobile eine Kabinenbahn vor. Als Rasternetz über die alte Stadt gelegt, sollte sie die Erschließung der verschiedenen Nutzungs- einheiten der Stadt (Wohnen, Arbeiten, -

„Haus Im Haus". Die Umsetzung Eines Topos Im Modernen Kirchenbau
Originalveröffentlichung in: Langer, Andrea (Hrsg.): Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert, Warszawa 2004, S. 249-264 u. Abb. 1-15 Kai Kappel „Haus im Haus". Die Umsetzung eines Topos im modernen Kirchenbau In der Geschichte des Sakralbaues sind raumhaltige Ausgrenzungen und kleinmaßstäbliche Binnenarchitekturen durchaus geläufig. Meist wurden liturgisch bedeutsame Orte architektonisch ausgestaltet und gleichzeitig oder nachträglich mit einer äußeren Raumhülle umgeben. Ein antikes Beispiel ist das jüngere Didymaion mit seinem Kultbau im Sekos. Im Bereich des christlichen Sakralbaues sind dies die Grabeskirche in Jerusalem und manche ihrer Kopien, Kirchen mit Loreto-Haus oder S. Maria degli Angeli bei Assisi. Hingewiesen sei auch auf Altarziborien, Schreine und die Archi- tektonisierung des Allerheiligsten in Form von Sakramentshäusern. In einem weiteren Sinne zugehörig sind Einbauten in bestehende Strukturen, etwa die Adaption antiker Tempel für Kirchen. Der Kirchenbau des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart ist unter dieser Perspektive bisher noch nicht differen ziert betrachtet worden. Dieser Überblick über die höchst unterschiedlichen formalen Möglichkeiten baulicher Inkorporation ist auf Deutschland be schränkt; Umnutzungen, die zur Profanisierung von Kirchen geführt haben, werden nicht behandelt. „Haus im Haus" ist ein bisher kaum definierter architektonischer Topos. Oswald Mathias Ungers hat diesen verwendet, wenn mehrere Raumhüllen einen im Kern liegenden Raum umgeben.1 Um die mit dem Thema in Verbindung stehenden baulichen Erscheinungen präzise charakterisieren zu können, ist es erforderlich, weitere Begrifflichkeiten einzuführen. Die Einfü gung eines formal wie statisch weitgehend autonomen Systems aus Stützen, Decke und Dach in eine bestehende Raumstruktur wird als „Implementie rung" bezeichnet. Bei einem „Haus im Haus" befindet sich innerhalb der Umfassungsmauern eines Gebäudes ein freistehender, durch Mauern oder 1 UNGERS (1983), 59, zum Folgenden besonders 55-72. -

Visions Et Utopies 1
Visions et Utopies LAPIS / ENAC EPFL 2015 Liste des projets visionnaires par ordre Archizoom (Andrea Branzi) alphabétique - Residential Park, No Stop City, 1969 Asymptote - Steel Cloud, Los Angeles 1989 A Atelier Kempe Thill, Baukuh, GRAU, Lola And Raimund Abraham Aymen Hashem - Metropolitan Core, 1963-1964 - 900 km Nile City, 2013 - Glacier City, 1964 Atelier Olschinsky - Megabridge, 1965 - Structures series, 2010 - Universal City, 1966 - City Walls, 2013 - Living capsules for the Space City, 1966 - Pixel City, 2013 - Continuous building project, 1966 - Pixel City II, 2013 Edouard Albert, Jacques Cousteau - Artificial Island, Monaco 1966 B Roger Anger Mario Botta, Tita Carloni, Aurelio GAlfetti, Flora - Auroville (City of Dawn), 1968 Ruchat, Luigi Snozzi Ant Farm - Masterplan EPFL, 1970 - Inflatocookbook, 1975 Alan Boutwell Archigram (Warren Chalk, Peter Cook, Dennis - Bridge city, 1970 Crompton) Alan Boutwell, Mike Mitchell - Plug-in City : Expendable Place Pads, - Continuous City for 1.000.000 human Paddington East, London 1964 beings/City for the next century, 1968-1970 Archigram (Peter Cook, Taylor Woodrow) Aleksandr Brodsky, Ilya Utkin - Tower for Expo Montreal, 1967 - Paper Architecture, 1978-1993 Archigram (Peter Cook) Johannes Van den Broek, Jakob B. Bakema - Plug-in City, 1964-1966 - Pampus plan, 1964-1965 - Blow-out village, 1966 Richard Buckminster Fuller - Instant City Airship M3, 1968-1970 - Fountain Factory, the 90 percent automatic - Crater City, Essex UK 1971 cotton mill, project at North Carolina State - Arcadia, 1977 College, 1957 - Hulk Real City project, Frankfurt/Offenbach - Cloud Nine : Floating Tensegrity Spheres, 1987 1958 Archigram (David Greene) - Triton Floating Community, 1960-1967 - Spray plastic house, 1961 - Tetra City, 1965 - Suitaloon, 1966 - Old Man River City, St. -
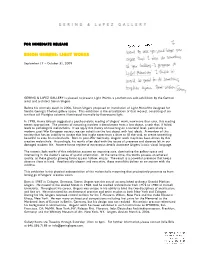
Simon Ungers: Light Works
FOR IMMEDIATE RELEASE SIMON UNGERS: LIGHT WORKS September 17 – October 31, 2009 GERING & LóPEZ GALLERY is pleased to present Light Works, a posthumous solo exhibition by the German artist and architect Simon Ungers. Before his untimely death in 2006, Simon Ungers proposed an installation of Light Monoliths designed for Sandra Gering’s Chelsea gallery space. This exhibition is the actualization of that request, consisting of six ten-foot tall Plexiglas columns illuminated internally by fluorescent light. In 1998, Henry Urbach suggested a psychoanalytic reading of Ungers’ work; now more than ever, this reading seems appropriate. The process of mourning involves a detachment from a lost object, a task that, if failed, leads to pathological melancholia. If we apply this theory of mourning on a societal level, particularly a modern, post-War European society, we can substitute the lost object with lost ideals. A member of this society that has an inability to accept this loss might experience a drive to fill the void, to create something beautiful to ease his melancholia. Born in post-War Germany, Ungers’ work may have been driven by this creative melancholy. Accordingly, his works often deal with the issues of presence and absence felt in our damaged modern life. Austere forms replete of extraneous details dominate Ungers’ iconic visual language. The totemic light works of this exhibition assume an imposing aura, dominating the gallery space and intervening in the viewer’s sense of spatial orientation. At the same time, the works possess an ethereal quality, as these ghostly glowing forms appear hollow, empty. The result is a powerful presence that keeps absence close at hand. -

Ob R a Architects 315 Church Street 4Th Floor New York
OBRA ARCHITECTS OBRA ARCHITECTS 315 CHURCH STREET 4TH FLOOR NEW YORK, NEW YORK 10013 UNITED STATES 19, CHANGGYEONGGUNG-RO 35-GIL JONGNO-GU, SEOUL 03076 KOREA OBRA Curriculum vitae ABOUT Obra Architects was founded in New York City in 2000 Completed work abroad includes a kindergarten for 540 6th AIA NY Design Award. In 2015 Obra was appointed as by Pablo Castro and Jennifer Lee. Obra’s work spans the schoolchildren in Beijing, the design of the main exhibition one of Seoul City Government’s Public Architects and in 2016 realms of architecture on all scales, from master planning for the first Seoul Architecture Biennale, and an ongoing the firm was selected to receive NYC Department of Design and institutional work to the scale of interiors, furniture, residential development in Argentina. and Construction Design Excellence contracts to design the and public art. The firm deploys and develops unique design City’s new public buildings and capital construction projects. solutions involving the latest technology and environmental Obra has produced a body of award-winning projects Pablo Castro was elevated to AIA Fellow in 2018. thinking. recognized by the American Institute of Architects, the Chicago Athenaeum American Architecture Awards, and the Obra is a Minority Women-Owned Business Enterprise Pablo Castro and Jennifer Lee have extensive experience Architectural League of New York, among others. The work certified in the State and City of New York. Their second coordinating complex multidisciplinary design teams, while of Obra has been exhibited widely, and has been featured monograph entitled “Obra Architects Logic: Selected Projects, maintaining award-wining design quality and the highest at the Museum of Modern Art, PS1 Contemporary Art 2003 - 2016” was published by Arkitektur B, Copenhagen in standards of project development and execution.