Skriptumws16.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Review of the Status of Larger Brachycera Flies of Great Britain
Natural England Commissioned Report NECR192 A review of the status of Larger Brachycera flies of Great Britain Acroceridae, Asilidae, Athericidae Bombyliidae, Rhagionidae, Scenopinidae, Stratiomyidae, Tabanidae, Therevidae, Xylomyidae. Species Status No.29 First published 30th August 2017 www.gov.uk/natural -england Foreword Natural England commission a range of reports from external contractors to provide evidence and advice to assist us in delivering our duties. The views in this report are those of the authors and do not necessarily represent those of Natural England. Background Making good decisions to conserve species This report should be cited as: should primarily be based upon an objective process of determining the degree of threat to DRAKE, C.M. 2017. A review of the status of the survival of a species. The recognised Larger Brachycera flies of Great Britain - international approach to undertaking this is by Species Status No.29. Natural England assigning the species to one of the IUCN threat Commissioned Reports, Number192. categories. This report was commissioned to update the threat status of Larger Brachycera flies last undertaken in 1991, using a more modern IUCN methodology for assessing threat. Reviews for other invertebrate groups will follow. Natural England Project Manager - David Heaver, Senior Invertebrate Specialist [email protected] Contractor - C.M Drake Keywords - Larger Brachycera flies, invertebrates, red list, IUCN, status reviews, IUCN threat categories, GB rarity status Further information This report can be downloaded from the Natural England website: www.gov.uk/government/organisations/natural-england. For information on Natural England publications contact the Natural England Enquiry Service on 0300 060 3900 or e-mail [email protected]. -

Horseflies (Diptera: Tabanidae) of South - East Herzegovina (Bosnia and Herzegovina)
Entomol. Croat. 2008, Vol. 12. Num. 2: 101-107 ISSN 1330-6200 HORSEFLIES (DIPTERA: TABANIDAE) OF SOUTH - EAST HERZEGOVINA (BOSNIA AND HERZEGOVINA) Alma MIKUŠKA1, Stjepan KRČMAR1 & József MIKUSKA† Department of Biology, J. J. Strossmayer University Lj. Gaja 6, HR-31000 Osijek, Croatia, [email protected] Accepted: March 7th 2008 The article presents the horsefly fauna (Dipteral: Tabanidae) of the south- east Herzegovina region, Bosnia and Herzegovina. During the 1987-1990 and 2003–2005 periods we collected a total of 847 horseflies representing 27 species and classified in eight genera. The most common genus isTabanus represented with 12 species, followed by the genera Hybomitra – 6, Haematopota – 3 Chrysops – 2, and Atylotus, Dasyrhamphis, Philipomyia and Therioplectes with 1 species, respectively. The five most abundant species were Hybomitra muehlfeldi (34.36 %), Tabanus bromius (12.04 %), Chrysops viduatus 9.33 %, Hybomitra ciureai (8.85 %) and Philipomyia greaca (6.26 %), which account for 70.84 % of the total number of collected specimens. New species recorded for this region and the for the whole of the state of Bosnia and Hercegovina are: Tabanus eggeri, Tabanus darimonti and Tabanus shanonnellus. Fauna, Tabanidae, Diptera, Bosnia and Herzegovina ALMA MIKUŠKA1, STJEPAN KRČMAR1 & JÓZSEF MIKUSKA†: Obadi (Diptera: tabanidae) u jugoistočnoj Hercegovini (Bosna i Hercegovina). Entomol. Croat. Vol. 12, Num 2: 101-107. U ovom radu prvi je put predstavljena fauna obada (Diptera: Tabanidae) jugoistočne Hercegovine. Utvrđeno je 27 vrsta obada zastupljenih s osam rodova. Rod Tabanus zastupljen je s 12 vrsta, Hybomitra sa šest, Haematopota s tri, Chrysops s dvije, te Atylotus, Dasyramphis, Philipomyia i Therioplectes s po jednom vrstom. -

Trakya Bölgesi Tabanidae (Diptera) Faunası
Tr. J. of Zoology A, Y. KILIÇ 23 (1999) Ek Sayı 1, 67–89 © TÜBİTAK Trakya Bölgesi Tabanidae (Diptera) Faunası Ali Yavuz KILIÇ Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı, Eskişehir-TÜRKİYE Geliş Tarihi: 20.05.1996 Özet: Trakya bölgesinde gerçekleştirilen bu çalışma ile 64 Tabanidae türü tespit edilmiştir. Bunlardan sekizi, Chrysops relictus Meig., Dasyramphis anthracinus (Meig.), Atylotus latistriatus (Brauer), A. venturii Leclercq, Hybomitra bimaculata (Macq.), H. pilosa (Loew), Tabanus maculicornis Zetterstedt, Haematopota gallica Szi., Türkiye Tabanidae faunası için yeni kayıttır. Ayrıca tespit edilen türlerden 33'ü Trakya bölgesinden ilk kez lokalite belirtilerek bildirilmektedir. Şimdiye kadarki çalışmalarla Trakya bölgesinde yayılış gösterdiği bildirilenlerle birlikte, toplam tür sayısı 74'e çıkmış olmaktadır. Anahtar Sözcükler: Trakya, Insecta, Diptera, Tabanidae, Fauna Tabanidae (Diptera) Fauna of Turkish Thrace Region Abstract: Sixtyfour species of Tabanidae (Diptera) were determinated in Trakya region of Turkey by this study. Eight of these, Chrysops relictus Meig., Dasyramphis anthracinus (Meig.), Atylotus latistriatus (Brauer), A. venturii Leclercq, Hybomitra bimaculata (Macq.), H. pilosa (Loew), Tabanus maculicornis Zetterstedt, Haematopota gallica Szi., are new records for Tabanidae fauna of Turkey. 33 out of 64 species were recorded by their distribution patterns in Trakya region for the first time. The number of Tabanidae species in Trakya region reached to 74 with this study and the previous records. Key Words: Thrace, Insecta, Diptera, Tabanidae, Fauna Giriş yakındır (44,45,46). Bu sonuçlar ve Türkiye’nin coğrafi Türkiye Tabanidae faunası üzerindeki ilk çalışmalar yapısı dikkate alındığında Türkiye’de tespit edilmemiş oldukça eskidir. Öyle ki bu çalışmalardaki lokalite daha birçok Tabanidae türünün bulunması kayıtları bugün Türkiye sınırları içinde olmadığından muhtemeldir. -
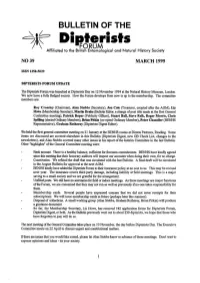
Create by Pagemanager
BULLETIN OF THE Dipterists • CkAdrDTI jIm kit filiated to the British Entomological and Natural History Society NO 39MARCH 1995 ISSN 1358-5029 DIPTERISTS FORUM UPDATE The Dipterists Forum was launched at Dipterists Day on 12 November 1994 at the Natural History Museum, London. We now have a fully fledged society. How the Forum develops from now is up to the membership. The committee members are: Roy Crossley (Chairman), Alan Stubbs (Secretary), Jon Cole (Treasurer, coopted after the AGM), Liz Howe (Membership Secretary), Martin Drake (Bulletin Editor, a change of post title made at the first General Committee meeting), Patrick Roper (Publicity Officer), Stuart Ball, Steve Falk, Roger Morris, Chris Spilling (elected Ordinary Members), Brian Pitkin (co-opted Ordinary Member), Peter Chandler (BENHS Representative), Graham Rotheray (Dipterists Digest Editor). We held the first general committee meeting on 21 January at the BENHS rooms at Dinton Pastures, Reading. Some items we discussed are covered elsewhere in this Bulletin (Dipterists Digest, new GB Check List, changes to the newsletters), and Alan Stubbs covered many other issues in his report of the Interim Committee in the last Bulletin. Other "highlights" of the General Committee meeting were: Bank account There is a healthy balance, sufficient for foreseen commitments. BENHS have kindly agreed since this meeting that their honorary auditors will inspect our accounts when doing their own, for no charge. Constitution. We refined the draft that was circulated with the last Bulletin. A final draft will be circulated in the August Bulletin for approval at the next AGM. BENHS kindly have added the Dipterists Forum to their insurance policy at no cost to us. -

The Horse Flies (Diptera, Tabanidae) of Norway
© Norwegian Journal of Entomology. 8 December 2014 The Horse Flies (Diptera, Tabanidae) of Norway MORTEN FALCK Falck, M. 2014. The Horse Flies (Diptera, Tabanidae) of Norway. Norwegian Journal of Entomology 61, 219–264. The Norwegian species are reviewed, and keys are supplied for all species. The following species are reported as new to Norway: Chrysops viduatus (Fabricius, 1794), Atylotus latistriatus Brauer, 1880, Hybomitra aterrima (Meigen, 1820), Hybomitra solstitialis (Meigen 1820), Haematopota italica Meigen, 1804, Haematopota subcylindica Pandellé, 1883 and Tabanus miki Brauer, 1880. The finding of Hybomitra aterrima solves the question of whether this taxon is a southern form of Hybomitra auripila Meigen, 1820 or a good species, and the long standing controversies over this question. However, the identity of Atylotus latistriatus seems to offer an unresolved problem. Maps of distribution, and a check list to the Norwegian species are supplied, and new Norwegian names are proposed for each species. Key words: Diptera, Tabanidae, Chrysops, Atylotus, Hybomitra, Tabanus, Heptatoma, Haematopota, Atylotus latistriatus, Hybomitra aterrima, Norway, identification keys, distribution maps. Morten Falck, Hovinveien 39, NO-0661 Oslo Norway. E-mail: [email protected] Introduction Meigen, 1820, and the danish priest O. Fr. Müller, who in 1764 described Haematopota arcticus Horse flies are big to medium-sized flies of the (Müller, 1764), later synonymized with H. lower Brachycera, comprising an estimated 4500 pluvialis (Linnaeus, 1758). As the northern parts species worldwide (Marshall 2012). Their size, of the country was researched by the pupils and abundance and the females’ blood-sucking make heirs of Linnaeus, more species were named. I. C. them one of the groups that most people relate to, Fabricius named Hybomitra borealis (Fabricius, have names for and know. -

Dipterists Digest: Contents 1988–2021
Dipterists Digest: contents 1988–2021 Latest update at 12 August 2021. Includes contents for all volumes from Series 1 Volume 1 (1988) to Series 2 Volume 28(2) (2021). For more information go to the Dipterists Forum website where many volumes are available to download. Author/s Year Title Series Volume Family keyword/s EDITOR 2021 Corrections and changes to the Diptera Checklist (46) 2 28 (2): 252 LIAM CROWLEY 2021 Pandivirilia melaleuca (Loew) (Diptera, Therevidae) recorded from 2 28 (2): 250–251 Therevidae Wytham Woods, Oxfordshire ALASTAIR J. HOTCHKISS 2021 Phytomyza sedicola (Hering) (Diptera, Agromyzidae) new to Wales and 2 28 (2): 249–250 Agromyzidae a second British record Owen Lonsdale and Charles S. 2021 What makes a ‘good’ genus? Reconsideration of Chromatomyia Hardy 2 28 (2): 221–249 Agromyzidae Eiseman (Diptera, Agromyzidae) ROBERT J. WOLTON and BENJAMIN 2021 The impact of cattle on the Diptera and other insect fauna of a 2 28 (2): 201–220 FIELD temperate wet woodland BARRY P. WARRINGTON and ADAM 2021 The larval habits of Ophiomyia senecionina Hering (Diptera, 2 28 (2): 195–200 Agromyzidae PARKER Agromyzidae) on common ragwort (Jacobaea vulgaris) stems GRAHAM E. ROTHERAY 2021 The enigmatic head of the cyclorrhaphan larva (Diptera, Cyclorrhapha) 2 28 (2): 178–194 MALCOLM BLYTHE and RICHARD P. 2021 The biting midge Forcipomyia tenuis (Winnertz) (Diptera, 2 28 (2): 175–177 Ceratopogonidae LANE Ceratopogonidae) new to Britain IVAN PERRY 2021 Aphaniosoma melitense Ebejer (Diptera, Chyromyidae) in Essex and 2 28 (2): 173–174 Chyromyidae some recent records of A. socium Collin DAVE BRICE and RYAN MITCHELL 2021 Recent records of Minilimosina secundaria (Duda) (Diptera, 2 28 (2): 171–173 Sphaeroceridae Sphaeroceridae) from Berkshire IAIN MACGOWAN and IAN M. -

Vertical Distribution and Comparative Zoogeographical
Published online 29 December 2017 Historia naturalis bulgarica • ISSN 0205-3640 (print) | ISSN 2603-3186 (online) • http://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/ Historia naturalis bulgarica, 24: 61-119, 2017 Vertical distribution and comparative zoogeographical characteristic of dipteran fauna (Insecta: Diptera) according to the vegetation belts of the Pirin and Rila Mountains Zdravko Hubenov Abstract: A total of 1351 species from 63 families (759 species from the Pirin Mts. and 1003 species from the Rila Mts.) have been recorded from the two mountains so far. The low degree of similarity (46.2%) of the fauna between these mountains is related to their natural features and insufficient research. The greatest number of species has been found in the zone of the beech forests (409 species or 55.1% from Pirin Mts. and 736 species or 73.4% from the Rila Mts.). The degree of similarity between the dipteran fauna of the different vegetation belts of the two mountains ranges from 0% to 46.6%. The dipterans belong to 92 areographical categories, divided into two supergroups: 1) species with Mediterranean type of distribution: more thermophilic and distributed mainly in the southern parts of the Palaearctic (49 species or 6.5% from Pirin Mts. and 48 species or 4.8% from the Rila Mts.); 2) species with Palaearctic and Eurosiberian type of distribution: more eurybiontic and widely distributed in the Palaearctic (710 species or 93.5% from Pirin Mts. and 955 species or 95.2% from the Rila Mts.). The Holomediterranean and Mediterranean-Central Asian forms (from 0.6% to 1.3%) are the best represented in the first group. -

Larger Brachycera Recording Scheme Newsletter 15 Spring 1997 Dipterists
Larger Brachycera Recording Scheme Newsletter 15 Spring 1997 Dipterists FORUM ISSN 1359-5029 Contents Oxycera morrisii larvae in streams Martin Drake A transport of delight editor Ptiolina - species to look out for in northern Britain Martin Drake Hybomitra ciureai Seguy (Tabanidae) new to Wales and western Britain. David Heaver Personal notes on attacks by female tabanids Andrew Grayson Further notes regarding finding male tabanids Andrew Grayson Asilids new to the British list Martin Drake Eutolmus rujibarbis rediscovered in the New Forest Malcolm Smart Observations on egg laying by the robberfly Machimus rusticus (Diptera: Alan Stubbs Asilidae) The robber flies (Asilidae) of Europe Index ofthe Larger Brachycera Recording Scheme Newsletters Nos 1-15 Oxycera morrisii larvae in streams The biology of most British Oxycera is moderately well understood. At least, one can guess the probable identity of larvae from the habitat in which they were found. Thus, in calcareous seepages one would expect to find dives, pardalina and pygmaea, along muddy water margins it would be trilineata, and in wet meadows most likely rara. However, Andy Godfrey has been sampling calcareous streams in Lincolnshire and Oxfordshire using the usual river biologist's method of kick-sampling in riffles. Here he has found morrisii. The larvae of this species have been found in a range of habitats such as marshes and stream margins. This is the first record of the larvae being found within the body of the stream. This was not a single chance event because several larvae were found at more than one site. Although the separation of the larvae of morrisii and pardalina is not good using present characters, there is little doubt that morrisii is the species involved. -

Dipterists Forum
BULLETIN OF THE Dipterists Forum Bulletin No. 83 Spring 2017 Affiliated to the British Entomological and Natural History Society Bulletin No. 83 Spring 2017 ISSN 1358-5029 Editorial panel Bulletin Editor Darwyn Sumner Assistant Editor Judy Webb Dipterists Forum Officers Chairman Rob Wolton Vice Chairman Howard Bentley Secretary Amanda Morgan Meetings Treasurer Victoria Burton Please use the Booking Form downloaded from our website Membership Sec. John Showers Field Meetings Field Meetings Sec. vacancy Now organised by several different contributors, including Indoor Meetings Sec. Martin Drake Roger Morris 7 Vine Street, Stamford, Lincolnshire PE9 1QE Publicity Officer Erica McAlister [email protected] Conservation Officer vacant Workshops & Indoor Meetings Organiser Ordinary Members Martin Drake [email protected] Malcolm Smart, Chris Raper, Duncan Sivell, Philip Brighton, Bulletin contributions Peter Boardman Please refer to guide notes in this Bulletin for details of how to contribute and send your material to both of the following: Unelected Members Dipterists Bulletin Editor Dipterists Digest Editor Peter Chandler Darwyn Sumner 122, Link Road, Anstey, Charnwood, Leicestershire LE7 7BX. Tel. 0116 212 5075 Secretary [email protected] Amanda Morgan Pennyfields, Rectory Road, Middleton, Saxmundham, Suffolk, IP17 3NW Assistant Editor [email protected] Judy Webb 2 Dorchester Court, Blenheim Road, Kidlington, Oxon. OX5 2JT. Treasurer Tel. 01865 377487 Victoria Burton [email protected] [email protected] 68 South Road, Drayton PO6 1QD Deposits for DF organised field meetings to be sent to the Treasurer Conservation Dipterists Digest contributions Robert Wolton (interim contact, whilst the post remains vacant) Dipterists Digest Editor Locks Park Farm, Hatherleigh, Oakhampton, Devon EX20 3LZ Tel. -

Diptera, Tabanidae)
Period biol, Vol 113, Suppl 2 P 1–61, Zagreb, September, 2011 four issues yearly An Interdisciplinary International Journal of the Societas Scientiarum Naturalium Croatica established 1885 Published by Croatian Society for Natural Sciences Ru|er Bo{kovi} Institute LASERplus Past Editors Spiridion Brusina 1886–1892 Ferdo Koch 1918–1920 Antun Heinz 1893–1895 Krunoslav Babi} 1921–1922 Spiridion Brusina 1896–1899 Fran [uklje 1923–1925 Antun Heinz 1900–1901 Boris Zarnik 1926 Oton Ku~era 1902–1909 Fran [uklje 1927–1938 Jovan Had`i 1910 Ivan Erlich 1947–1953 Dragutin Hirtz Stjepan Horvati} Antun Heinz 1911–1914 Teodor Vari~ak 1954–1974 Fran Tu}an 1916–1917 Vlatko Silobr~i} 1975–1994 Fran Bubanovi} 1915 Editor-in-Chief Branko Vitale Associate Editors Andrea Ambriovi} Ristov Sonja Levanat Krunoslav Capak Pero Lu~in Irena Coli} Bari} Kre{imir Paveli} Maja Joki} Sabina Rabati} Marijan Klarica Ivan Saboli} Marijana Krsnik Rasol Nenad Smodlaka Sven Kurbel Dra`en Viki}-Topi} Hrvoje Lepedu{ Language editor Nikola Habuzin Web administrator Tomislav Lipi} Secretary Sanja Hr`ica Editorial Office Periodicum biologorum, Hrvatsko prirodoslovno dru{tvo Frankopanska1/I, P.O. Box 258, 10001 Zagreb, Hrvatska – Croatia Tel/Fax: 385 (0)1 48 31 223, E-mail: [email protected] KEY TO THE HORSE FLIES FAUNA OF CROATIA (DIPTERA, TABANIDAE) Stjepan Kr~mar, Davorka K. Hackenberger, Branimir K. Hackenberger PERIODICUM BIOLOGORUM UDC 57:61 VOL. 113, Suppl 2, 2011 CODEN PDBIAD Key to the horse flies fauna of Croatia (Diptera, Tabanidae) ISSN 0031-5362 Original scientific paper Key to the horse flies fauna of Croatia (Diptera, Tabanidae) STJEPAN KR^MAR, DAVORKA K. -
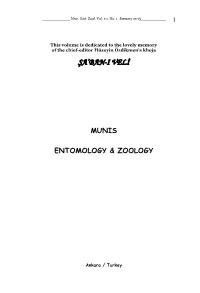
Scope: Munis Entomology & Zoology Publishes a Wide Variety of Papers
____________ Mun. Ent. Zool. Vol. 10, No. 1, January 2015___________ I This volume is dedicated to the lovely memory of the chief-editor Hüseyin Özdikmen’s khoja ŞA’BAN-I VELİ MUNIS ENTOMOLOGY & ZOOLOGY Ankara / Turkey II ____________ Mun. Ent. Zool. Vol. 10, No. 1, January 2015___________ Scope: Munis Entomology & Zoology publishes a wide variety of papers on all aspects of Entomology and Zoology from all of the world, including mainly studies on systematics, taxonomy, nomenclature, fauna, biogeography, biodiversity, ecology, morphology, behavior, conservation, paleobiology and other aspects are appropriate topics for papers submitted to Munis Entomology & Zoology. Submission of Manuscripts: Works published or under consideration elsewhere (including on the internet) will not be accepted. At first submission, one double spaced hard copy (text and tables) with figures (may not be original) must be sent to the Editors, Dr. Hüseyin Özdikmen for publication in MEZ. All manuscripts should be submitted as Word file or PDF file in an e-mail attachment. If electronic submission is not possible due to limitations of electronic space at the sending or receiving ends, unavailability of e-mail, etc., we will accept “hard” versions, in triplicate, accompanied by an electronic version stored in a floppy disk, a CD-ROM. Review Process: When submitting manuscripts, all authors provides the name, of at least three qualified experts (they also provide their address, subject fields and e-mails). Then, the editors send to experts to review the papers. The review process should normally be completed within 45-60 days. After reviewing papers by reviwers: Rejected papers are discarded. For accepted papers, authors are asked to modify their papers according to suggestions of the reviewers and editors. -
Working Today for Nature Tomorrow
Report Number 650 Exotic plant species on brownfield land: their value to invertebrates of nature conservation importance English Nature Research Reports working today for nature tomorrow English Nature Research Reports Number 650 Exotic plant species on brownfield land: their value to invertebrates of nature conservation importance Edward Bodsworth1, Peter Shepherd1 & Colin Plant2 1Baker Shepherd Gillespie, Worton Rectory Park, Oxford OX29 4SX 2Colin Plant Associates (UK), Bishops Stortford CM23 3QP You may reproduce as many additional copies of this report as you like, provided such copies stipulate that copyright remains with English Nature, Northminster House, Peterborough PE1 1UA ISSN 0967-876X © Copyright English Nature 2005 Acknowledgements The authors would like to thank all of the people who gave their time and/or provided information to this project. Particular thanks goes to the following: David Agassiz Caroline Bulman, Butterfly Conservation Mike Edwards Nicky Hewson, University of Leeds Roger Key, English Nature David Knight, English Nature David Roy, Centre for Ecology and Hydrology, who provided access to the Phytophagous Insect Data Bank Matt Shardlow, Buglife (The Invertebrate Conservation Trust) Richard Smith, The BUGS project, University of Sheffield Alan Stubbs, Buglife (The Invertebrate Conservation Trust) Ken Thompson, The BUGS project, University of Sheffield Jon Webb, English Nature We are extremely grateful to the following, who provided expert advice on invertebrates of conservation importance on brownfield land: Martin Drake Steve Falk David Gibbs Peter Harvey Peter Hodge John Ismay Peter Kirby Barbara Schulten Executive summary This report reviews information on the status of invertebrate species of conservation concern within brownfield sites with the specific aim of assessing the value of exotic plant species in supporting populations of these invertebrates.