Geschichte Der Schachideen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
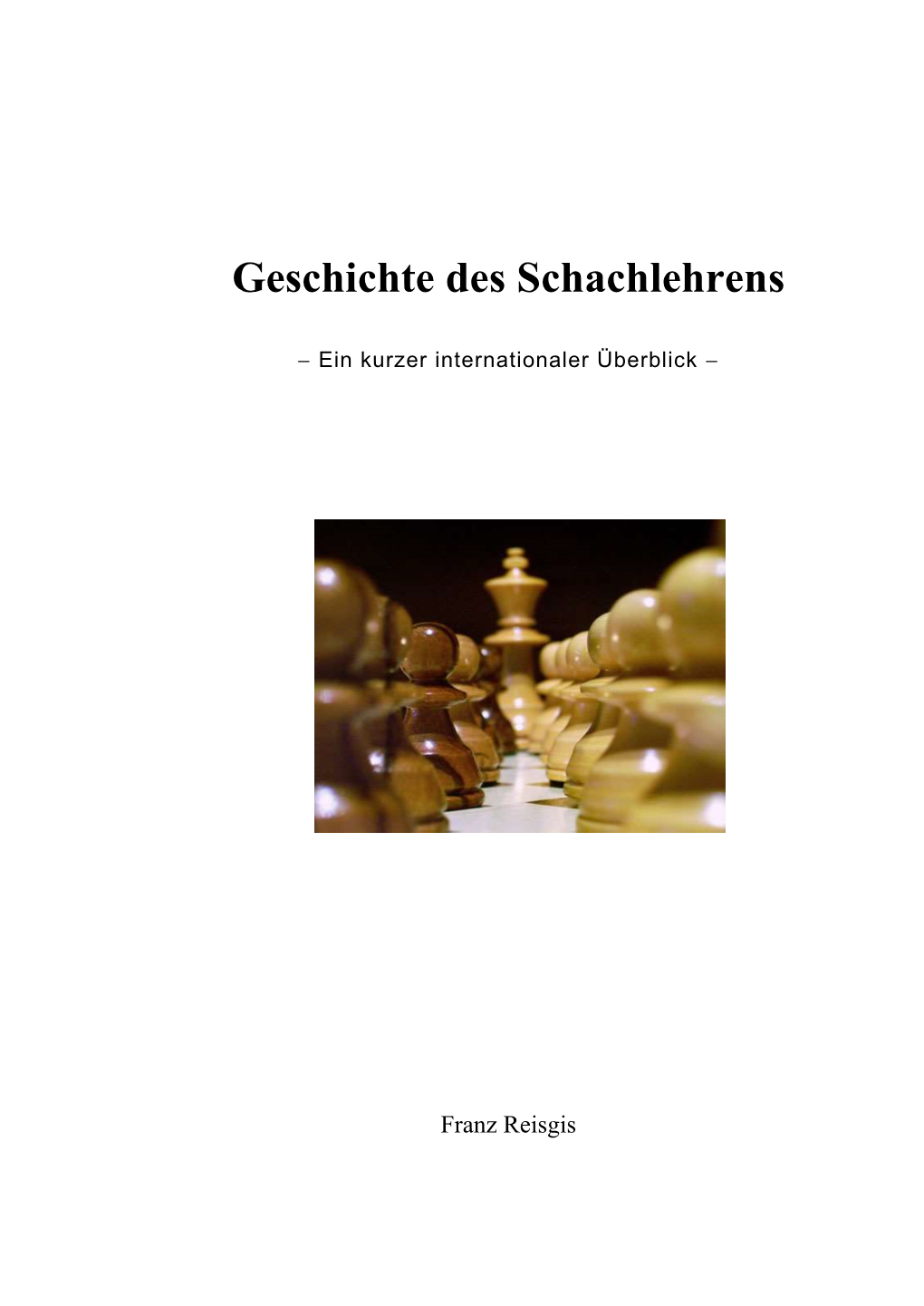
Load more
Recommended publications
-

Salone Della Cultura, Milano 2019
1 1) (ARCHEOLOGIA MODERNA STORIA DELL’ARTE), Montfaucon Bernard de, Antiquity explained, and represented in sculptures, By the learned Father Montfaucon. Translated into English by David Humphreys. M.A. and fellow of Trinity-College in Cambridge. [15 parti in 7 tomi, completo di tutti i supplementi e di tutte le tavole. Complete], London, Printed by J. Tonson & J. Watts., 1721 – 1725. In folio (39,5×25,5 cm); le tavole a doppia pagina nei volumi si trovano spesse rilegate con pecetta centrale, alcune tavole sono più volte ripiegate. 15 parti in 7 tomi, completo delle 5 parti di supplemento spesso assenti: volume 1 (parte I e II) (42), 260 pp. e 98 c. di tav. fuori testo, volume 2 (prte I e II) 284 pp. e 61 c. di tav. fuori testo, volume 3 (parte I e II) 227, (1) pp. e 63 c. di tav. fuori testo, volume 4 (parte I e II ) 193, (1) pp. e 46 c. di tav. fuori testo 5 volume (parte I e II) 165, (29) pp. 51 c. di tav., Supplemento (parte I-II) (22), 256 pp. e 54 c. di tav. fuori testo, Supplemento 2 (parte III-IV-V), (3), 260-571, (15) pp. e 74 c. di tav. Legature coeve in piena pelle con doppio filetto in oro ai piatti. Dorsi a 6 nervi con titolo, numero del volume e filetti in oro ai tasselli. Cerniera anteriore del primo volume di supplemento appena un po' lenta nel margine basso. Abile restauro a tre dorsi. Poche pagine leggermente ed uniformemente brunite a causa della qualità della carta utilizzata, praticamente in modo ininfluente e nel complesso esemplare in buone-ottime condizioni di conservazione. -

The Fidelity Chessmaster 2100
_~HE FIDELIT'0~ HESS ASTE Table of Contents 1. Let's Play Chess ........... ................ 3 (Provided by the U.S. Chess Federation. It's your official Introduction to the play of the game. If you already know how to play chess. you may wan t to skip this section.) 2 . A History of Chess ......................... 9 (Everyth ing you ever wanted to know. a nd more, about how the game came to be.) 3. World Champions and Their Play.... 12 (The inside story about the greatest "Wood Pushers' in the world - and the nuttiest.) 4 . Chess and Machines ..................... 28 (Trace your chess-playin g computer's antecedents back to Maelzel' s Turk, a famous trick Inven ted in 1763.) 5 . Library of Classic Games ............... 33 (Here's a fascinating collection of 11 0 hard fo ught games as played by the greatest masters in h istory. The Ch essmaster 2 100 will replay th em for you on comman d.) 6 . Bralnteasers ................................ 51 (Some instructive problems th at may teach you a few sneaky tricks.) 7 . Algebraic Notation ....................... 53 (e4. Nxf3 ... what's it all about? Chess shorthand explained.) Copyright © 1988 The Software Toolworks. Printed In U.S.A. by Priority Software All Righ ts Reserved. Packaging. Santa Ana, California. 3 Let's Play Chess The Pieces Chess is a game for two players. one with White always moves first. and then the the "White" pieces and one with the players take turns movlng. Only one "Black" - no matter what colors your set piece may be moved at each turn (except actually uses. -

1.Which Indian Tennis Player Has Been Selected As a Member of the ITF World Tennis Tour Men's Panel Representing the Asia-Oceania Zone?
1.Which Indian Tennis Player has been selected as a member of the ITF World Tennis Tour Men's Panel representing the Asia-Oceania zone? A. Prajnesh Gunneswaran B. Niki Kalyanda Poonacha C. Yuki Bhambri D. Rohan Bopanna 1. किस भारतीय टेनिस खिलाडी िो ITF वर्ल् ड टेनिस टू र मᴂस पैिल िे सदस्य िे 셂प मᴂ चुिा गया है जो एशिया-ओशिनिया क्षेत्र िा प्रनतनिधि配व िरता है? ए प्रजिेि गणु ेश्वरि बी नििी िर्लयािंद पूिाचा सी। युिी भांबरी ्ी। रोहि बोपन्िा 2.The National Anti-Doping Agency has issued notices to which Indian cricketers for not disclosing their whereabouts? 2. राष्ट्रीय ्ोपपगं रोिी एजᴂसी िे भारतीय कििे टरⴂ िो उििे ठििािे िा िुलासा िहीं िरिे िे शलए िोठटस जारी किया है? A. MS Dhoni, Rohit Sharma B. Virat Kohli, Rohit Sharma C. Cheteshwar Pujara, Ravindra Jadeja D. Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal The National Anti-Doping Agency has issued notices to Indian cricketers Cheteshwar Pujara, Ravindra Jadeja and KL Rahul for not disclosing their whereabouts. The NADA has issued similar notices to women cricketers Deepti Sharma and Smriti Mandhana. These five cricketers are members of National Registered Testing Pool and they need to disclose their whereabouts on quarterly basis. नेशनल एंटी-डोप गं एजᴂसी ने भारतीय कििेटरⴂ चेतेश्वर पुजारा, रवींद्र ज्ेजा और िेएल राहुल िो उििे ठििािे िा िुलासा िहीं िरिे िे शलए िोठटस जारी किया है। िा्ा िे मठहला कििे टरⴂ दीप्तत िमाड और स्मनृ त मिं ािा िो इसी तरह िे िोठटस जारी किए हℂ। ये पांच कििे टर िेििल रप्जस्ट् ड टेप्स्टंग पूल िे सदस्य हℂ और उन्हᴂ नतमाही आिार पर अपिे ठििािे िा िुलासा िरिे िी ज셂रत है। The National Anti-Doping Agency (NADA) is the national organisation responsible for promoting, coordinating, and monitoring the doping control program in sports in all its forms in India. -

Super Current Affairs Product Worth Rs 1200 @ 399/- (Deal of the Year) GRAB THIS OFFER NOW
Page 1 Follow us: Official Site, Telegram, Facebook, Instagram, Instamojo All Super Current Affairs Product Worth Rs 1200 @ 399/- (Deal Of The Year) GRAB THIS OFFER NOW Page 2 Follow us: Official Site, Telegram, Facebook, Instagram, Instamojo SUPER Current Affairs MCQ PDF 30th & 31st August 2021 By Dream Big Institution: (SUPER Current Affairs) © Copyright 2021 Q.When is the National Small Industry Day observed in India? A) Last Monday of August C) Last Sunday of August B) 29 August D) 30 August Answer - D National Small Industry Day 2021 is on August 30. The day is celebrated to make the small scale business sector stronger and promote their well being. The society as a whole looks forward to the business sector and promotes the small scale industry. Small scale industries are those businesses that are sent out on a small scale and are usually run with the aid of local artisans and workers. Small Scale Industries is an industrial project with decided assets in investment plants and tools. This investment goal changes from time to time by the government. Small scale businesses and cottage industries have worked a vital part in the Indian economy. The best quality gains have been produced in the base and cottage manufacturers of India. Although this area like other Indian businesses experienced a huge drop in British rule, it has grown at a very fast step after independence. Q.The ANANDA Mobile app has been launched by which organisation? A) LIC C) RBI B) SBI D) SEBI Page 3 Follow us: Official Site, Telegram, Facebook, Instagram, Instamojo Answer - A Life Insurance Corporation of India (LIC) has introduced a new mobile application for its agents and intermediaries to facilitate the on boarding of prospective customers. -

Current Affairs Q&A
Current Affairs Q&A PDF Current Affairs Q&A PDF 2019 Contents Current Affairs Q&A – June 2019 ......................................................................................................................... 2 INDIAN AFFAIRS ............................................................................................................................................. 2 INTERNATIONAL AFFAIRS ......................................................................................................................... 49 BANKING & FINANCE .................................................................................................................................. 75 BUSINESS & ECONOMY ............................................................................................................................ 103 AWARDS & RECOGNITIONS..................................................................................................................... 119 APPOINTMENTS & RESIGNS .................................................................................................................... 135 ACQUSITIONS & MERGERS ...................................................................................................................... 154 SCIENCE & TECHNOLOGY ....................................................................................................................... 156 ENVIRONMENT ........................................................................................................................................... 164 SPORTS -
Geschichte Des Schachlehrens
Geschichte des Schachlehrens − Ein kurzer internationaler Überblick − Franz Reisgis 2021 Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ............................................................................................................ 3 2 Einleitung ....................................................................................................... 4 3 Geschichte des Schachideen und Schachlehrens ........................................ 5 4 Frühzeit des Schachspiels ............................................................................. 7 5 Das Spiel mit den neuen Regeln ................................................................... 8 6 18. Jahrhundert: Philidor (François-André) und Frankreich ............... 14 7 Modena Schule ............................................................................................ 25 8 Frühe Entwicklung der Schachdidaktik (bis zum 20. Jahrhundert) .... 27 9 Englische Schule .......................................................................................... 33 10 Die romantische Epoche ............................................................................. 35 11 Systematische Ideen im Schach ................................................................. 37 12 Die hypermoderne Revolte ......................................................................... 48 13 Die „Russische/Sowjetische Schachschule“ .............................................. 52 14 Die Indische Schachschule ......................................................................... 67 15 Die Chinesische Schachschule -

Current Affair Quiz – May 23, 2018
Current Affair Quiz – May 23, 2018 1. Who will become the first female president of the New York Stock Exchange (NYSE)? A. Clara Zetkin B. Stacey Cunningham C. Adena Friedman D. Navanethem Pillay Answer: B 2. The Madhya Pradesh government has launched ‘My MP Rojgar Portal’ as part of which programme to provide jobs to youths? A. Pahal B. Udaan C. Savera D. Ujjala Answer: A 3. Who has become the champion of the 3rd Kolkata Open International Grandmasters Chess Tournament? A. Srinath Narayanan B. Dibyendu Barua C. Shyam Sundar M D. Deep Sengupta Answer: A 4. Which city to host the 5th edition of Kalinga literary festival 2018? A. Kalahandi B. Bhubaneswar C. Cuttack D. Paradip Answer: B 5. Dr Hemu Adhikari, who passed away recently, was the noted personality from which field? A. Sports B. Journalism C. Film Industry D. History Answer: C 6. Who has won the prestigious 2018 Man Booker International Prize for fiction? A. Ahmed Saadawi B. Han Kang C. Virginie Despentes D. Olga Tokarczuk Answer: D 7. Which state government has recently introduced a new scheme to help the landless labourers among the Scheduled Castes to acquire agricultural land? A. Goa B. Gujarat C. Uttar Pradesh D. Maharashtra Answer: D 8. Which city is hosting the Smart Cities India 2018 Expo? A. New Delhi B. Pune C. Jaipur D. Indore Answer: A 9. Which state government has launched ‘Nidaan’ software for disease monitoring? A. Rajasthan B. Kerala C. Andhra Pradesh D. Odisha Answer: A 10. The 2018 National Anti Terrorism Day (NATD) is celebrated on which date in India? A. -

A History of Chess
_~HE FIDELIT'0~ HESS ASTE Table of Contents 1. Let's Play Chess ........... ................ 3 (Provided by the U.S. Chess Federation. It's your official Introduction to the play of the game. If you already know how to play chess. you may wan t to skip this section.) 2 . A History of Chess ......................... 9 (Everyth ing you ever wanted to know. a nd more, about how the game came to be.) 3. World Champions and Their Play.... 12 (The inside story about the greatest "Wood Pushers' in the world - and the nuttiest.) 4 . Chess and Machines ..................... 28 (Trace your chess-playin g computer's antecedents back to Maelzel' s Turk, a famous trick Inven ted in 1763.) 5 . Library of Classic Games ............... 33 (Here's a fascinating collection of 11 0 hard fo ught games as played by the greatest masters in h istory. The Ch essmaster 2 100 will replay th em for you on comman d.) 6 . Bralnteasers ................................ 51 (Some instructive problems th at may teach you a few sneaky tricks.) 7 . Algebraic Notation ....................... 53 (e4. Nxf3 ... what's it all about? Chess shorthand explained.) Copyright © 1988 The Software Toolworks. Printed In U.S.A. by Priority Software All Righ ts Reserved. Packaging. Santa Ana, California. 3 Let's Play Chess The Pieces Chess is a game for two players. one with White always moves first. and then the the "White" pieces and one with the players take turns movlng. Only one "Black" - no matter what colors your set piece may be moved at each turn (except actually uses. -
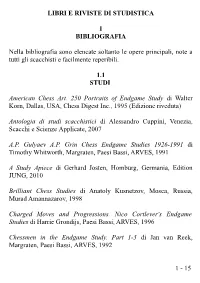
Mattison's Chess Endgame Studies Di Timothy Whitworth, St
LIBRI E RIVISTE DI STUDISTICA 1 BIBLIOGRAFIA Nella bibliografia sono elencate soltanto le opere principali, note a tutti gli scacchisti e facilmente reperibili. 1.1 STUDI American Chess Art. 250 Portraits of Endgame Study di Walter Korn, Dallas, USA, Chess Digest Inc., 1995 (Edizione riveduta) Antologia di studi scacchistici di Alessandro Cuppini, Venezia, Scacchi e Scienze Applicate, 2007 A.P. Gulyaev A.P. Grin Chess Endgame Studies 1926-1991 di Timothy Whitworth, Margraten, Paesi Bassi, ARVES, 1991 A Study Apiece di Gerhard Josten, Homburg, Germania, Edition JUNG, 2010 Brilliant Chess Studies di Anatoly Kusnetzov, Mosca, Russia, Murad Amannazarov, 1998 Charged Moves and Progressions. Nico Cortlever's Endgame Studies di Harrie Grondijs, Paesi Bassi, ARVES, 1996 Chessmen in the Endgame Study. Part 1-3 di Jan van Reek, Margraten, Paesi Bassi, ARVES, 1992 1 - 15 Chess Studies and End-Games di Bernhard Horwitz e Josef Kling, Zurigo, Svizzera, Edition OLMS AG, 1986 (Ristampa della II edizione del 1889) Chess Study Composition di Emilian Dobrescu, Amsterdam, Paesi Bassi, ARVES, 1999 54 studi scacchistici (1947-1957) di Enrico Paoli, Reggio nell'Emilia, edizione a spese dell'autore, 1959 Collection of Chess Studies. With a Supplement on the Theory of the End-Game of two Knights against Pawns di Alexis A. Troitzky, Zurigo, Svizzera, Edition OLMS AG, 1985 (Ristampa dell'edizione del 1937) Curiosites tactiques des finales di Vitaly Halberstadt, Parigi, Francia, a cura dell'Autore, 1954 DECEPTIVE SIMPLICITY di Leopold Mitrofanov e Vladimir Fyodorov, -

Skakbladet MEDLEMSBLAD for DANSK SKAK UNION 2017-3
SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSK SKAK UNION 2017-3 ENEN KUNSTNERKUNSTNER KOMKOM FORBIFORBI Indhold ISSN 0037-6043 Leder • 3 Online: ISSN 2246-5774 Kunsten sejrede i Helsingør • Lars Schandorff 4 113. årgang, nr. 3-2017. Aktuel taktik • Jacob Aagaard 18 Udgivet af Dansk Skak Union. Nemesis i Norge • Lars Schandorff 19 Afslappet hævn • Peter Heine Nielsen 24 Redaktion: Lars Schandorff og Jan Løfberg Larsens jubelår • Jan Løfberg 30 att. Løfbergs Forlag Brættet rundt • 44 Svend Vonveds Vej 15 NM – liiige ved og næsten • Mads Hansen 46 2300 København S. Storværk om svensk skak • Claes Løfgren 54 Email: [email protected] Begynderskak • Carsten Hansen 57 Indsendelsesfrist til nr. 4 En passant…! Problemskak • Steffen Slumstrup 62 Deadline 1. november 2017 På opdagelse i kongeriget • Allan Stig Rasmussen 63 Udkommer medio december 2017 To drenge, et spil, et eventyr • Jesper Thybo 66 Uopfordret materiale aftales med redaktionen. Pokalturneringen • Kåre Kristensen 67 Seniorrækken • Finn Nøhr 69 Abonnement og ekspedition Nyt fra DSU • Poul Jacobsen 71 Danmark kr. 250 kr. pr. år inkl. moms Strategiske koncepter • Jacob Aagaard 72 og forsendelse. Udlandet: kr. 350 år. år, inkl. Den Lange • Henrik Mortensen 77 forsendelse. Skak og sjov • Marie Frank 80 Bestilles hos Dansk Skak Unions kasse- Nekrolog • Kaare Vissing Andersen 84 rer (se nederst på siden). Kommende turneringer • 85 Grafisk design og produktion En passant! • Steffen Slumstrup 86 John Ovesen / Baghus Brættet rundt • 87 Aktuel taktik. Løsninger • Jacob Aagaard 88 Tryk Brættet rundt • 89 Bialostockie Zaklady Graficzne S.A. Al. 1000-lecia P.P. 2 Fra den tyske liga • Peter Heine Nielsen 90 15-111 Bialystok – Polen Sinquefield Cup • 92 Forsiden: Baadur Jobava satte farve på Xtracon Chess Open. -

New Zealand Chess Magazine of the New Zealand Chess Federation (Inc) July 2016 Volume 43 Number 3
New Zealand Chess Magazine of the New Zealand Chess Federation (Inc) July 2016 Volume 43 Number 3 Ben Hague wins the Trusts Open in Style Official publication of the New Zealand Chess Federation (Inc), Published A Cornucopia quarterly; January, April, July, October This issue features a wealth of quality content. The Trusts Open is New Zealand's All games available electronically at largest weekend tournament and Bob www.nzchessmag.com Smith's report includes game annotations by impressive tournament winner Ben Please send all reports, letters and other Hague. There's more top quality analysis contributions to the Editor at from Scott Wastney and Roger Chapman [email protected]. Send subscriptions takes us deep into another superb enquiries to [email protected]. correspondence game from the past.. Editorial But wait there's more! I am very proud of Editor: Bill Forster. our top notch columnists and Herman van Columnists: Scott Wastney, Herman van Riemsdijk and Linden Lyons are both on Riemsdijk, Linden Lyons. top form. Look out for the second part of Proofreader: Ian Sellen. Herman's comprehensive survey of an important basic endgame next time. Annual Subscription Rates NZ: $24.00 plus postage $4.00 total $28.00 Regular contributors Ross Jackson and International: NZD 24.00 plus postage Russell Hosking bring a lighter touch to NZD 12.00. Send cheques to NZCF at the round out this quarter's issue. address below or check nzchessmag.com for online payment options. Contents Advertising Rates Full page $50.00 3 Hurricane Hague Half Page Horizontal $30.00 Bob Smith NZCF Contact Details 16 Upper Hutt Rapid New Zealand Chess Federation (Inc) 17 Book Review PO Box 216, Shortland Street,Auckland Ross Jackson The NZCF Website is a superb resource for 20 Remembering Roger Court all aspects of competitive chess in NZ Russell Hosking including a chess calendar and full results 21 Correspondence Memories of all significant tournaments. -

7+-+-+-+P' 6-Tr-+-+-Zp& 5+-Sn-+K+-% 4-+P+-+-+$ 3Zp-+-Mk-+-# 2-+-+L+-+" 1+-+-+-+-! Xabcdefghy
Die Schwalbe 2017-2018 . International Tourney for Studies . The periodical Die Schwalbe published 33 chess endgame studies in the year 2017 (14 compositions) and in the year 2018 (19 compositions). 22 authors participate in the informal tourney; the composers came from 14 countries. Thanks to Michael Roxlau (Germany), the Tournament Director, and to clever readers of Die Schwalbe for their help to the Judge for checking the anticipations and the correctness of the works. The anticipations are not much taken into consideration when starting positions accompanied by original and interesting introductory play are different from structures previously published. Therefore well-known final positions or well-known structures are often put in evidence in the award: moreover, in any case, all experienced composers will easily find these similarities … Assessment of studies according to correctness, difficulty, artistic impression and personal taste. The following studies have minor duals that affect the overall impression: 17245 twin B: inversion of moves, both 13.Rd4 d2 14.Kf2 and 13.Kf2 d2 14.Rd4 go well; 17380 twin B: also 9.Kf5 wins; 17378: also 7.Kc2 wins (correction: add a Black pawn “b2 “); 17630 inversion of moves: line A) both 4.R:e2+ B:e2 5.h:g7 b1Q 6.g8Q and 4.h:g7 b1Q 5.R:e2+ B:e2 6.g8Q go well. Partial anticipations were found and some of them are mentioned in the award. The tournament was organized in two sections: win studies and draw studies. Win studies . 1st Prize: Mario Guido Garcia (Salta, Argentina) 17444 XABCDEFGHY 8-+-+-+-+(