MÜHLEN in Überackern
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Historisches Innviertel Mittelalter Durch Den Salzhandel Zu Einem Handelszentrum Aufgestie Mit Abstechern Nach Bayern Gen War
2 1 3 1 Stift Reichersberg © INTERFOTO / Alamy 2 Ibmer Moor © imageBROKER / Alamy 3 Schärding, Silberzeile © Animaflora PicsStock / Alamy Bezirksstadt in den Blick, das Barockjuwel Schärding, das bereits im Historisches Innviertel Mittelalter durch den Salzhandel zu einem Handelszentrum aufgestie Mit Abstechern nach Bayern gen war. Der frühere Reichtum der Stadt zeigt sich an pastell farbenen Fassaden, die auf mittelalterliche Zunftfarben zurückgehen. Besonders Sie werden überrascht sein, wie viele Schätze diese schön ist die „Silberzeile“ genannte Häuserfront am Oberen Stadt historische Grenzregion für Sie bereit hält. Unübersehbar platz. Durch das Wassertor, das früher die Wassermassen zurückhalten und unüberhörbar ist, dass das sanfthügelige Innviertel bis sollte, gelangen wir auf die Innterrasse mit schönem Blick auf den 1779 zu Bayern gehörte. Und dass die Lebensader Inn die Inn. Wir spazieren ein paar Treppen bergauf zum Schlosspark und zur Region wirtschaftlich und kulturell beflügelte. Orangerie. Richtung Süden erreichen wir Wernstein sowie den Frei sitz Zwickledt hoch über dem Inn, Wohnsitz und Atelier des Künstlers und Schriftstellers Alfred Kubin. Durch die Laune der Geschichte ist 1. Tag: Wien - St. Pölten - Linz - Wels - Pramet - Ried im Innkreis. das Wohnhaus des Künstlers mit Ausstattung nach seinem Tod 1959 Abfahrten lt. Fahrplan NORDWEST 3 (Seite 2). Bahnfahrt mit der original erhalten geblieben. Bereits wieder auf dem Weg nach Ried WEST bahn ab Wien und Niederösterreich bzw. Salzburg nach lassen wir die Raaber Kellergröppe nicht aus. Der Kulturschatz war Wels. Ab Linz geht es mit dem Bus über Wels Richtung Ried im Inn erst jüngst Landessieger bei 9 Plätze, 9 Schätze 2020. Entlang eines kreis. Nahe Pramet im hübschen Dorf Großpiesenham besuchen stimmungsvollen Hohlweges sind 26 Keller, ursprüngliche Erdkeller, wir das Geburtshaus des Mundart dichters und Verfassers der oö. -

Naturraumkartierung Oberösterreich
Naturraumkartierung Oberösterreich Landschaftserhebung Gemeinde Hochburg-Ach natur raum Naturraumkartierung Oberösterreich Endbericht Naturraumkartierung Oberösterreich Landschaftserhebung Gemeinde Hochburg-Ach Endbericht Kirchdorf an der Krems, 2008 Landschaftserhebung Hochburg-Ach Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich: Mag. Günter Dorninger Projektbetreuung Landschaftserhebungen: Mag. Günter Dorninger EDV/GIS-Betreuung Mag. Günter Dorninger Auftragnehmer: DI Andrea Lichtenecker Zeillergasse 1/435 1160 Wien Bearbeiter: DI Andrea Lichtenecker im Auftrag des Landes Oberösterreich, Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ Fotos der Titelseite: Foto links: Schilfbestand am Talboden der Salzach Foto rechts: Hochburg Fotonachweis: Alle Fotos: DI Andrea Lichtenecker Redaktion: AG Naturraumkartierung Impressum: Medieninhaber: Land Oberösterreich Herausgeber: Amt der O ö. Landesregierung Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich 4560 Kirchdorf an der Krems Tel.: +43 7582 685 533 Fax: +43 7582 685 399 E-Mail: [email protected] Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger Herstellung: Eigenvervielfältigung Kirchdorf a. d. Krems, Oktober 2008 © Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten natur raum 1 1 Naturraumkartierung Oberösterreich Landschaftserhebung Hochburg-Ach Inhaltsverzeichnis 1 VORBEMERKUNGEN 4 1.1 Allgemeines 4 1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes 5 1.2.1 Lage 5 1.2.2 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und -

Innviertel Vizepräsident AI I
Innviertel Vizepräsident AI i. R. Herbert Nösslböck der Vorstellung der Geschichte sprachen zum Hintergrund des BEZIRK BRAUNAU der Friedenskapelle in Teich- Weltfriedenstags. Beim gemein- stätt ging man gemeinsam über samen Abschluss zeigten sich alle Bezirksobmann Michael KENDLBACHER den Wiesenweg zur Andacht mit Ehrengäste sowie Bürgermeister- Bez.-Kurat Martin Muigg in die sprecher Bgm. Franz Zehentner BEZIRKSLEITUNG BRAUNAU Kirche in Heiligenstatt. Dort be- (Kirchberg) und seine Kollegen richtete BObm. Michael Kendl- Bgm. Josef Sulzberger (Perwang), bacher über die Spendenaktion Bgm. Christoph Weitgasser (Je- Wir sind Kameraden und übergab die Spende an die ging), Bgm. Albert Troppmair Kameraden der Feuerwehr. Nach (Burgkirchen) und Hausherr Der OÖKB des Bezirks Braunau dem Sepp Kerschbaumer Sozi- der folgenden Friedensandacht Bgm. Erich Rippl (Lengau) von hat eine Spendenaktion für die alfonds auf 5.000 Euro auf. Die hielten die Kameraden Bezirks- der gehaltvollen Feier des KB Opfer der Sturmkatastrophe in Spende ist am 22. September bei hauptmann Dr. Georg Wojak, Braunau begeistert. Ein Grund Frauschereck, Gemeinde St. Jo- der Feier zum Weltfriedenstag in LAbg. Bgm. Erich Rippl und der mehr auch 2018 wieder eine Feier hann am Walde, gestartet. Am Teichstätt von BObm. Michael Obmann des Friedensdialogs zum Weltfriedenstag einzupla- 18. August hat dort beim Feuer- Kendlbacher an Bezirksfeuer- Moosdorf, Josef Bachleitner, An- nen. wehrfest eine Sturmböe binnen wehrkommandant Josef Kaiser Sekunden das Festzelt wegge- übergeben worden. Echte Ka- rissen. Zwei Menschen wurden meradschaft war und ist niemals getötet, zahlreiche weitere zum ein Lippenbekenntnis. Sie muss FELDKIRCHEN BEI MATTIGHOFEN Teil schwer verletzt. Die Kame- gelebt werden. Sie hilft, wo Hilfe raden des OÖKB fühlen sich geboten ist. -

The Marshall Plan in Austria 69
CAS XXV CONTEMPORARY AUSTRIANAUSTRIAN STUDIES STUDIES | VOLUME VOLUME 25 25 This volume celebrates the study of Austria in the twentieth century by historians, political scientists and social scientists produced in the previous twenty-four volumes of Contemporary Austrian Studies. One contributor from each of the previous volumes has been asked to update the state of scholarship in the field addressed in the respective volume. The title “Austrian Studies Today,” then, attempts to reflect the state of the art of historical and social science related Bischof, Karlhofer (Eds.) • Austrian Studies Today studies of Austria over the past century, without claiming to be comprehensive. The volume thus covers many important themes of Austrian contemporary history and politics since the collapse of the Habsburg Monarchy in 1918—from World War I and its legacies, to the rise of authoritarian regimes in the 1930s and 1940s, to the reconstruction of republican Austria after World War II, the years of Grand Coalition governments and the Kreisky era, all the way to Austria joining the European Union in 1995 and its impact on Austria’s international status and domestic politics. EUROPE USA Austrian Studies Studies Today Today GünterGünter Bischof,Bischof, Ferdinand Ferdinand Karlhofer Karlhofer (Eds.) (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS UNO PRESS innsbruck university press Austrian Studies Today Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 25 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2016 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. -

Stadtpfarrer Von Braunau Am Innmanfred Brandl
© Oberösterreichische Heimatblätter Heraasgegeben vom Landeslnstitai für Volksbildung und Heimatpflege In Oberösterreidb; landeskulturdirektionLeiter: W. Hofrat Oberösterreich; Dr. Aldemar download www.ooegeschichte.atSdilffkom. ' 32. Jahrgang (1978) Heft 3/4 INHALT Hermafin Kohl: Gesteine und Landformen als Marksteine aus der Erdgeschichte des Innviertels...............................329 Eduard Kriechbaum (t) : Bauernhof und Bauernhaus. Landschaftsbilder des Kreises Braunau—Zwei unveröffent lichte Beiträge zur Kunsttopographie des Bezirkes Braunau. Mit einem Vorwort von Aldemar W. M. Schiffkorn 146 Peter Weichhart: Naturraumbewertung und Siedlungs entwicklung. Das räumliche Wachstum ausgewählter Sied lungen des politischen Bezirkes Braunau am Inn im Ver gleich mit dem Naturraumpotential ihrer Standorte . 171 Wolfgang Kern: Munderfing am Kobemaußerwald. Ein fremdenverkehrsgeographischer Beitrag ...... 209 Harry Slapnicka : Wie nach 114 Jahren die „Innviertler Schulden" beglichen w urden......................................... 216 Hans Rödhammer : Die Pröpste des ehemaligen Augu stiner-Chorherrenstiftes Suben ..........................224 Hans Hollerweg er : Die Widerstände gegen die gottes dienstlichen Verordnungen Josephs II. in Schärding im Jahre 1790 ......................................... ..... .......................... 249 Manfred B r a n d 1 : Anton Link (1773—1833) — Stadtpfarrer von Braunau am I n n......................................... .... 262 Rudolf Walter L i t s c h e 1 : Johann Philipp Palm - Märtyrer, Nationalheld -

200233 Entdeckerviertel Gastronomieverzeichnis.Indd
TRADITION SUCHEN - FRISCHE SCHMECKEN OBERÖSTERREICH ° SALZBURG ° BAYERN www.entdeckerviertel.at GASTRONOMIEVERZEICHNIS GASTRONOMIEVERZEICHNIS 1 GAUMENFREUDEN ERLEBEN - HEIMAT SCHMECKEN EINER DER SCHÖNSTEN WEGE, SICH EINER REGION ZU NÄHERN, FÜHRT DURCH KÜCHE UND KELLER. Von gediegen bis „abgefahren“, von rustikal bis „genussvoll neuinterpretiert“ – im Entdeckerviertel erlebt man die „bayerisch-österreichische“ Bandbreite der Genussfreuden. Innviertler Speckknödel, die Mattigtalforelle, Dampfnudeln, Weißwürste mit Brezen, Schweinshaxn und Obatzer – im Entdeckerviertel wird Tradition gelebt. Und aus dieser Tradition heraus gibt es eine besondere Liebe zum Aufspüren neuer kulinarischer Pfade. Risotto aus Einkorn, einer alten Getreidesorte, neu interpretiert, oder Spaghetti mit veganem Berglinsen Sugo und als Nachtisch Kokos Panna Cotta. Genießer kommen bei uns in jedem Fall auf ihre Kosten. „Bier“ als Teil der Entdeckerviertel Kultur vereint das Beste aus beiden Ländern. Leidenschaft spielt eine große Rolle beim Bierbrauen! Bei einer Brauereiführung in einer unseren Familiengeführten Traditionsbrauereien kann man diese live miterleben. Tipp: Innovative Spezialbiere aus der Region wie „Gmahde Wiesn“ oder „Männerschokolade“. Ob beim Essen oder Trinken, ob traditionell oder originell, GENUSS wird bei uns allemal großgeschrieben. 2 GASTRONOMIEVERZEICHNIS GASTRONOMIEVERZEICHNIS GAUMENFREUDEN ERLEBEN - HEIMAT SCHMECKEN GENUSS FÜR ALLE SINNE KULINARISCHE ENTDECKUNGEN Das wohl bekannteste GAUMENSCHMAUS aller traditionellen Gerichte, die „Innviertler -

Guide to Historical Ried Open: Tuesday – Friday 9 A
CHURCH SQUARE MAIN SQUARE The church square was not built until 1783, after the old walled church grave - After the total destruction of the old market town in 1364, the new main square was yard and adjoining house gardens were no longer used. positioned closer to the castle. The slightly elongated and curved square re- flects the architectural characteristics of an early Bavarian hall and the facades 1 Parish Church of St Peter and St Paul of the town houses have straight rooflines. Their partly Gothic or early Baroque original architecture was covered with new facades in the 19th century. The main Ried became an independent parish after it split from the mother parish of square is optically divided by the Dietmar Fountain. The lower part of the square Mehrnbach in the 14th century. The Gothic style of the previous building can still had always been a market and until 1872 there was a free-standing building be seen in the base of the church tower and in the buttresses of the presbytery. used for the trade of corn, salt and linen. The market in Ried determined prices The Parish Church of St Peter and St Paul was given its present form between in the region. The wholesale trade reached even as far as Vienna and Nurem- 1720 and 1734. The 73-metre-high spire acquired its present form after cata- berg. There is still a traditional fruit and vegetable market every Tuesday morning. strophic storm damage in 1929. The interior surprises the visitor with the wide barrel vault over the nave, which is uniformly decorated with stucco in the regency style. -

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
01 Franz Xaver Gruber Friedensweg Hochburg 04 Franking – Holzöster am See 10 Badesee Marktl 16 Wallfahrtsstadt Altötting – „Das Herz Bayerns“ 22 Freibad – Braunau am Inn 28 Erlebnispark Voglsam, Schönau Ein Lied geht um die Welt. Aus- Franking /Holzöster am See gilt Direkt vom Innradweg aus ist Altötting ist der bedeutendste Eine Erfrischung für die ganze Die Anlage bietet eine Kartbahn, gehend vom Franz Xaver Gruber als wahrer Geheimtipp für Gäste der idyllisch gelegene Marktler Marienwallfahrtsort Bayerns. In © Blum Familie, ein Beachvolleyballplatz, Bob-Rodelbahn, Ballonfahrten, Gedächtnishaus und entlang der aus Nah und Fern. Geheimnisvolle Badesee zu erreichen. Kühles der Mitte des beeindruckenden Rutschen und Sprungtürme und Fußball-Golf, Abenteuer-Minigolf, © Bernhard Hartl gärtnerisch gestalteten Kontinent- Moorlandschaften und ein ver- Wasser zum Plantschen und aus- barocken Kapellplatzes befindet ein Spielplatz für Kinder - das Kletterpark mit über 1.500 m Seil- © Erlebnispark Voglsam Skulpturenplätze erfährt man Wis- träumter See, der bereits im Mai © Inn-Salzach Tourismus gedehnte Liegewiesen mit Kiosk sich die Gnadenkapelle mit der alles und noch mehr bietet das länge, zahlr. Tiergehege, versch. senswertes über die Verbreitung Franking © Tourismusverband zum Baden einlädt! Wanderbau- und Strandbad lassen an heißen berühmten Schwarzen Madonna: Braunauer Freibad allen Erho- Kinderspielplätze, Barfußwander- des Liedes Stille Nacht. Ein erngolf, Innviertler Traktor Roas, Sommertagen Urlaubsgefühle Ziel unzähliger Pilger, Wallfahrer lungs-, Schatten- und Abküh- weg, Kioske und Biergärten und © Heiner Heine_Tourismusbüro Altötting © Heiner Heine_Tourismusbüro Ausflugserlebniskarte 2 km Rundweg, der Natur und Bier-Bottich-Bad, Radfahren, aufkommen. Der See ist ebenso und Besucher. lungssuchenden im Sommer. vieles mehr... NEUESTE ATTRAK- Kunst auf einmalige Weise Reiten, Kutschenfahrten, im Winter einen Besuch wert. -

2.3. the Austrian Sector of the North Alpine Molasse: a Classic Foreland Basin ^^^ Hans Georg KRENMAYR R^S^Tjtl *T^\V^ *Jfl Vienna
©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at FOREGS '99 - Dachstein-Hallstatt-Salzkammergut Region 2.3. The Austrian sector of the North Alpine Molasse: A classic foreland basin ^^^ Hans Georg KRENMAYR r^s^TjTl *T^\v^ *Jfl Vienna Г-v-^iS Hallstatt _^^y;b~) The North Alpine Molasse extends from the French Maritime Alps to the area of Vienna, where the Alpine nappe pile largely disappears below the intra-orogenic Vienna Basin. The "North Alpine" Molasse extends northeastward from the Danube west of Vienna and farther into the Carpathian Foredeep. The term "molasse" was introduced into the scientific literature by H.B. DE SAUSSURE in 1779. Etymologically it can either be inferred from the latin „mola" (whetstone or grindstone) or from the french "molasse" (slack or very soft), which refers to the widespread occurrence of soft sandstones and loose sands. The Austrian Molasse is of considerable scientific interest due to the occurrence of hydrocarbons, which created the somehow paradox situation, that the subsurface of the basin is partly better known than the surface geology. In recent times special attention has been paid to the Molasse Basin because of its mirror function of Alpine uplift history. Throughout the Austrian sector of the Molasse Basin the southern edge of the Variscan Bohemian Massif forms the northern bordering zone of the Tertiary basin fill. The metamorphic and magmatic basement rocks continue far below the Alpine nappe wedge to at least 50 km behind the northern thrust front. Structural depressions of the basement locally contain relicts of Late Carboniferous (?) to Permian molasse-type sediments of the Variscan orogenic cycle, whereas wide regions of the basement to the west and east of the southward extending so called "spur" of the Bohemian Massif are covered with epi continental Jurassic and Cretaceous sedimentary rocks. -
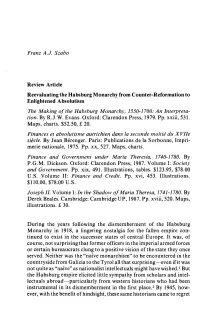
Franz AJ Szabo
Franz A.J. Szabo Review Article Reevaluating the Habsburg Monarchy from Counter-Reformation to Enlightened Absolutism The Making of the Habsburg Monarchy, 1550-1700: An Interpreta tion. By R.J.W. Evans. Oxford: Clarendon Press, 1979. Pp. xxiii, 531. Maps, charts. $52.50, £ 20. Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitii du XV//e siecle. By Jean Berenger. Paris: Publications de la Sorbonne, lmpri merie nationale, 1975. Pp. xx, 527. Maps, charts. Finance and Government under Moria Theresia, 1740-1780. By P.G.M. Dickson. Oxford: Clarendon Press, 1987. Volume L Society and Government. Pp. xix, 491. Illustrations, tables. $123.95, $78.00 U.S. Volume 11: Finance and Credit. Pp. xvi, 453. Illustrations. $110.00, $78.00 U.S. Joseph //.Volume 1: In the Shadow of Maria Theresa, 1741-1780. By Derek Beales. Cambridge: Cambridge UP, 1987. Pp. xviii, 520. Maps, illustrations. £ 30. During the years following the dismemberment of the Habsburg Monarchy in 1918, a lingering nostalgia for the fallen empire con tinued to exist in the successor states of central Europe. It was, of course, not surprising that former officers in the imperial armed forces or certain bureaucrats clung to a positive vision of the state they once served. Neither was the "naive monarchism" to be encountered in the countryside from Galicia to the Tyrol all that surprising-even if it was not quite as "naive" as nationalist intellectuals might have wished. 1 But the Habsburg empire elicited little sympathy from scholars and intel lectuals abroad-particularly from western historians who had been instrumental in its dismemberment in the first place. -

Oachkatzlschwoaf: a Study of Language Choice in Ried Im Innkreis, Austria
Oachkatzlschwoaf: A Study of Language Choice in Ried im Innkreis, Austria David Kleinberg A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Germanic Languages and Literatures. Chapel Hill 2006 Approved by Advisor: Paul Roberge Reader: Helga Bister-Broosen Reader: Laura Janda Reader: Sidney R. Smith Reader: Roland Willemyns © 2006 David Kleinberg ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT David Kleinberg: Oachkatzlschwoaf: A Study of Language Choice in Ried im Innkreis, Austria (Under the direction of Paul Roberge) A statistical analysis of data collected via self-reporting questionnaires and participant observation in Ried im Innkreis, Austria, shows that the speakers in this community typically prefer to speak their local dialect rather than Standard German or colloquial varieties, at a significantly higher frequency in more domains than speakers in other communities of similar size in Austria. Data from Ried im Innkreis are compared with results from Steinegger (1998) and Wiesinger (1989b), in which similar surveys were distributed throughout Austria. Factors that typically correlate with the choice of dialect over colloquial or standard varieties of German in large cities in Austria, such as socioeconomic class, do not play a significant role in Ried im Innkreis due to the small size of the community. The same trends apparent in the rest of the Austria with regard to gender are apparent in Ried. Males report that they speak dialect slightly more often than females, and a decrease in dialect use by females is indicated which corresponds to typical child-raising years and retirement. -

Revision of the Lichen Genus Candelaria (Ascomycota
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Stapfia Jahr/Year: 2014 Band/Volume: 0101 Autor(en)/Author(s): Neuwirth Gerhard Artikel/Article: Revision of the lichen genus Candelaria (Ascomycota, Candelariales) in Upper Austria 39-46 NEUWIRTH • The lichen genus Candelaria in Upper Austria STAPFIA 101 (2014): 39–46 Revision of the lichen genus Candelaria (Ascomycota, Candelariales) in Upper Austria G. NEUWIRTH* Abstract: A first assessment of the distribution and morphology of the revised lichen genusCandelaria in Upper Austria is presented. Candelaria, originally a monospecific genus in Europe, was expanded by separating a second species which shows distinct morphological and genetical characters (C. pacifica). This report summarizes first data and proves an astonishing percental quota of the separated speciesC. pacifica (27.6%) in Upper Austria. Zusammenfassung: Eine erste Einschätzung zur Verbreitung und Morphologie der revidierten Flechten- Gattung Candelaria in Oberösterreich wird vorgestellt. Candelaria, eine ursprünglich monospezifische Gattung in Europa, wurde durch die Abtrennung einer zweiten Art erweitert, die deutliche morphologische und genetische Unterschiede zeigt (C. pacifica). Dieser Bericht fasst die ersten Ergebnisse zusammen und belegt einen erstaunlichen, prozentuellen Anteil der abgetrennten Art (27.6%) C. pacifica in Oberösterreich. Key Words: Candelaria, taxonomy, distribution, Upper Austria. *Correspondence to: [email protected] Introduction author started revising older specimens and collecting new Can- delariaceae. Approximately 28% of the specimens turned out to The small lichen genus Candelaria, comprising eight spe- be Candelaria pacifica, a legitimate reason to introduce the new cies world-wide, represents a well-known and cosmopolitan species in Upper Austria and probably new to Austria.