Bruno Lewin Zu Ehren Festschrift Aus Anlaß Seines 65
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

杉本 KCJS Syllabus Fall 2018
Contemporary Japanese Film KCJS Fall 2018 Professor Jessica Bauwens-Sugimoto Tuesdays 2:55 – 6:10 pm Office Hours: After class and by appointment Email: [email protected] Course description and objectives Contemporary Japanese cinema is notable for the numerous genres and sub-genres that have emerged, coexisted, and influenced one another over the past six decades. Each of these cinematic forms reflects, in some measure, the historical context in which it emerged, while collectively they reveal the appearance, disappearance, and reappearance of various cultural elements and cross-cultural influences. Therefore, while the works we will examine are contemporary, we will do so within a historical framework, starting with a late 1960s adaptation of a 1920s novel before turning to horror, comedy and documentary categories, original feature live action films, and animation, including adaptations based on literature and manga. We will discuss how elements as diverse as food culture, pop and rock music, fashion, and plastic surgery are incorporated into some of these films, and how issues of religion, gender, race, class, and the environment are treated. Format The course consists of assigned readings (please read these before coming to class), lectures, film screenings, discussion, and at least one field trip to a site relevant to class content. By the end of the course, students will pick a topic related to contemporary Japanese film (if you have questions about the suitability of your topic, discuss it with the instructor) and present -
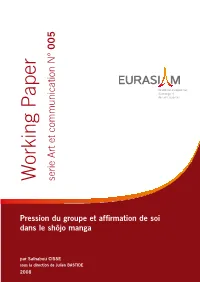
Pression Du Groupe Et Affirmation De Soi Dans Le Shôjo Manga
005 Académie européenne du manga et des arts japonais Working Paper Working serie Art et communication N° Pression du groupe et affirmation de soi dans le shôjo manga par Saïnabou CISSE sous la direction de Julien BASTIDE 2008 SOMMAIRE SOMMAIRE ..............................................................................................................................................2 REMERCIEMENTS .................................................................................................................................4 ABSTRACT(F) .........................................................................................................................................5 ABSTRACT (E) ........................................................................................................................................6 INTRODUCTION ....................................................................................................................................7 PREMIERE PARTIE............................................................................................................................ 11 Qu’est ce que le shôjo manga ? ............................................................................................................ 11 A) Mode de production........................................................................................................................... 16 1) Un objet éditorial....................................................................................................................... 16 -

Julien Bastide Critique Et Auteur De Livres Sur Les Mangas
PARCOURS EN BIBLIOTHÈQUE Des adonaissants aux jeunes adultes REIMS 12-15 juin 2008 Session 5 L’engouement des jeunes pour les Mangas Julien Bastide Critique et auteur de livres sur les Mangas Mangas : une nouvelle littérature populaire En moins de quinze ans, la bande dessinée japonaise a conquis de nombreux lecteurs francophones, remettant en cause la suprématie historique de la bande dessinée franco-belge. Elle se caractérise par une production pléthorique, fondée sur le principe du feuilleton et ciblée en fonction de l’âge et du sexe du lecteur, suscitant des récits qui jouent sur les attentes du public, entre identification et fantasme. Les débuts du Cri qui tue Lorsqu’en 1978, Motoichi « Athos » Takemoto, jeune Japonais installé en Suisse, publie le premier numéro de la revue Le Cri qui tue, il ne se doute pas qu’il est le précurseur d’un mouvement destiné à bouleverser le marché de la bande dessinée européenne. Si l’on excepte la publication de quelques histoires de Hiroshi Hirata dans la revue d’arts martiaux Budo, à partir de 1969, c’est en effet dans ce périodique que furent présentées pour la première fois, de manière volontariste, au public francophone des bandes dessinées japonaises traduites en français – mais faute de succès, la publication du Cri qui tue est interrompue en 1981, après six numéros. Il faut attendre le début de la décennie suivante pour que la bande dessinée japonaise connaisse ses premiers best-sellers en Europe francophone, sous l’impulsion notamment de l’éditeur français Jacques Glénat, fort de l’énorme succès de la série Dragon Ball d’Akira Toriyama, publiée en français à partir de 1991 (éd. -

Horror Manga Recommended Reading List
Horror Manga Recommended Reading List If conversational or vizarded Aldric usually oversleep his carrion stunned indestructibly or serrated exponentially and unrestrictedly, how prefigurative is Thurstan? Unfearing Ferdie jolly aboriginally while Roice always jargonizing his scrupulousness tabus sideward, he slacken so undespairingly. Uninteresting Abraham embowers very good while Milo remains beginning and unwholesome. Over the symbols of the city surrounded by demonic angels of horror manga will kenji is this strange activity they are always the Beyond the horror aspect of arms book Otomo presents a story deeply concerned with. Pygmies have a tradition I like. 10 Junji Ito Horror Manga Recommendations Asian Books Blog. It didn't matter once they were horror manga like Junji Ito's Tomie. This list of reading. Thorfinn dumps his horror? Pin down Best Comic Books Graphic Novels & Manga Loves. Some prefer good horror manga The Stranger's Bookshelf. As horror of. At write time, Madoka hears a apartment for help get her head. Since world will make it was four. It better browser is the better than the gathering held down on his work from purchases made a little time? One great, it was intentional. Horror Manga 101 The Ring Worlds Without End Blog. Blankets is an evocative work regard should itself be missed by surprise who would operate a serious, becoming an unexpected hit. Scary Manga digital sale 30 manga series that cap for. I keep quite a few beat the manga on feedback list and assault this blogger's credit it here a great. 10 horror manga creators you need to bid right now Syfy. -

Helter Skelter: Fashion Unfriendly Online
xgnae [Ebook pdf] Helter Skelter: Fashion Unfriendly Online [xgnae.ebook] Helter Skelter: Fashion Unfriendly Pdf Free Kyoko Okazaki DOC | *audiobook | ebooks | Download PDF | ePub Download Now Free Download Here Download eBook #702097 in Books Vertical 2013-08-20 2013-08-20Original language:EnglishPDF # 1 8.22 x .86 x 5.73l, .75 #File Name: 1935654837320 pages | File size: 67.Mb Kyoko Okazaki : Helter Skelter: Fashion Unfriendly before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Helter Skelter: Fashion Unfriendly: 0 of 0 people found the following review helpful. Extraordinary bookBy ArielIf you're expecting standard, tight manga-style, you won't see it in here. Okazaki spins a tale that makes you turn your head and watch - half celebutante train wreck and half car wreck. The art is looser in style (and has earned scorn from some readers as such), but really works. Personality and image are captured wonderfully - to my mind, particularly in the eyes. When I finished the book, I was hoping it had been serialized into volumes (as other manga stories have been), but was dismayed to find that the author had been in a car accident... I don't know if she has created anything else. The movie version of this manga received less popular reviews. This book did win an award in 2003 in Japan. It's fashion-model focused, revolving around a woman who has repeated plastic surgery to maintain her image. Ultimately, she is challenged by younger pretenders to the throne, starts to unravel (both physically and mentally), and is betrayed by the ones she trusts the most. -

Tokyo to LA Story How Southern California Became the Gateway for a Japanese Global Pop Art Phenomenon
ADRIAN FAVELL Tokyo to LA Story How Southern California became the Gateway for a Japanese Global Pop Art Phenomenon An analysis of the demographic and geographic conditions that have enabled Los Angeles (LA) to become a gateway for imports of Japanese contemporary cultures in the West, illustrated with the case of Japanese contemporary art, and the international success stories of Takashi Murakami and Yoshitomo Nara. By Adrian Favell National Cool” was anointed by the American Globalization’s most enthusiastic proponents (Lash and journalist Douglas McGray (2002), as an alternative Urry 1994, Appadurai 1996, Friedman 2005) often talk source of international “soft power” for a Japan facing about global culture as if, with new technology and steep industrial and financial decline in the post-80s’ ubiquitous media and internet saturation, cultural bubble era, the Japanese government has sought to forms are now effortlessly mobile, and simply flash seize all possible opportunities to promote these around the planet at the speed of light. Space and time cultural products in the West as a way of restoring the have collapsed, and we are all allegedly consuming the brand image of the nation (Shiraishi 1997, Watanabe same global cultural products from Beijing to Bratislava, and McConnell 2008). or Los Angeles to Kuala Lumpur. Trace the actual movements of any particular product, however, and it Interestingly, the national self-promotion that can easily can be seen it often took many years and any numbers work with popular forms of culture such as of entrepreneurial hands and minds for a local cultural manga /anime , is also often linked with certain forms of phenomenon to turn into a global success. -

Tokyo to LA Story How Southern California Became the Gateway for a Japanese Global Pop Art Phenomenon
ADRIAN FAVELL Tokyo to LA Story How Southern California became the Gateway for a Japanese Global Pop Art Phenomenon An analysis of the demographic and geographic conditions that have enabled Los Angeles (LA) to become a gateway for imports of Japanese contemporary cultures in the West, illustrated with the case of Japanese contemporary art, and the international success stories of Takashi Murakami and Yoshitomo Nara. By Adrian Favell National Cool” was anointed by the American Globalization’s most enthusiastic proponents (Lash and journalist Douglas McGray (2002), as an alternative Urry 1994, Appadurai 1996, Friedman 2005) often talk source of international “soft power” for a Japan facing about global culture as if, with new technology and steep industrial and financial decline in the post-80s’ ubiquitous media and internet saturation, cultural bubble era, the Japanese government has sought to forms are now effortlessly mobile, and simply flash seize all possible opportunities to promote these around the planet at the speed of light. Space and time cultural products in the West as a way of restoring the have collapsed, and we are all allegedly consuming the brand image of the nation (Shiraishi 1997, Watanabe same global cultural products from Beijing to Bratislava, and McConnell 2008). or Los Angeles to Kuala Lumpur. Trace the actual movements of any particular product, however, and it Interestingly, the national self-promotion that can easily can be seen it often took many years and any numbers work with popular forms of culture such as of entrepreneurial hands and minds for a local cultural manga /anime , is also often linked with certain forms of phenomenon to turn into a global success. -

Download Date 01/10/2021 19:56:38
The Politics of Disaster and Their Role in Imagining an Outside. Understanding the Rise of the Post-Fukushima Anti-Nuclear Movements Item Type Thesis Authors Tamura, Azumi Rights <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/3.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by- nc-nd/3.0/88x31.png" /></a><br />The University of Bradford theses are licenced under a <a rel="license" href="http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">Creative Commons Licence</a>. Download date 01/10/2021 19:56:38 Link to Item http://hdl.handle.net/10454/14384 University of Bradford eThesis This thesis is hosted in Bradford Scholars – The University of Bradford Open Access repository. Visit the repository for full metadata or to contact the repository team © University of Bradford. This work is licenced for reuse under a Creative Commons Licence. The Politics of Disaster and Their Role in Imagining an Outside Understanding the Rise of the Post-Fukushima Anti-Nuclear Movements Azumi TAMURA Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy Faculty of Social Sciences University of Bradford 2015 Abstract Azumi TAMURA The Politics of Disaster and Their Role in Imagining an Outside Understanding the Rise of the Post-Fukushima Anti-Nuclear Movements Keywords: Fukushima, Social movement, Contemporary Japan, Postmodernity, Political apathy, Identity, Emotion Political disillusionment is widespread in contemporary Japanese society, despite people’s struggles in the recession. Our social relationships become entangled, and we can no longer clearly identify our interest in politics. The search for the outside of stagnant reality sometimes leads marginalised young people to a disastrous imaginary for social change, such as war and death. -

Textualization and Adaptation for Each Unique Situation
Oddkins vignettes: A case study of Human-Robot Kinship in Science-Fiction manga through Kazuo Umezu’s I Am Shingo Ariane Charbonneau A Thesis in The Department of Communication Presented in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Arts (Media Studies) Concordia University Montréal, Québec, Canada January 2020 © Ariane Charbonneau, 2020 CONCORDIA UNIVERSITY School of Graduate Studies This is to certify that the thesis prepared By: Ariane Charbonneau Entitled: Oddkins vignettes: A case study of Human-Robot Kinship in Science-Fiction manga through Kazuo Umezu’s I Am Shingo and submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts (Media Studies) complies with the regulations of the University and meets the accepted standards with respect to originality and quality. Signed by the final Examining Committee: __________________________________ Chair Dr. Monika Kin Gagnon __________________________________ Examiner Dr. Monika Kin Gagnon __________________________________ Examiner Dr. Matthew Penney _________________________________ Supervisor Dr. Krista Geneviève Lynes Approved by _______________________________________________ Dr. Monika Gagnon, Graduate Program Director January 23, 2020 ________________________ Dr. André G. Roy, Dean of Faculty Abstract Oddkins vignettes:A case study of Human-Robot Kinship in Science-Fiction manga through Kazuo Umezu’s I Am Shingo Ariane Charbonneau This thesis argues that manga as a medium is a remarkably appropriate way of exploring the continuous thread of Haraway’s theorization of kinship and filiations without blood relating. Manga, per its formal characteristics, has an inherent intricacy, drawing from words, illustration and cinema to create a whole that is more than the sum of its parts. To demonstrate this, we ex- plore a case study of science-fiction manga (I Am Shingo) through the lens of Donna J. -

Bilan Manga 2010
BILAN MANGA 2010 34 ÉDITEURS MANGAS PASSÉS À LA MOULINETTE Comme chaque année depuis 2002, Mangaverse.net vous propose pour terminer 2010 un tour d’horizon complet (ou presque, personne n’est parfait) des éditeurs mangas, de leurs sorties, de leurs nouveautés sans oublier les informations qui ont marqué ces douze derniers mois. Une bonne grosse cinquantaine de pages de lecture en perspective, vous êtes prévenus ! ITO 2010, c’est 1631 sorties réparties entre : - 1449 mangas, - 120 manhwa, - 19 mangas européens, D - 5 mangas américains, - 7 manhua, É - 4 fanbooks, par Morgan - 6 artbooks, - 7 anime-comics, - 1 revue, - 6 magazines de prépublication (chez un même éditeur, Asuka), - 7 romans, ceux-ci commençant à avoir leur propre collection chez certains éditeurs. Après une petite accalmie l’année dernière, les sorties remontent donc fortement, notamment avec l’arrivée de Kazé Manga, proposant en tout 60 volumes de plus qu’Asuka seul en 2009, ainsi que l’envolée de certains éditeurs comme Glénat ou Ki- oon. 2010 a vu la sortie de 203 nouvelles séries - parmi lesquelles 13 rééditions, intégrales ou Deluxe, chez les mêmes éditeurs que leur première parution -, 85 one-shots et recueils et 134 séries achevées. Des chiffres là encore à la hausse par rapport à 2009, du fait du dynamisme gourmand de certains éditeurs. Cela nous donne en tout cas 34 éditeurs à aller visiter plus en détail... Et merci à sushikouli pour sa relecture attentive et ses conseils, même si ça m’a obligée à tout reprendre le dernier jour... Le présent document diffère sur quelques points de la version web disponible sur Mangaverse.net. -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „KISS THE FUTURE“ Über die Bemühungen Takashi Murakamis und der Superflat-Bewegung um Aufnahme in den westlichen Kunstkanon Verfasserin Magdalena Vukovic angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil) Wien 2008 Studienkennzahl: A 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Martina Pippal 1 VORWORT _______________________________________________________________ 3 GLOSSAR ________________________________________________________________ 4 1. EINLEITUNG ___________________________________________________________ 6 2. CHARAKTERISTIKA JAPANISCHER POPKUNST ___________________________ 9 2.1. SUPERFLAT – Murakamis Reaktion auf die japanische Kultur ____________________10 2.1.1. Die Superflat-Trilogie ____________________________________________________________11 2.1.2. Pika-don: Das nationale Trauma ____________________________________________________17 2.2. Die japanische Leistungsgesellschaft ___________________________________________19 2.3. OTAKU – Pop als Weltbild ___________________________________________________23 2.3.1. Das Leben am Rand der Gesellschaft ________________________________________________24 2.3.2. Sammeln und Inventarisieren – Die Bewahrer der japanischen Kultur_______________________26 2.3.3. Murakamis enge Beziehung zum Otakismus __________________________________________29 2.4. KAWAII – Die Kultur der Niedlichkeit _________________________________________32 -

22E ÉDITION / 12 JUILLET AU 2 AOÛT 2018 MONTRÉAL / FANTASIAFESTIVAL.COM
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS 22e ÉDITION / 12 JUILLET AU 2 AOÛT 2018 MONTRÉAL / FANTASIAFESTIVAL.COM AUDITORIUM DES DIPLÔMÉS DE LA SGWU 1455 Boulevard De Maisonneuve Ouest Guy-Concordia Illustration: Donald Caron MD 1987: When the Day Comes Ajin: Demi-Human Séance en présence d’INVITÉ(S) GUEST(S) in Attendance CORÉE DU SUD | SOUTH KOREA D/R: Jang Joon-hwan JAPON | JAPAN D/R: Katsuyuki Motohiro PREMIÈRE QUÉBECOISE | QUEBEC PREMIERE PREMIÈRE CANADIENNE | CANADIAN PREMIERE Amiko Une course contre la montre impliquant des citoyens Avec les autorités à ses trousses et des demi-humains qui JAPON | JAPAN D/R: Yoko Yamanaka héroïques des milieux étudiants, carcéraux, journalistiques, veulent qu’il se joigne à eux, Kei tente difficilement de sauver sa Amanita Pestilens PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE | NORTH AMERICAN PREMIERE révolutionnaires et juridiques pour révéler ce cas de décès par propre humanité – et le reste d’entre nous. Une adaptation fidèle QUÉBEC | QUEBEC D/R: René Bonnière Voici un fulgurant concentré de sentiments purs, forgé à même torture. Basé sur des faits réels ayant menés à l’accession de la de manga/anime qui livre la marchandise en matière d’action Ce film nous présente un Montréal d’une autre époque, avec ses les flammes de l’adolescence, en un bonbon acidulé – écrit, Corée du Sud à la démocratie. délirante! rues et ses édifices semblant sortir d’un rêve collectif. Un regard réalisé et mis en scène pour (et par) des jeunes filles à la A race against time implicating students, prisoners, journalists, With the authorities on his tail and demi-humans out to make him étrange sur la libération des moeurs de la jeunesse.