Vauluspadasaelte000411449v0
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TALES of ROMANCE BASED on TALES in the BOOK of ROMANCE EDITED by ANDREW LANG the STORY of ROBIN HOOD. PART I. Many Hundreds of Y
TALES OF ROMANCE BASED ON TALES IN THE BOOK OF ROMANCE EDITED BY ANDREW LANG THE STORY OF ROBIN HOOD. PART I. Many hundreds of years ago, when the Plantagenets were kings, England was so covered with woods, that a squirrel was said to be able to hop from tree to tree from the Severn to the Humber. It must have been very different to look at from the country we travel through now; but still there were roads that ran from north to south and from east to west, for the use of those who wished to leave their homes, and at certain times of the year these roads were thronged with people. Pilgrims going to some holy shrine passed along, merchants taking their wares to Court, Abbots and Bishops ambling by on palfreys to bear their part in the King's Council, and, more frequently still, a solitary Knight, seeking adventures. Besides the broad roads there were small tracks and little green paths, and these led to clumps of low huts, where dwelt the peasants, charcoal- burners, and ploughmen, and here and there some larger clearing than usual told that the house of a yeoman was near. Now and then as you passed through the forest you might ride by a splendid abbey, and catch a glimpse of monks in long black or white gowns, fishing in the streams and rivers that abound in this part of England, or casting nets in the fish ponds which were in the midst of the abbey gardens. Or you might chance to see a castle with round turrets and high battlements, circled by strong walls, and protected by a moat full of water. -
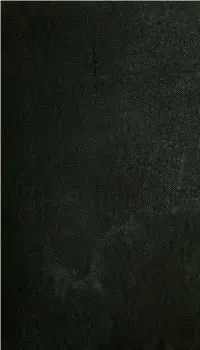
Wayland Smith : a Dissertation on a Tradition of the Middle Ages
p. KENNEDY, ANGLESEA STREET, Tliree doors from College Green. XgamMé^f^ ^ .' WAYLAND SMITH. A DISSERTATION ON A TRADITION OF THE MIDDLE AGES. FROM THE FRENCH OF G. B. DEPPING AND FRANCISQUE MICHEL. WITH ADDITIONS BY S. W. SINGER. AND THE AMPLIFIED LEGEND 13 Y OEHLENSCHLAGER. LONDON: WILLIAM PICKERING. 1847. TO MRS. KINNEAR, WHOSE TRANSLATION FROM OEHLENSCHLAGER FURNISHES THE MOST ATTRACTIVE PORTION, THE FOLLOWING PAGES ARE GRATEFULLY DEDICATED BY HER AFFECTIONATE FRIEND S. W. SINGER. PREFACE. The use which Sir Walter Scott made of this legend in his romance of Kenilworth, has given it universal celebrity, but, inde- pendent of this claim to our attention, it may be considered as one of the most interesting of the old Sagas of the North. The rifacci- mento of it by Adam Oehlenschlager was first written by him in Danish about the year 1800, and he afterwards re- wrote it in Ger- man, from which language the following version has been made. The dissertation appended to it will show how gradually it has been built up, and how skilfully from its fragmentary state the Danish poet has constructed a poetical tale breathing the wild spirit of his native land. A dissertation on a popular tale may at first glance appear to be a trifling thing. Nevertheless, when this tale is of remote origin ; when it has amused the people of the South and of the North, and given occupa- tion to poets, to writers of romance, and to mythologers of various ages ; when it has passed from one language and from one country to another, it is no longer an object to be despised. -

TEUTONIC MAGIC the Magical & Spiritual Practices of the Germanic Peoples
TEUTONIC MAGIC The Magical & Spiritual Practices of the Germanic Peoples By Kveldulf Gundarsson © 1990 by Kveldulf Gundarsson.All rights reserved. Originally published by Llewellyn Publications Inc. This PDF format electronic edition © 2002 by Kveldulf Gundarsson, published by Freya Aswynn. All rights reserved. This document may not be re-sold, reproduced, copied, freely exchanged, or distributed to others via the Internet or by any other means, without permission in writing from Freya Aswynn. No part of this document may be used or reproduced in any manner whatsoever without permission in writing from Freya Aswynn, except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. Published by Freya Aswynn www.aswynn.co.uk The Wisdom of Odhinn Here are written, for those who have the strength to grasp them, the hidden secrets with which our ancestors ruled wind and wave, fire and earth and the minds of men. For nine nights the great god Odhinn hung on the World-Tree, pierced by his own spear, the winds between the worlds blowing cold about him. At last he saw, in a blinding moment of might, the runes written at the great tree’s roots. He took them up: great in power, great in wisdom, growing ever in might and lore from the secret his sacrifice won him. He taught the mysteries of the runes to his children among the human race, and these songs of might were sung and carved on wood and stone from Ger- many to England, to Denmark, Norway, Sweden, and Iceland, wherever the Teutonic peoples walked in their bright paths of battle and hidden wisdom. -

The Franks Casket Speaks Back: the Bones of the Past, the Becoming of England
This is a repository copy of The Franks Casket speaks back: The bones of the past, the becoming of England. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/90151/ Version: Accepted Version Book Section: Karkov, CE (2017) The Franks Casket speaks back: The bones of the past, the becoming of England. In: Frojmovic, E and Karkov, CE, (eds.) Postcolonising the Medieval Image. Routledge , Abingdon, Oxon UK , pp. 37-61. ISBN 9781472481665 https://doi.org/10.4324/9781315232164 © 2017, Routledge. This is an Accepted Manuscript of a book chapter published by Routledge in Postcolonising the Medieval Image on 16 March 2017, available online: https://www.routledge.com/Postcolonising-the-Medieval-Image/Frojmovic-Karkov/p/book/9 781472481665. Uploaded in accordance with the publisher's self-archiving policy. Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ 1 THE FRANKS CASKET SPEAKS BACK: THE BONES OF THE PAST, THE BECOMING OF ENGLAND Catherine E. -

In Search of Traces of the Mandrake Myth – the Etymological, Historical, and Ethnobotanical Roots of Its Vernacular Names
In Search of Traces of the Mandrake Myth – The Etymological, Historical, and Ethnobotanical Roots of Its Vernacular Names Amots Dafni ( [email protected] ) University of Haifa https://orcid.org/0000-0002-9841-1662 Cesar Blanché University of Barcelona: Universitat de Barcelona Salekh Aqil Khatib Institute of Evolution Theodora Petanidou University of the Aegean: Panepistemio Aigaiou Bedrettin Aytaç Ankara University: Ankara Universitesi Ettore Pacini University of Siena: Universita degli Studi di Siena Ekaterina Kohazurova University of Soa Saint Kliment Ohridski: Sojski universitet Sv Kliment Ohridski Aharon Geva-Kleinberger University of Haifa Soli Shahvar University of Haifa Zora Dajic University of Belgrade: Univerzitet u Beogradu Helmut W. Klug University of Graz: Karl-Franzens-Universitat Graz Guillermo Benítez University of Granada Faculty of Pharmacy: Universidad de Granada Facultad de Farmacia Research Article Keywords: Mandragora spp, Plant names, Etymology, Phytonymy Posted Date: June 12th, 2021 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-576883/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License Page 1/42 Abstract Background: Mandrake (Mandragora spp.) is perhaps the most famous medicinal plant in western cultures since Biblical times and throughout written history. In many cultures, mandrake is related to magic and witchcraft, which and is said to have a psychosomatic effect (especially when mandrake contains narcotic compounds) in addition to the pharmacological inuence, as occurs with other narcotic magical plants. Due to its unique properties and related myths, it is not surprising that this plant has many names in many languages. Methods: This paper presents an attempt to reconstruct the etymological, ethnobotanical, and historical and folkloristic roots of 296 vernacular names of Mandragora sp. -
Remarques Preliminaires
CREDITS : Auteur : Oniros Illustration : anonyme Sources : Livres sur les mythes et Wikipédia REMARQUES PRELIMINAIRES : Tout comme le livret principal « Highlander jdra », ce supplément sur les Mythologies de l'humanité a été conçu et écrit pour compléter le matériel fourni dans le jeu précité. Ceci dans une optique ludique sans aucun but lucratif afin de faire évoluer des personnages fictifs créés par les rôlistes intéressés, dans le cadre d'aventures rédigées par leurs soins. Par ailleurs, afin de respecter les droits d'auteur portant sur la franchise, il est utile de rappeler ici qu'à l'instar du jeu lui-même ( non-officiel), ce supplément ne l'est pas non plus, et aucunement lié de quelque façon que ce soit aux détenteurs actuels et exclusifs des droits de ces oeuvres et encore moins un ouvrage édité à titre professionnel. Il s'agit juste d'une production amateur dont l'intention n'est nullement de porter préjudice à quiconque, amateurs, professionnels ou artisans... Il convient donc mieux de considérer tout cela comme un hommage respectueux envers la qualité du travail de chacun de ceux-ci. I-Les mythes gréco-latins : La titanomachie La gigantomachie Achille Héraklès Zeus II-La Mythologie Nordique : Le Ragnarok Les Walkyries Sigird Odin Thor Heimdall III-Légendes celtes : Myrddin IV- Mythes chinois : Les 8 immortels du Tao. V- Légendes de Mésopotamie : Gilgamesh Arhiman I-Les mythes gréco-latins : Quand les immortels apparurent sur terre, ils n'étaient que des réfugiés amnésiques pour la plupart, seuls les Primaux provenant, eux aussi de cet autre monde, avaient la connaissance. Ils se mélèrent aux humains dans un premier temps, puis vint un jour où se brisa l'harmonie, des tensions apparurent entre la première et la seconde génération vivant en Atlantide. -
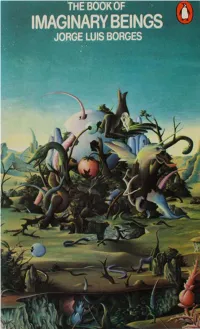
The Book of Imaginary Beings
Penguin Books The Book of Imaginary Beings Jorge Luis Borges was born in Buenos Aires in and was educated in Europe. One of the major writers of our time, he has published many collections of poems, essays, and short stories. In , Borges shared the International Publishers’ Prize with Samuel Beckett. The Ingram Merrill Foundation granted him its Annual Literary Award in for his ‘outstanding contribution to literature’. Recently, he was awarded the degree of Doctor of Letters,honoris causa, from both Columbia and Oxford, and the same year won the fifth biennial Jerusalem Prize.Time has called him ‘the greatest living writer in the Spanish language today’, while theNew York Herald Tribune has described him as ‘unquestionably the most brilliant South American writing today’. He is Director of the Argentine National Library. Norman Thomas di Giovanni is an American now living in Scotland. He worked with Borges in Buenos Aires from to , and, to date, has produced six volumes of Borges’s verse and prose in English. Jorge Luis Borges with Margarita Guerrero The Book of Imaginary Beings Revised, enlarged and translated by Norman Thomas di Giovanni in collaboration with the author Penguin Books Penguin Books Ltd, Harmondsworth, Middlesex, England Penguin Books Australia Ltd, Ringwood, Victoria, Australia El libro de los seres imaginarios First published in Buenos Aires Translation published in the U.S.A. First published in Great Britain by Jonathan Cape Published in Penguin Books Copyright © Editorial Kier, S.A., Buenos Aires, Translation -

For the White Christ
For The White Christ By Robert Ames Bennet FOR THE WHITE CHRIST BOOK ONE Now death has seized-- Bale and terror--my trusty people, Laid down life have my liegemen all. BEOWULF. CHAPTER I Swans of the Dane-folk-- The ships of Sigmund-- Heads all gilt over, And prows fair graven. LAY OF GUDRUN. Early of an April morning of the year 778, a broad-beamed Frisian trade- ship was drifting with the ebb-tide down the Seine estuary. Wrapped about by the morning vapors, the deeply laden little craft floated on the stream like a dreamship. The mists shut out all view of sky and land and sea. From the quarter-deck, the two men beside the steer-oar could scarcely see across the open cargo-heaped waist to where, gathered silently about the mast, a dozen or so drowsy sailors stood waiting for the morning breeze. The remainder of the crew lay sprawled upon the casks and bales of merchandise, side by side with a score of Frankish warriors. All alike were heavy with drunken slumber. The shipmaster, a squat red-haired man of great girth, regarded the overcome wassailers with an indifferent eye; but the tall warrior beside him appeared far from pleased by the sight. "Is it so you rule your ship, Frisian?" he demanded. "You should have stopped the wassail by midnight. Here we swim on the treacherous sea, while our men lie in drunken stupor." "We are yet in the stream, lord count," replied the shipmaster. "As to my Frisians, a dash of salt water will soon rouse them. -

List of Goddess Spirits for MD 3 Charities, 3 Cranes, 3 Erinyes, 3 Moirai, 7 Flowers, Abuk, Abarbarea, Abeguwo, Abeona, Abnoba
List of Goddess Spirits for MD 3 charities, 3 cranes, 3 Erinyes, 3 Moirai, 7 Flowers, Abuk, Abarbarea, Abeguwo, Abeona, Abnoba, Abundantia, Acca Larentia, Aceso, Achadian mythology, Achelois, Achthonian, Aditi, Adrasteia, Adrestia, Adsullata, Advaita, Aecerbot, Aegle, Aequitas, Aeraecura, Aeternitas, Aganippe, Agasaya, Agdistis, Agenoria, agriculture goddesses, Agrona, Aibell, Aide, Ailas, Aimend, Aine, Airmed, Aja, Aja orisha, ajo njo, Ajysyt, Ak Ana, Akka, Akna, Al Basti, al-Lat, al-Manat, Al-Uzza, Ala, Ala Odinani, Alala, Albina, Alcinoe, Ale, Alemonia, AlfrooullAlke, Ali, Alilat, Alke, all ground of earth considered Holy land, All-Goddess, Allat, Allatu, Alor, Alpanu, Alruna, Alt nan Cailleach, Alu Ani, Alusi, Ama-arhus, Amahraspand, Amasagnul, Amathaunta, Ambika, Amaterasu, Amaunet, Amazon feminism, Amazon societies, Amazons, Ameretat, Ame-no-Uzume-no-Mikoto, Amesaspand, Amesha Spenta, Amor, Amordad, Amrtatva, Amurdad, An, Ana, Anahit, Anahita, Anaisa Pye, Ananke, Anann, Anat, Anath, Anaxibia, Ancamna, ancestral deity, Ancharia, Andarta, Andraste, Angel One, Angelos, Angerona, Angeronalia, Angeronia, Angitia, Angra Mainyu, Ani, Anima, Anjea, Anna Jagiellon, Annona, Anput, Antevorta, anti-male, Antevorta, Antu, Anu Irish goddess, Anuket, Anumati, Aoide, Apate, Appias, Apollo, Apollonis, Aphaea, Aphrodite, Apsara, Aradia Gospel of Witches, Arae, Aranyani, archaic local goddesses, archtypal mother in collective unconscious of humans, Arda, Arduenna silva, Arduina, Arduinna, Arduinnae, Arduinne, Argive Horae, Ariadne, Aricia sacred grove, -

Paxmag-EN-April 2019 No50.Pdf
Blau Varadero Hotel HHHH Varadero, Cuba Guests will enjoy an authentic Cuban stay in a unique setting at the adults-only Blau Varadero Hotel. Set on Varadero Beach, this all-inclusive resort pampers guests with a spa and wellness centre, rooms with ocean views, water sports and much more. Booking with Transat has its perks: Enhance your clients travel › Separate check-in › Welcome Cocktail experience with Air Transat EARN › 2 à la carte dinners a week › Mini-bar restocked daily For as low as $10 COMMISSION1 › Bottle of rum in room upon arrival › 20% discount at the spa $54.50* › 24-hour drink and snacks service book Option Plus for more privileges and services in Economy Class. Winter 2019 – 28 flights a week to Varadero from 11 gateways. *Price for a one-way flight, in a standard seat, from Canada to the South.1 Per passenger booked on roundtrip Option Plus. Where adults reign supreme COOP-2102 • PAX MAGAZINE • FULL PAGE • 8.25 X 10.75 • APRIL 1, 2019 As you may be aware, PAX Global Media Inc. (PGM) recently and in English on TourismPlus.com. We’ve dreamed up a announced that it had successfully acquired Tourisme new and exciting hybrid concept exclusive to the Canadian Plus and its subsidiaries. The move was a phenomenal start market, that caters to both consumers and travel professionals to the new year, and it’s paved the way for PGM to further alike. It will focus on all luxury travel offerings, including develop at a pace quite unlike anything we’ve seen before. -
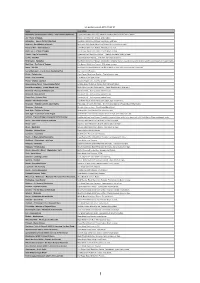
Wc-Product-Export-2019-10-29 (3)
wc-product-export-2019-10-29 (3) Name Description Movimento d'Avanguardia Ermetico - Alle Frontiere dell'Anima Pogan Black Metal from Italy. Reedition of debut demo with two bonus tracks. Jar - Flame of Kupala Pagan Folk Metal from Belarus. Debut album. Arkenstone - Hymns To Our Fatherland Raw Black Metal from Portugal. Last album until now. Aetheres - Dark Wisdom's Domain Depressive Dark Pagan Metal from Poland. Second album on tape. Flame Of War - Transcendence Great Black Metal from Poland. Third album on tape. Dark Fury - Fortress of Eagles Cult Horned Metal from Poland. Fourth album on tape. Hateful - Key To Immortality Agressive Black Metal from Poland... The only one demo, finally on tape. Lechia - Akt Woli Pagan Metal from Poland... new stuff, after years of silence. Niedergang - Hanyatlas Raw Black Metal from Hungary. Compilation including first unreleased demo, second demo and three previously unreleased tracks. Dark Fury - The Price of Treason Cult Horned Metal from Poland... Fifth album on tape. Drevo - Velichie Neoclassical Industrial/Neofolk with Black Metal touches, with strong heathen influences. Lepra/Gyotrelem - Live At Inner Awakening Fest Live ritual from Hungary... Kroda - Fimbulvinter Great Pagan Metal from Ukraine... Third album on tape. Kroda - Live in Lemberg Live album of this great horde. Piorun - Stajemy Jak Ojce Slavonic Pagan Folk... First CD on tape. Slavecrushing Tyrant - Slavecrushing Tyrant Heathen Black Metal from Poland. First full-lenght album. North/Gromowładny - Lechia, Sławia, Aria Split of two legendary Polish hordes... Pagan Black Metal in best way ! Branikald - Rumsjod Av Misantropie Blazebirth Hall... Nothing more needed to say. Branikald - Blikk Av Kald Blazebirth Hall.. -

Vicious Valkyries League #321 AUGUST 2021
SEPTEMBER 2021 Vicious Valkyries League #323 League Champion VIRUS/CTI: FOE Job (452-228-57) *41 $1,476,800 … #128 or 501 TV Champion VIRUS/CTI: Guzinga (34-27-5) *8 $199,700 … #127 or 502 Central Plains Champion * from the battle royal SOS: Lil Ladybug (187-39-9) *13 $763,000 … #126 or 503 East Coast Champion VIRUS/CTI: Carnage Clan Chaos (104-46-10) *16 $287,600 … #105 or 504 Great Lakes Champion VIRUS/CTI: Carnage Clan Cutter (58-56-10) *14 $278,000 … #44 or 505 Mid-Atlantic Champion SOS: Crabby Patty from the Nat (354-110-24) *21 $1,056,700 … #146 or 506 Northeast Champion SOS: Nast Natalie from the Nat (348-99-31) *21 $1,003,700 … #131 or 507 Pacific Northwest Champion unclaimed Rocky Mountains Champion unclaimed Southeast Champion Lady Valkyrie (207-84-12) *1 $369,100 … #183 or 510 Southwest Champion SOS/|: Branislava Ivanov (32-17-4) *1 $124,100 … #79 or 511 West Coast Champion VIRUS/LPPF/CTI: Pocket Rocket (3-0) *1 $15,900 … #135 or 512 League Tag-team Champions SOS: Nast Natalie from the Nat and Crabby Patty from the Nat #131 & #146 or 789 TV Tag-team Champions VIRUS/CTI: Brain Buster Bride and Brain Buster Brawler #156 & #158 or 987 League Six-woman Champions SOS: Stletto Kwaigno, G.I. Jane Martelle, and Scarlett O’Hara #111, #113, & #169 or 789 TV Six-woman Champions VIRUS/LPPF/CTI: Batteries “Not” Included, Rocket Man, and Pocket Rocket #125, #134, & #135 or 987 Battle Royal Winner SOS: Lil Ladybug (187-39-9) *13 $763,000 … #126 2 VVL Rankings 1.