Boykottiert Katar 2022!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Profession Footballeur N°19
04 10 22 AssembléeAssemblée Comité Général Pierre généralegénérale directeur de Villiers LE MAGAZINE DE L’UNION NATIONALE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS N°19 / JANVIER 2019 PROFESSION ILS S’ENGAGENT ENGAGEZ-VOUS AVEC EUX, ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS ! HEUREUSEMENT, L’UNFP ! « Il vient une heure où protester ne suffit plus ; après la philosophie, PROFESSION il faut l’action ; la vive force achève ce que l’idée a ébauché. » Victor Hugo À l’heure des bilans, que faut-il retenir de l’année 2018, qui a placé la France sur le toit du monde ? Faut-il y voir le parfait reflet d’un football professionnel français au sommet de son art, aussi performant sur le terrain qu’il pourrait l’être en dehors ? Aussi travailleur qu’un N’Golo Kanté, aussi serein qu’un Hugo Lloris, aussi créatif qu’un Antoine Griezmann, aussi sûr d’un avenir magnifique comme celui promis à Kylian Mbappé, aussi soudé et tourné vers un même objectif que les Bleus et leur staff en Russie ? Ce sacre mondial n’est-il pas, au contraire, l’arbre qui cache une forêt de plus en plus dense 04 d’où surgissent, avec une régularité confondante, tous les maux que l’on prête généralement Assemblée à notre sport et contre lesquels, heureusement, se lève l’UNFP ? générale La liste est longue des dysfonctionnements. Longue de ces joueurs mis à l’écart – plus de 40, cette saison, dans 23 de nos 43 clubs professionnels —, au mépris de la Charte 34 et de la Commission juridique de la LFP, laquelle oblige pourtant les clubs à les réintégrer, mais dont les décisions ne sont plus suivies d’effet. -

Rapport D'activité De La
rapport d’activité de la ligue de football professionnel saison 2011 /2012 02 introdUction C’est tout à l’honneur des clubs français, dans un accuse un résultat net contexte économique particulièrement difficile, de déficitaire. parvenir pour la plupart à une meilleure maîtrise des Même si le modèle charges, en particulier de la masse salariale. français est sain, nos Dans le même temps, le chiffre d’affaires du football clubs ne parviennent pas à équilibrer leurs professionnel a encore progressé pour atteindre le comptes. montant record de 1 349 millions d’euros alors que Ces difficultés sont aggravées par la pression fis - l’endettement des clubs français reste faible, 106 cale et sociale qui pèse sur le football professionnel millions d’euros à comparer avec celui du football français. La contribution globale au budget de l’Etat européen, 7,8 milliards d’euros en 2011. ne cesse d’augmenter. Elle a atteint le montant re - Parallèlement, la politique d’investissement dans cord de 687 millions d’euros en 2011-2012 et les infrastructures s’est poursuivie avec l’inaugura - dépassera nettement le seuil historique des 700 tion de plusieurs stades, à Valenciennes, au Havre, millions d’euros en 2012-2013. et Lille. Il est temps que nos clubs, dans un contexte inter - Cependant, ces éléments structurels favorables ne national aussi concurrentiel, puissent enfin compter doivent pas masquer les difficultés économiques sur un environnement fiscal mais aussi juridique sérieuses que nous connaissons. Ainsi, le résultat stable. net cumulé des 40 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pré - sente un déficit de 108 millions d’euros contre 65 millions d’euros la saison précédente. -

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)
Impact Factor - 6.293 ISSN-2349-638x Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ) PEER REVIEWED & INDEXED JOURNAL December – 2020 Chief Editor Pramod P. Tandale Editor Co-Editor Dr.TEKALE.A.D. DR.NANDKUMAR N. KUMBHARIKAR Director of Physical Education and Sports Public Administration Dept. S.P.P. Mahavidhyalaya,Sirsala, Dist. Beed S.P.P.Mahavidhyalaya, Sirsala Dist. Beed IMPACT FACTOR SJIF 6.293 For details Visit our website www.aiirjournal.com No part of this Special Issue shall be copied, reproduced or transmitted in any form or any means, such as Printed material, CD – DVD / Audio / Video Cassettes or Electronic / Mechanical, including photo, copying, recording or by any information storage and retrieval system, at any portal, website etc; Without prior permission. Aayushi International Interdisciplinary Research Journal ISSN 2349-638x Special Issue No.81 Disclaimer Research papers published in this Special Issue are the intellectual contribution done by the authors. Authors are solely responsible for their published work in this special Issue and the Editor of this special Issue are not responsible in any form. Aayushi International Interdisciplinary Research Journal Nov. ISSN 2349-638x Impact Factor 6.293 (Special Issue No.80) 2020 Sr. Name of the Author Title of the Paper Page No. No. 1 Dr.Madhukar Aghav A Study of Co-Operative Banking in India 1 Role of Teacher in Curriculum Development for 2 Dr.Vithal Ramkishan Bhosale 4 Physical Education and Sports Dr. Faruqui Mohammed Political Intolerance and The Rules of 3 7 Quayyum Engagement in A Democracy A Study of Factors Affecting on Tourism in India: 4 Dr.J.R. -

• Umtiti Heads France Into World Cup Final As Belgium Fall Short • Belgium Denied and Will Contest Third-Place Play-Off on S
WEDNESDAY, JULY 11, 2018 20 Belgium’s goalkeeper Thibaut Courtois (R) concedes a goal in the 51st minute during the Russia 2018 World Cup semi- final football match between France and Belgium Tuesday July 10 FRANCE 1 0 BELGIUM 51’ Umtiti Saint Petersburg Stadium Semi-finals Referee FrenchTuesday July 10 Tuesday July 10 FRANCE FRANCE1 0 BELGIUM1 0 BELGIUM Andres Cunha (URU) 51’ Umtiti51’ SaintUmtiti PetersburgSaint Stadium Petersburg Stadium Players PossessionSemi-finals Semi-finals Players Referee Referee 1 Lloris (cap) AndresPossession CunhaAndres (URU)(URU) Cunha (URU) 1 Courtois Players Possession Players 2 Pavard Players Possession 2 AlderweireldPlayers 4 Varane 1 Lloris (cap) 4 Kompany1 Courtois 1 Lloris (cap)(cap) 2 Pavard 40% 60% 1 Courtois2 Alderweireld 5 Umtiti 5 Vertonghen 2 Pavard 4 Varane 40% 60%2 Alderweireld4 Kompany 6 Pogba 4 Varane 5 Umtiti 4 Kompany6 Witsel5 Vertonghen 6 Pogba 40% 60% 6 Witsel 7 Griezmann 5 Umtiti 5 Vertonghen7 De Bruyne 6 Pogba 7 Griezmann 6 Witsel 7 De Bruyne 9 Giroud 85’ 9 Giroud 1985’ Shots 19 9Shots 9 8 Fellaini8 Fellaini 80’ 80’ 7 Griezmann 10 Mbappé 7 De Bruyne9 Lukaku 10 Mbappé 9 Giroud 13 Kante85’ 19 Shots5 On9 target 3 8 Fellaini9 Lukaku10 Hazard (cap) 80’ 13 Kante 10 Mbappé 14 Matuidi 5 86’ On target 3 9 Lukaku10 Hazard19 Dembele (cap) 60’ 13 Kante 21 Hernandez 5 On target6 3Fouls 1610 Hazard22 (cap)(cap)Chadli 90+1’ 14 Matuidi 14 Matuidi 86’ 86’ 19 Dembele19 Dembele 60’ 60’ 15 Nzonzi 85’ 14 Mertens 60’ 21 Hernandez 6 6 Fouls(cap)Fouls = Captain 16 Yellow card22 Chadli 90+1’ 21 Hernandez 12 Tolisso 86’ Substitution Red card 22 Chadli11 Carrasco 80’ 90+1’ 21 Batshuayi 90+1’ 15 Nzonzi 85’ (cap)(cap) == CaptainCaptain YellowYellow cardcard 14 Mertens 60’ 15 Nzonzi 85’ Source: FIFA 14 Mertens 60’ 12 Tolisso 86’(cap) = CaptainSubstitutionSubstitution YellowRedRed cardcard card 11 Carrasco 80’ 12 Tolisso 86’ Substitution Red card 21 Batshuayi11ItCarrasco was a90+1’ question80’ of Source:Source: FIFAFIFA 21details.Batshuayi Unfortunately90+1’ Source: FIFA for us the difference delight was a deadball situation. -
Barcelona's Financial Crisis to Have MAJOR Impact on January Transfer
We'd like to notify you about the latest This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more Got it! updates You can unsubscribe from notifications anytime View in Hindi: LIVE TV Later Allow The Debate India News India Vs Australia Coronavirus Entertainment News PoweredSports by iZooto News World News Opinions Nation Wants To Know Home / Sports News / Football News / Barcelona’s nancial crisis to have MAJOR impact on January transfer window signings Last Updated: 24th November, 2020 13:55 IST Barcelona’s Financial Crisis To Have MAJOR Impact On January Transfer Window Signings Barcelona’s ongoing financial issues and the players' refusal to take pay cuts may hamper the club's transfer business in the upcoming transfer window. Written By Azhar Mohamed Sınırsız Geniş Ekran 2.6 GHz İşlemcisi, 4 GB RAM’i ve Android 9.0 İşletim Sistemiyle Temponuz Hızlanacak Reeder Satın Alın MUST READ View all Barcelona’s ongoing financial issues will have a major impact on the club’s ability to buy players 11 hours ago in the January transfer window. Earlier this year, the Barcelona board had asked their players to Hardik Pandya enjoys dinner date take a wage cut in order to help with their finances. The financial condition at Barcelona was with wife Natasa Stankovic after unstable in the summer, which meant they were unable to sign their targets in the transfer returning from Australia window. 11 hours ago Liverpool midfielder Georginio Wijnaldum and Olympique Lyonnais attacker Memphis Depay Pakistan pacer Mohammad Amir were both seen as targets for new manager Ronald Koeman but the club was unable to land 'leaving Cricket for now' at 28; PCB either of them. -

Luka Modric V Paul Pogba Kylian Mbappe V Dejan Lovren Marcelo
SUNDAY, JULY 15, 2018 19 key World Cup final battles rance are favourites to win the World Cup By contrast, Didier Deschamps’s side have seen As the smallest country to reach a World Cup for a second time in Moscow on Sunday off Argentina, Uruguay and Belgium, all in 90 min- final for 68 years, Croatia cannot call on the same when they take on a Croatia side forced to go utes, and enjoyed a day’s extra rest to prepare after resources as the French but have shown incredible F Marcelo Brozovic 4through three periods of extra-time to make their their semi-final on Tuesday as they look to make mental strength to battle back from falling behind first ever final. amends for defeat in the Euro 2016 final to Portugal. in each of their three knockout games. Luka Modric v Paul Mario Mandzukic v Raphael Varane Mandzukic often saves his best for the big occasion, most Marcelo Brozovic v Pogba recently shrugging off a knee injury to strike the winner Modric has been wide- against England in the semi-final. Antoine Griezmann ly hailed as the world’s The Juventus forward also has a great record when Recalled by Zlatko Dalic for the semi-fi- best midfielder for his facing Varane. Mandzukic scored a stunning overhead nal, Inter Milan midfielder Brozovic performances in Rus- kick in the 2017 Champions League final, netted freed up Modric and Rakitic from sia and has emerged twice as the Italians beat Real Madrid 3-1 at the San- defensive duties at the base of the as a Ballon d’Or con- tiago Bernabeu in April and grabbed the winner for midfield and always provided an out tender after also winning Atletico Madrid in the 2014 Spanish Super Cup. -

Israel - Wikipedia Page 1 of 97
Israel - Wikipedia Page 1 of 97 Coordinates: 31°N 35°E Israel :Arabic ; �י �� �� �אל :Israel (/ˈɪzriəl, ˈɪzreɪəl/; Hebrew formally known as the State of Israel Israel ,( � � ��ا �يل (Hebrew) לארשי Medinat Yisra'el), is a �מ ��י �נת �י �� �� �אל :Hebrew) country in Western Asia, located on the (Arabic) ليئارسإ southeastern shore of the Mediterranean Sea and the northern shore of the Red Sea. It has land borders with Lebanon to the north, Syria to the northeast, Jordan on the east, the Palestinian territories of the West Bank and Gaza Strip[20] to the east and west, respectively, and Egypt to the southwest. The country contains geographically diverse features within its relatively small Flag Emblem area.[21][22] Israel's economic and technological Anthem: "Hatikvah" (English: "The Hope") center is Tel Aviv,[23] while its seat of government and proclaimed capital is Jerusalem, although the state's sovereignty over Jerusalem has only partial recognition.[24][25][26][27][fn 4] Israel has evidence of the earliest migration of hominids out of Africa.[28] Canaanite tribes are archaeologically attested since the Middle Bronze Age,[29][30] while the Kingdoms of Israel and Judah emerged during the Iron Age.[31][32] The Neo-Assyrian Empire destroyed Israel around 720 BCE.[33] Judah was later conquered by the Babylonian, Persian and Hellenistic empires and had existed as Jewish autonomous provinces.[34][35] The successful Maccabean Revolt led to an independent Hasmonean kingdom by 110 BCE,[36] which in 63 BCE however became a client state of the Roman Republic that subsequently installed the Herodian dynasty in 37 BCE, and in 6 CE created the Roman province of Judea.[37] Judea lasted as a Roman province until the failed Jewish revolts resulted in widespread destruction,[36] the expulsion of the Jewish population[36][38] and the renaming of the region from Iudaea to Syria Palaestina.[39] Jewish presence in the region has persisted to a certain extent over the centuries. -

Uefa Champions League
UEFA CHAMPIONS LEAGUE - 2020/21 SEASON MATCH PRESS KITS Camp Nou - Barcelona Tuesday 16 February 2021 21.00CET (21.00 local time) FC Barcelona Round of 16, First leg Paris Saint-Germain Last updated 15/02/2021 06:23CET UEFA CHAMPIONS LEAGUE OFFICIAL SPONSORS Match background 2 Legend 7 1 FC Barcelona - Paris Saint-Germain Tuesday 16 February 2021 - 21.00CET (21.00 local time) Match press kit Camp Nou, Barcelona Match background There will be plenty of sub-plots as Barcelona welcome Paris Saint-Germain to Spain, not least the memory of a record UEFA Champions League comeback the last time the sides crossed paths. • Barça – with Neymar, now of Paris, playing a leading role – overturned a 4-0 first-leg defeat at this stage of the UEFA Champions League four years ago, a 6-1 second-leg success completing a remarkable comeback in one of only five UEFA competition ties in which a side has won on aggregate having lost the first game by a four-goal margin – and the sole instance in the UEFA Champions League knockout phase. • That was one of the highlights of Neymar's four years as a Barcelona player before he joined Paris in 2017, although the Paris forward has been ruled out of this first leg by injury. • The Brazilian's Matchday 6 hat-trick this season helped secure his club's place in the round of 16 as Group H winners, while Barcelona had to settle for second position in Group G after closing their campaign with a heavy home defeat against Juventus to end their long unbeaten run at the Camp Nou in the UEFA Champions League. -
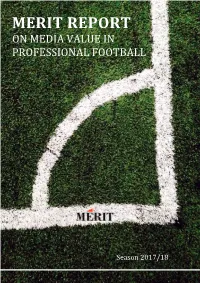
Merit Report on Media Value in Professional Football
MERIT REPORT ON MEDIA VALUE IN PROFESSIONAL FOOTBALL Season 2017/18 MERIT Report on Media Value in Football 2 MERIT Report on Media Value in Football Season 2017/18 Authors: Pedro García del Barrio Academic Director - MERIT social value Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) Felipe Nicolás Becerra Flores Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) Collaborators: Jef Schröder Aubert (UIC Barcelona) Arnau Raventós Gascón (UIC Barcelona) 3 MERIT Report on Media Value in Football 4 MERIT Report on Media Value in Football Season 2017/18 Contents Presentation ............................................................................................ 6 Main Results Season 2017/18 ......................................................... 7 1. MERIT Media Value Ranking – Football Players ..................................................................................................... 9 2. MERIT Media Value Ranking – Young Promises ............................................................................................... 11 3. MERIT Media Value Rank – Players of the winning teams of each European domestic league. .................................................................................................... 13 4. MERIT Media Value Ranking - Teams ................................ 15 5. Media “Dream Team” (2017/18) ......................................... 17 6. Media Value Ranking of the “Big- 5” domestic leagues .................................................................................................. -

Dossier De Prensa Real Madrid
Real Madrid C. F. vs F. C. Barcelona 26a Vigesimosexta jornada de LaLiga LaLiga, Matchday 26 Temporada/ Season 2018/2019 Sábado/ Saturday 02/03/2019 20:45 horas Estadio Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu Stadium Datos técnicos Campeonato Nacional LaLiga 2018 · 2019 Technical Data LaLiga National Championship 2018 · 2019 Año de inauguración: 1947. Árbitro: Capacidad: 81.044 espectadores. Alberto Undiano Mallenco (Comité Navarro). Dimensiones: 105 x 68 m. Asistentes: Iluminación: Calidad HD/4K. Teodoro Sobrino Magan (Comité Castellano-Manchego). Palcos VIP: 248. José Enrique Naranjo Pérez (Comité de Las Palmas). Dirección: Avda. de Concha Espina 1, Cuarto árbitro: 28036, Madrid - España. Alexandre Alemán Pérez (Comité de Las Palmas). Autobuses: 14, 27, 40, 43, 120, 126, VAR: 147 y 150. Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Parada de Metro: Santiago Bernabéu, L10. AVAR 1: Pau Cebrián Devis (Comité Valenciano). Inaugurated: 1947. Capacity: 81.044 espectators. Referee: Dimensions: 105 x 68 m. Alberto Undiano Mallenco (Navarro committee). Lighting: HD/4K. Assistans: VIP Boxes: 248. Teodoro Sobrino Magan (Castellano-Manchego committee). Address: Avda. de Concha Espina 1, José Enrique Naranjo Pérez (Las Palmas committee). 28036, Madrid - Spain. Fourth referee: Bus: 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147 and 150. Alexandre Alemán Pérez (Las Palmas committee). Metro Station: Santiago Bernabéu, L10. VAR: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Valenciano committee). AVAR 1: Pau Cebrián Devis (Valenciano committee). Fuente/ Source: www.realmadrid.com y Share Real Madrid | La Liga 2018 · 2019 5 Real Madrid C. F. Datos del club Palmarés Club information Honors Año de fundación: 1902. › Trofeo FIFA al Mejor Club del Siglo XX / The best club of the 20th Century FIFA Trophy Número de socios: 93.606. -

USTA DI LOS 41 ABITROS Aui DHHGIRAN 'EL MUNDIAL82
Martes,16demarzode1982 EL MUNDO DEPORTIVO 13 Pág. Lamo Castillo, ú.lco español titular Pes Pérez e Valeció, Merko e Sarriá * * Gurueta, seis :USTA DI LOS 41 ki!s, el e más h eoidcdo ABITROS NUESTROS COLGIAOS aUI DHHGIRAN INTERNACiONALES ‘EL MUNDIAL82 NOESTANSANOS Madrid, 15. -(De nuestro corresponsal, Damián GONZALEZ.) — El colegiado aragonés José Donato Pes Pérez dirigirá el partido qúe el próximo domingo disputará el Barcelona en el campo valencianista Luis Casanova, que puede apuntillar casi definitivamente la opción al título de Liga del equipo azulgrana. Al Español le ha correspondido el canario Merino González, en su encuentro, en principio de trámite, frente al ya desahuciado Cas tellón. Al margen de estos dos partidos, el resto de encuentros los diri girán: Valladolid - BetisSanchez Molina, castellano. Real Madrid - Cádiz, Esquerdo Guerrero, catalán. Athletic Bilbao - Las Palmas, García Carrión, valenciano. Osasuna - Sporting de Gijón. Franco Martínez, murciano. Zaragoza - Santander, Martín Navarrete. andaluz. Hércules - Real Sociedad, Andújar Oliver, andaluz. Sevilla - At. de Madrid, Gutiérrez Fernández, asturiano. Al margen, creemos interesante recoger cuenta de estas designaciones el informe que ha saltado a la luz pública en torno al estado físico de lOS siete árbitros internacionales españoles, según la revisión médica a que fueron sometidos a principios de año en el Centro de Medicina Deportiva del Consejo Superior de Deportes. En este informe parece revelarse que los árbitros españoles están lejos de las condiciones físicas ideales, según señala el compañero Juan Mora. Entre otras cosas que han saltado a la palestra figura que en el último año Guruceta engordó seis kilos; Lamo Castillo, cinco: Franco Martínez, tres; García Carrión y Sánchez Arminio, dós, y Miguel Pérez y Soriano mantuvieron sus 84 y 76 kilos, respectiva mente. -

Em Todas As Copas 20 De Julho DO BRASIL 4X0 BOLÍVIA Local: Estádio Centenário, Montevidéu
1930 2006 BRASIL DE TODAS AS COPASCAPA GUARDA GUARDA Antônio Carlos Napoleão O 1930 2006 BRASIL DE TODAS AS COPAS UM SÍMBOLO Nossa Seleção tornou-se, informalmente, um dos brasileiro símbolos nacionais, ao lado dos oficiais, como a Bandeira e o Hino Nacional Brasileiro. Motivo de orgulho para todo o país, a Seleção é a expressão da garra e do talento da nossa gente e, por isso mesmo é chamada muitas vezes de Brasil. Nas disputas, é o Brasil inteiro que se sente jogando e dando espetáculo. A Seleção sempre contribuiu para fortalecer a auto-estima dos brasileiros. Não apenas nos cinco campeonatos conquistados a partir de 1958, na Suécia, quando sepultamos o que Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas e demonstramos ao mundo que o Brasil tinha capacidade de sobra para ser o melhor entre os melhores. Mesmo nos momentos mais dolorosos, como na final da copa de 1950, no Maracanã, ou na derrota para a Itália no Estádio Sarriá, na Copa da Espanha, mostramos nosso talento e reunimos forças para superar a adversidade. Nosso selecionado tem o dom de fazer os corações de todos os brasileiros pulsarem no mesmo ritmo apaixonado. Quando está em ação, é capaz de promover o congraçamento, de unir na mesma onda de vibrações homens e mulheres, meninos, adultos e velhos, trabalhadores humildes e donos de grandes empresas, brancos, negros, índios e mestiços, ribeirinhos, camponeses e moradores das grandes metrópoles. Não há quem fique indiferente. É quando até quem não liga para o esporte no dia-a-dia torna-se um torcedor empolgado.