Das Vorkommen Des Wiesenrauten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lepidoptera of North America 5
Lepidoptera of North America 5. Contributions to the Knowledge of Southern West Virginia Lepidoptera Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity Colorado State University Lepidoptera of North America 5. Contributions to the Knowledge of Southern West Virginia Lepidoptera by Valerio Albu, 1411 E. Sweetbriar Drive Fresno, CA 93720 and Eric Metzler, 1241 Kildale Square North Columbus, OH 43229 April 30, 2004 Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity Colorado State University Cover illustration: Blueberry Sphinx (Paonias astylus (Drury)], an eastern endemic. Photo by Valeriu Albu. ISBN 1084-8819 This publication and others in the series may be ordered from the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Department of Bioagricultural Sciences and Pest Management Colorado State University, Fort Collins, CO 80523 Abstract A list of 1531 species ofLepidoptera is presented, collected over 15 years (1988 to 2002), in eleven southern West Virginia counties. A variety of collecting methods was used, including netting, light attracting, light trapping and pheromone trapping. The specimens were identified by the currently available pictorial sources and determination keys. Many were also sent to specialists for confirmation or identification. The majority of the data was from Kanawha County, reflecting the area of more intensive sampling effort by the senior author. This imbalance of data between Kanawha County and other counties should even out with further sampling of the area. Key Words: Appalachian Mountains, -

British Museum (Natural History)
Bulletin of the British Museum (Natural History) Darwin's Insects Charles Darwin 's Entomological Notes Kenneth G. V. Smith (Editor) Historical series Vol 14 No 1 24 September 1987 The Bulletin of the British Museum (Natural History), instituted in 1949, is issued in four scientific series, Botany, Entomology, Geology (incorporating Mineralogy) and Zoology, and an Historical series. Papers in the Bulletin are primarily the results of research carried out on the unique and ever-growing collections of the Museum, both by the scientific staff of the Museum and by specialists from elsewhere who make use of the Museum's resources. Many of the papers are works of reference that will remain indispensable for years to come. Parts are published at irregular intervals as they become ready, each is complete in itself, available separately, and individually priced. Volumes contain about 300 pages and several volumes may appear within a calendar year. Subscriptions may be placed for one or more of the series on either an Annual or Per Volume basis. Prices vary according to the contents of the individual parts. Orders and enquiries should be sent to: Publications Sales, British Museum (Natural History), Cromwell Road, London SW7 5BD, England. World List abbreviation: Bull. Br. Mus. nat. Hist. (hist. Ser.) © British Museum (Natural History), 1987 '""•-C-'- '.;.,, t •••v.'. ISSN 0068-2306 Historical series 0565 ISBN 09003 8 Vol 14 No. 1 pp 1-141 British Museum (Natural History) Cromwell Road London SW7 5BD Issued 24 September 1987 I Darwin's Insects Charles Darwin's Entomological Notes, with an introduction and comments by Kenneth G. -

2017 City of York Biodiversity Action Plan
CITY OF YORK Local Biodiversity Action Plan 2017 City of York Local Biodiversity Action Plan - Executive Summary What is biodiversity and why is it important? Biodiversity is the variety of all species of plant and animal life on earth, and the places in which they live. Biodiversity has its own intrinsic value but is also provides us with a wide range of essential goods and services such as such as food, fresh water and clean air, natural flood and climate regulation and pollination of crops, but also less obvious services such as benefits to our health and wellbeing and providing a sense of place. We are experiencing global declines in biodiversity, and the goods and services which it provides are consistently undervalued. Efforts to protect and enhance biodiversity need to be significantly increased. The Biodiversity of the City of York The City of York area is a special place not only for its history, buildings and archaeology but also for its wildlife. York Minister is an 800 year old jewel in the historical crown of the city, but we also have our natural gems as well. York supports species and habitats which are of national, regional and local conservation importance including the endangered Tansy Beetle which until 2014 was known only to occur along stretches of the River Ouse around York and Selby; ancient flood meadows of which c.9-10% of the national resource occurs in York; populations of Otters and Water Voles on the River Ouse, River Foss and their tributaries; the country’s most northerly example of extensive lowland heath at Strensall Common; and internationally important populations of wetland birds in the Lower Derwent Valley. -

MOTHS and BUTTERFLIES LEPIDOPTERA DISTRIBUTION DATA SOURCES (LEPIDOPTERA) * Detailed Distributional Information Has Been J.D
MOTHS AND BUTTERFLIES LEPIDOPTERA DISTRIBUTION DATA SOURCES (LEPIDOPTERA) * Detailed distributional information has been J.D. Lafontaine published for only a few groups of Lepidoptera in western Biological Resources Program, Agriculture and Agri-food Canada. Scott (1986) gives good distribution maps for Canada butterflies in North America but these are generalized shade Central Experimental Farm Ottawa, Ontario K1A 0C6 maps that give no detail within the Montane Cordillera Ecozone. A series of memoirs on the Inchworms (family and Geometridae) of Canada by McGuffin (1967, 1972, 1977, 1981, 1987) and Bolte (1990) cover about 3/4 of the Canadian J.T. Troubridge fauna and include dot maps for most species. A long term project on the “Forest Lepidoptera of Canada” resulted in a Pacific Agri-Food Research Centre (Agassiz) four volume series on Lepidoptera that feed on trees in Agriculture and Agri-Food Canada Canada and these also give dot maps for most species Box 1000, Agassiz, B.C. V0M 1A0 (McGugan, 1958; Prentice, 1962, 1963, 1965). Dot maps for three groups of Cutworm Moths (Family Noctuidae): the subfamily Plusiinae (Lafontaine and Poole, 1991), the subfamilies Cuculliinae and Psaphidinae (Poole, 1995), and ABSTRACT the tribe Noctuini (subfamily Noctuinae) (Lafontaine, 1998) have also been published. Most fascicles in The Moths of The Montane Cordillera Ecozone of British Columbia America North of Mexico series (e.g. Ferguson, 1971-72, and southwestern Alberta supports a diverse fauna with over 1978; Franclemont, 1973; Hodges, 1971, 1986; Lafontaine, 2,000 species of butterflies and moths (Order Lepidoptera) 1987; Munroe, 1972-74, 1976; Neunzig, 1986, 1990, 1997) recorded to date. -

Butterflies and Moths of New Brunswick, Canada
Heliothis ononis Flax Bollworm Moth Coptotriche aenea Blackberry Leafminer Argyresthia canadensis Apyrrothrix araxes Dull Firetip Phocides pigmalion Mangrove Skipper Phocides belus Belus Skipper Phocides palemon Guava Skipper Phocides urania Urania skipper Proteides mercurius Mercurial Skipper Epargyreus zestos Zestos Skipper Epargyreus clarus Silver-spotted Skipper Epargyreus spanna Hispaniolan Silverdrop Epargyreus exadeus Broken Silverdrop Polygonus leo Hammock Skipper Polygonus savigny Manuel's Skipper Chioides albofasciatus White-striped Longtail Chioides zilpa Zilpa Longtail Chioides ixion Hispaniolan Longtail Aguna asander Gold-spotted Aguna Aguna claxon Emerald Aguna Aguna metophis Tailed Aguna Typhedanus undulatus Mottled Longtail Typhedanus ampyx Gold-tufted Skipper Polythrix octomaculata Eight-spotted Longtail Polythrix mexicanus Mexican Longtail Polythrix asine Asine Longtail Polythrix caunus (Herrich-Schäffer, 1869) Zestusa dorus Short-tailed Skipper Codatractus carlos Carlos' Mottled-Skipper Codatractus alcaeus White-crescent Longtail Codatractus yucatanus Yucatan Mottled-Skipper Codatractus arizonensis Arizona Skipper Codatractus valeriana Valeriana Skipper Urbanus proteus Long-tailed Skipper Urbanus viterboana Bluish Longtail Urbanus belli Double-striped Longtail Urbanus pronus Pronus Longtail Urbanus esmeraldus Esmeralda Longtail Urbanus evona Turquoise Longtail Urbanus dorantes Dorantes Longtail Urbanus teleus Teleus Longtail Urbanus tanna Tanna Longtail Urbanus simplicius Plain Longtail Urbanus procne Brown Longtail -

De Macro-Nachtvlinderfauna (Lepidoptera) Van Zandig-Vlaanderen Tussen Brugge En Gent En Van De Scheldepolders in Het Meetjesland (1969/1983–2010)
De macro-nachtvlinderfauna (Lepidoptera) van Zandig-Vlaanderen tussen Brugge en Gent en van de Scheldepolders in het Meetjesland (1969/1983–2010) Tom & Daniël Sierens, Omer Van de Kerckhove, Marc Van Opstaele en Boudewijn Kindts Abstract. The Macro-Heterocera (Lepidoptera) of the region between Brugge and Ghent and of the polders of river Schelde in Meetjesland (1969:1983–2010) This paper contains the results of 28 years of inventarisation of Heterocera in the region between Bruges and Ghent. Also a short description of the studied biotopes is given. The first Flemish specimen of Schrankia taenialis (Hübner, 1809) is reported. Résumé. Les macro-hétérocères (Lepidoptera) de la région entre Bruges et Gand et des polders du Meetjesland (1969/1983–2010) Cet article contient des résultats de 28 années d’inventaire des Hétérocères dans la région entre Bruges et Gand. En outre, une brève decription des biotopes étudiés est donnée. Le premier exemplaire flamand de Schrankia taenialis (Hübner, 1809) est signalé. Key words: Belgium – Flanders – Faunistics – Schrankia taenialis. Sierens, T.: Tijkstraat 6, B-9000 Gent. [email protected] Sierens, D.: Markt 5, B-9930 Zomergem. Van de Kerckhove, O.: Alfons Bursensstraat 47, B-1785 Merchtem. [email protected] Van Opstaele, M.: Vrekkemstraat 73, B-9910 Ursel. [email protected] Kindts, B.: Patersstraat 48, B-9900 Eeklo. [email protected] 1. Een bijdrage tot de inventarisatie van de streek tussen Brugge en Gent Grote delen van Vlaanderen zijn tot voor kort slecht geïnventariseerd geweest op het gebied van nachtvlinders. Toen in 1985 het laatste deel verscheen van de Catalogue des macrolépidoptères de Belgique (Hackray & Sarlet 1969– 1985) bleek het aantal gegevens uit het westen van het land, met uitzondering van de kuststreek, erg beperkt. -

Interesting Species of the Family Geometridae (Lepidoptera) Recently Collected in Serbia, Including Some That Are New to the Country’S Fauna
Acta entomologica serbica, 2018, 23(2): 27-41 UDC 595.768.1(497.11) DOI: 10.5281/zenodo.2547675 INTERESTING SPECIES OF THE FAMILY GEOMETRIDAE (LEPIDOPTERA) RECENTLY COLLECTED IN SERBIA, INCLUDING SOME THAT ARE NEW TO THE COUNTRY’S FAUNA ALEKSANDAR STOJANOVIĆ1, MIROSLAV JOVANOVIĆ1 and ČEDOMIR MARKOVIĆ2 1 Natural History Museum, Njegoševa 51, 11000 Belgrade, Serbia E-mails: [email protected]; [email protected] 2 University of Belgrade, Faculty of Forestry, Kneza Višeslava 1, 11030 Belgrade, Serbia E-mail: [email protected] (corresponding author) Abstract Seventeen very interesting species were found in studying the fauna of Geometridae of Serbia. Ten of them are new to the fauna of Serbia (Ennomos quercaria, Anticollix sparsata, Colostygia fitzi, Eupithecia absinthiata, E. alliaria, E. assimilate, E. millefoliata, E. semigraphata, Perizoma juracolaria and Trichopteryx polycommata); five are here recorded in Serbia for the second time (Dyscia raunaria, Elophos dilucidaria, Eupithecia ochridata, Perizoma bifaciata and Rhodostrophia discopunctata); and two are recorded for the third time (Nebula nebulata and Perizoma hydrata). Information regarding where and when they were all found is given herein. KEY WORDS: geometrid moths, measuring worms, new record, taxonomy Introduction With more than 23000 species, Geometridae is one of the largest families of the order Lepidoptera (Choi et al., 2017). About 900 species have been found to date in Europe (Hausmann, 2001). Some of them are significant pests in agriculture and forestry (Carter, 1984; Barbour, 1988; Glavendekić, 2002; Pernek et al., 2013). Around 380 species have so far been recorded in Serbia (Dodok, 2006; Djurić & Hric, 2013; Beshkov, 2015a, 2015b, 2015c, 2017a, 2017b; Beshkov & Nahirnić, 2017; Nahirnić & Beshkov, 2016). -

DNA Barcoding the Geometrid Fauna of Bavaria (Lepidoptera): Successes, Surprises, and Questions
DNA Barcoding the Geometrid Fauna of Bavaria (Lepidoptera): Successes, Surprises, and Questions Axel Hausmann1*, Gerhard Haszprunar1, Paul D. N. Hebert2 1 Entomology Department, Zoological Collection of the State of Bavaria, Munich, Germany, 2 Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph, Guelph, Canada Abstract Background: The State of Bavaria is involved in a research program that will lead to the construction of a DNA barcode library for all animal species within its territorial boundaries. The present study provides a comprehensive DNA barcode library for the Geometridae, one of the most diverse of insect families. Methodology/Principal Findings: This study reports DNA barcodes for 400 Bavarian geometrid species, 98 per cent of the known fauna, and approximately one per cent of all Bavarian animal species. Although 98.5% of these species possess diagnostic barcode sequences in Bavaria, records from neighbouring countries suggest that species-level resolution may be compromised in up to 3.5% of cases. All taxa which apparently share barcodes are discussed in detail. One case of modest divergence (1.4%) revealed a species overlooked by the current taxonomic system: Eupithecia goossensiata Mabille, 1869 stat.n. is raised from synonymy with Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759) to species rank. Deep intraspecific sequence divergences (.2%) were detected in 20 traditionally recognized species. Conclusions/Significance: The study emphasizes the effectiveness of DNA barcoding as a tool for monitoring biodiversity. Open access is provided to a data set that includes records for 1,395 geometrid specimens (331 species) from Bavaria, with 69 additional species from neighbouring regions. Taxa with deep intraspecific sequence divergences are undergoing more detailed analysis to ascertain if they represent cases of cryptic diversity. -
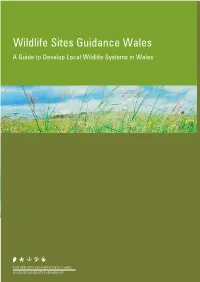
Sites of Importance for Nature Conservation Wales Guidance (Pdf)
Wildlife Sites Guidance Wales A Guide to Develop Local Wildlife Systems in Wales Wildlife Sites Guidance Wales A Guide to Develop Local Wildlife Systems in Wales Foreword The Welsh Assembly Government’s Environment Strategy for Wales, published in May 2006, pays tribute to the intrinsic value of biodiversity – ‘the variety of life on earth’. The Strategy acknowledges the role biodiversity plays, not only in many natural processes, but also in the direct and indirect economic, social, aesthetic, cultural and spiritual benefits that we derive from it. The Strategy also acknowledges that pressures brought about by our own actions and by other factors, such as climate change, have resulted in damage to the biodiversity of Wales and calls for a halt to this loss and for the implementation of measures to bring about a recovery. Local Wildlife Sites provide essential support between and around our internationally and nationally designated nature sites and thus aid our efforts to build a more resilient network for nature in Wales. The Wildlife Sites Guidance derives from the shared knowledge and experience of people and organisations throughout Wales and beyond and provides a common point of reference for the most effective selection of Local Wildlife Sites. I am grateful to the Wales Biodiversity Partnership for developing the Wildlife Sites Guidance. The contribution and co-operation of organisations and individuals across Wales are vital to achieving our biodiversity targets. I hope that you will find the Wildlife Sites Guidance a useful tool in the battle against biodiversity loss and that you will ensure that it is used to its full potential in order to derive maximum benefit for the vitally important and valuable nature in Wales. -

Nota Lepidopterologica
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Nota lepidopterologica Jahr/Year: 2005 Band/Volume: 28 Autor(en)/Author(s): Can Feza, Mironov Vladimir Artikel/Article: Perizoma onurcani sp. n. from Turkey (Geometridae: Larentiinae) 163-166 ©Societas Europaea Lepidopterologica; download unter http://www.biodiversitylibrary.org/ und www.zobodat.at Notalepid. 28 (3/4): 163-166 163 Perizoma onurcani sp. n. from Turkey (Geometridae: Larentiinae) ^ Feza Can ' & Vladimir Mironov ' University of Mustafa Kemal, Faculty of Agriculture, Department of Entomology, 3 1034 Hatay, Turkey; e-mail: [email protected] 2 Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Department of Lepidopterology, Universitetskaya nab. 1, RU-199034, Saint Petersburg, Russia; e-mail: [email protected] Abstract. The description of a new geometrid moth, Perizoma onurcani sp. n., from northern Turkey (Trabzon Province) is given. The holotype and two paratypes (all females) of the new taxon are kept in the collection of the University of Mustafa Kemal, Hatay, Turkey (UMKH). Zusammenfassung. Perizoma onurcani sp. n. wird aus der nördlichen Türkei (Provinz Trabzon) beschrieben. Der Holotypus und zwei Paratypen (alles Weibchen) der neuen Art werden in der Sammlung der Mustafa Kemal Universität, Hatay, Türkei (UMKH) aufbewahrt. Key words. Lepidoptera, Geometridae, Perizoma onurcani, new species, Turkey. Introduction After the publications of Riemis (1994), Viidalepp (1996) and Mironov (2000, 2003) on the geometrid moths of Turkey, Transcaucasus (which belonged to the former U.S.S.R.), and Europe, the species of the genus Perizoma Hübner, 1 825 of the fauna of Asia Minor were thought to be well known. Up until now, eight species of this genus have been recorded from the territory of Turkey, i.e. -

© Амурский Зоологический Журнал II(4), 2010. 303-321 © Amurian
© Амурский зоологический журнал II(4), 2010. 303-321 УДК 595.785 © Amurian zoological journal II(4), 2010. 303-321 ПЯДЕНИЦЫ (INSECTA, LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE) БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОГО ЗАПОВЕДНИ- КА (ОКРЕСТНОСТИ ХАБАРОВСКА) Е.А. Беляев1, С.В. Василенко2, В.В. Дубатолов2, А.М. Долгих3 [Belyaev E.A., Vasilenko S.V., Dubatolov V.V., Dolgikh A.M. Geometer moths (Insecta, Lepidoptera: Geometridae) of the Bolshekhekhtsirskii Nature Reserve (Khabarovsk suburbs)] 1Биолого-почвенный институт ДВО РАН, пр. Сто лет Владивостоку, 159, Владивосток, 690022, Россия. E-mail: beljaev@ibss. dvo.ru 1Institute of Biology and Soil Science, Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Prospect 100 Let Vladivostoku, 159, Vladivostok, 690022, Russia. E-mail: [email protected]. 2Сибирский зоологический музей, Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе 11, Новосибирск, 630091, Россия. E-mail: [email protected]. 2Siberian Zoological Museum, Institute of Systematics and Ecology of Animals, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Frunze str. 11, Novosibirsk, 630091, Russia. E-mail: [email protected]. 3Большехехцирский заповедник, ул. Юбилейная 8, пос. Бычиха, Хабаровский район, Хабаровский край, 680502, Россия. E-mail: [email protected]. 3Nature Reserve Bolshekhekhtsyrskii, Yubileinaya street 8, Bychikha, Khabarovsk District, Khabarovskii Krai, 680502, Russia. E-mail: [email protected]. Ключевые слова: Пяденицы,Geometridae, Большехехцирский заповедник, Хехцир, Хабаровск Key words: Geometer moths,Geometridae, Khekhtsyr, Khabarovsk, Russian Far East Резюме. Приводится 328 видов семейства Geometridae, собранных в Большехехцирском заповеднике. Среди них 34 вида впер- вые указаны для территории Хабаровского края. Summary. 328 Geometridae species were collected in the Bolshekhekhtsirskii Nature Reserve, 34 of them are recorded from Khabarovskii Krai for the first time. Большехехцирский заповедник, организованный в вершинным склонам среднегорья. -

Nachtvlinders in De Bossen Van Noord-Brabant
Nachtvlinders in de bossen van Noord-Brabant Nachtvlinders in de bossen van Noord-Brabant Tekst Jurriën van Deijk Met medewerking van Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting) Silvio Lindhout (Student HAS Almere) Rapportnummer VS2018.040 Projectnummer P-2017.016 Productie De Vlinderstichting Mennonietenweg 10 Postbus 506 6700 AM Wageningen T 0317 46 73 46 E [email protected] www.vlinderstichting.nl Opdrachtgever en subsidieverstrekker Provincie Noord-Brabant, kenmerk: C2204545/4166957 Deze publicatie kan worden geciteerd als Deijk, van J.R. (2018). Nachtvlinders in de bossen van Noord-Brabant. Rapport VS2018.040, De Vlinderstichting, Wageningen. Trefwoorden Nachtvlinders, kenmerkende soorten, bossen, SNL beheertype December, 2018 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigden/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van De Vlinderstichting, noch mag het zonder een dergelijke toestemming gebruikt worden voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. De Vlinderstichting 2018/ Nachtvlinders in de bossen van Noord-Brabant 2 Inhoud Pag. Inhoud ..................................................................................................................... 3 1. Inleiding ............................................................................................................. 5 1.1 Aanleiding .......................................................................................................... 5 1.2 Doelstelling .......................................................................................................