Ein Instrument Der Regionalentwicklung Mit Zukunft?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
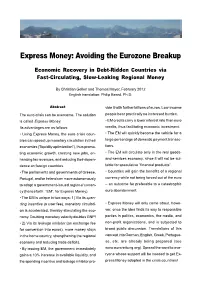
Express Money: Avoiding the Eurozone Breakup - 15
Express Money: Avoiding the Eurozone Breakup - 15. Febr. 2012 - 1 Express Money: Avoiding the Eurozone Breakup Economic Recovery in Debt-Ridden Countries via Fast-Circulating, Slow-Leaking Regional Money By Christian Gelleri and Thomas Mayer, February 2012 English translation: Philip Beard, Ph.D. Abstract vide it with further billions of euros. Low-income The euro crisis can be overcome. The solution people bear practically no increased burden. is called Express Money. • EM credits carry a lower interest rate than euro Its advantages are as follows: credits, thus facilitating economic investment. • Using Express Money, the euro crisis coun- • The EM will quickly become the vehicle for a tries can speed up monetary circulation in their large percentage of domestic payment transac- tions. economies (”liquidity optimization”), thus promo- ting economic growth, creating new jobs, en- • The EM will circulate only in the real goods- hancing tax revenues, and reducing their depen- and-services economy, since it will not be sui- dence on foreign countries. table for speculative ”financial products”. • The parliaments and governments of Greece, • Countries will gain the benefits of a regional Portugal, and/or Ireland can move autonomously currency while not being forced out of the euro to adopt a government-issued regional curren- – an outcome far preferable to a catastrophic cy (henceforth: ”EM”, for Express Money). euro abandonment. • The EM is unique in two ways: 1) Via its spen- ding incentive (a user fee), monetary circulati- • Express Money will only come about, howe- on is accelerated, thereby stimulating the eco- ver, once the idea finds its way to responsible nomy. -

Revue Interventions Économiques, 59 | 2018 Why Are Complementary Currency Systems Difficult to Grasp Within Conventional
Revue Interventions économiques Papers in Political Economy 59 | 2018 La nature sociale de la monnaie. Enjeux théoriques et portée institutionnelle Why Are Complementary Currency Systems Difficult to Grasp within Conventional Economics? Pourquoi les monnaies complémentaires sont-elles ignorées par l’approche économique conventionnelle ? Marie Fare and Pepita Ould Ahmed Electronic version URL: http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/3960 DOI: 10.4000/interventionseconomiques.3960 ISBN: 1710-7377 ISSN: 1710-7377 Publisher Association d’Économie Politique Electronic reference Marie Fare and Pepita Ould Ahmed, « Why Are Complementary Currency Systems Difficult to Grasp within Conventional Economics? », Revue Interventions économiques [Online], 59 | 2018, Online since 01 January 2018, connection on 15 June 2019. URL : http://journals.openedition.org/ interventionseconomiques/3960 ; DOI : 10.4000/interventionseconomiques.3960 This text was automatically generated on 15 June 2019. Les contenus de la revue Interventions économiques sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International. Why Are Complementary Currency Systems Difficult to Grasp within Conventional... 1 Why Are Complementary Currency Systems Difficult to Grasp within Conventional Economics? Pourquoi les monnaies complémentaires sont-elles ignorées par l’approche économique conventionnelle ? Marie Fare and Pepita Ould Ahmed 1. Introduction 1 By “complementary currency system” (CCS) we mean a specific unit (or system) of account that complements the official currency and has been developed by a group of agents (individuals, economic and social structures, local authorities or banks) that has formed a local network with a view to accounting for and regulating exchanges of goods and services. From a functionalist theoretical viewpoint CCSs are money. -

Give Greece a Chance – with a Parallel Currency That Stays
Give Greece a chance – with a parallel currency that stays In 2011, Christian Gelleri and Thomas Mayer proposed a second currency for Greece. Since then the Greek problems have not been solved and have instead become worse. The country is still enduring severe economic problems and national bankruptcy remains dangerously close. A parallel currency »NEURO« could help to avoid the worst and act as a leverage for the better. he crisis in Greece is now ente - examples show that a decrease in income le - in contrast to the US, which has responded ring its eighth year. Per capita vels of 30 percent has caused a number of very expansively since 2008. While the US Fe - Gross Domestic Product (GDP) human tragedies. At the end of 2014 the deral Reserve printed dollars to buy large in 2008, the first year of reces - T sion, was about 23,200 euros. Taking into account taxes and duties, a Greek earned an average of 1,000 euros per month. In the wake of the economic crisis, GDP fell to just 16,500 Euro in 2014 and dis - posable income to about 700 euros per month. If the price of goods had fallen at the same rate, that would not be worth mentio - ning. However, a look at the cost of living in - dex in Greece for the same period shows an increase in prices. By comparison, the aver - age German income for 2008 was about 1,500 euros and is currently at about 1,600 euros per month. Economic Crisis Past And Present What would happen in Germany if the aver - age income dropped (at constant prices) to 1000 euros? We have to look back a long way before we find something comparable in Germany: the economic crisis of 1929 to 1933. -

The Macro-Economics of Crypto-Currencies: Balancing Entrepreneurialism and Monetary Policy
ENTREPRENEURSHIP & POLICY WORKING PAPER SERIES The Macro-Economics of Crypto-Currencies: Balancing Entrepreneurialism and Monetary Policy Eli Noam In 2016, the Nasdaq Educational Foundation awarded the Columbia University School of International and Public Affairs (SIPA) a multi-year grant to support initiatives at the intersection of digital entrepreneurship and public policy. Over the past three years, SIPA has undertaken new research, introduced new pedagogy, launched student venture competitions, and convened policy forums that have engaged scholars across Columbia University as well as entrepreneurs and leaders from both the public and private sectors. New research has covered three broad areas: Cities & Innovation; Digital Innovation & Entrepreneurial Solutions; and Emerging Global Digital Policy. Specific topics have included global education technology; cryptocurrencies and the new technologies of money; the urban innovation environment, with a focus on New York City; government measures to support the digital economy in Brazil, Shenzhen, China, and India; and entrepreneurship focused on addressing misinformation. With special thanks to the Nasdaq Educational Foundation for its support of SIPA’s Entrepreneurship and Policy Initiative. Table of Contents Abstract . 1 1. Introduction . 2. 2. A History of Governmental and Private Moneys . 2 A. United States . 3 . B. Other Examples of Private Moneys . .4 . 3. The Emergence of Electronic Moneys . 5 A. Electronic Moneys . 5 B. Distributed Ledger Technology . 6. C. Blockchain Technology . 6 D. Cryptocurrencies. 8 E. An Illustration of a Bitcoin Transaction . 9 4. Advantages and Drawbacks of Crypto-Currencies . 10 A. Advantages . 10 B. Problems . 11 C. The Potential for Improvements . 15 5. The Impact of Cryptocurrencies on Macro-Economic Policy . -

“An Important and Timely Book” Professor Nigel Dodd, London School of Economics
“An important and timely book” Professor Nigel Dodd, London School of Economics Designing, developing & delivering community currencies Forewords by Molly Scott Cato & Nigel Dodd People Powered Money is the result of a project running from 2012-2015, Community Currencies in Action (CCIA). Part-funded by the European Union’s Interreg project, CCIA is a transnational project in the community currency field, bringing together expert partners from across north-west Europe and co-ordinating six pilot currencies in the United Kingdom, Belgium, the Netherlands and France. Drawing on the learnings of these pilots and the broader currency innovation movement, this book provides policymakers and practitioners alike with the information and advice to successfully implement a currency project in their communities. With the right PART 01 C/02 01 PART knowledge and support, these can bring significant economic, social and environmental benefits to their users. Often confined to the margins, community currencies have the potential to become a normal part of economic life. CCIA hopes this book will enable a new generation of community currencies and support their emergence into the mainstream. PART 01 C/02 01 PART 04 PEOPLE POWERED MONEY PEOPLE POWERED MONEY 05 Designing, developing & delivering community currencies People Powered Money Designing, developing and delivering community currencies Acknowledgements First edition published in paperback in Great Britain in 2015 by This book would not have been possible without the commitment New Economics Foundation and contributions of our CCIA partners and many external experts 10 Salamanca Place who have worked on the topic for many years, as well as, of course, the London SE1 7HB (0)20 7820 6300 funding contributed by the European Union’s Interreg 4b NorthWest [email protected] Europe programme. -

Milton Friedman's Ninetieth Birthday November 2002 Fed “I Would Like to Say to Milton and Anna: Regarding the Great Depression
Monetary Theory Prof. Dr. Gerhard Illing M. Sc. Course Winter Term 2014/2015 Motivating Slides Part 0 © Prof. Illing Winter 2014/15 Part 0 1 What is money? © Prof. Illing Winter 2014/15 Part 0 2 Yap “Land of the Stone Money” © Prof. Illing Winter 2014/15 Part 0 3 Bundesbank Reallocation Gold-reserves 31.12.2012 31.12.2020 Frankfurt am Main 31 % 50 % New York 45 % 37 % London 13 % 13 % Paris 11 % 0 % © Prof. Illing Winter 2014/15 Part 0 4 Bundesbank Reallocation Gold-reserves 31.12.2012 31.12.2020 Frankfurt am Main 31 % 50 % New York 45 % 37 % London 13 % 13 % Paris 11 % 0 % © Prof. Illing Winter 2014/15 Part 0 5 Paper Money – Germany 1923 © Prof. Illing Winter 2014/15 Part 0 6 Goethe, Faust II, Erster Akt Zitiert von Jens Weidmann, Papiergeld – Staatsfinanzierung – Inflation. Traf Goethe ein Kernproblem der Geldpolitik?, 18.9.2012 Mephisto, als Narr verkleidet, spricht zum von Geldnöten geplagten Kaiser: „Wo fehlt’s nicht irgendwo auf dieser Welt? Dem dies, dem das, hier aber fehlt das Geld.“ Der Kaiser „Ich habe satt das ewige Wie und Wenn; Es fehlt an Geld, nun gut, so schaff’ es denn.“ Mephisto „ Ein solch Papier, an Gold und Perlen statt, Ist so bequem, man weiß doch, was man hat; Man braucht nicht erst zu markten, noch zu tauschen, Kann sich nach Lust in Lieb’ und Wein berauschen.“ © Prof. Illing Winter 2014/15 Part 0 7 Electronic Money – Bitcoin? © Prof. Illing Winter 2014/15 Part 0 8 Why does money matter? Core of micro-economic theory (Arrow Debreu framework): Complete set of state contingent contracts Only relative prices affect supply and demand; Changes in the value of the monetary unit (level of wages and prices in terms of some monetary unit) shouldn’t have any effect on the real economy. -

Article: Hayashi, K
International Journal of Community Currency Research VOLUME 25 (ISSUE 1, 2021) 96- 106 RETHINKING THE SIGNIFICANCE OF REGIONAL CURRENCIES: THE CASE OF THE CHIEMGAUER Kiminori Hayashi* * Meiji Gakuin University, Yokohama, Japan, [email protected] ABSTRACT The target of our analysis is the Chiemgauer, a German regional currency. This paper discusses notable aspects of Rudolf Steiner’s theory of money that have not yet been discussed widely in the research on regional currencies. The objectives and structure of the Chiemgauer is examined in Section 3. Following Steiner’s views on currency, Section 4 considers the merits and demerits for consumers, stores, and groups such as nonprofit organizations that are the recipients of its benefits and then revisits the significance of regional currencies. This paper makes a distinctive academic contribution by clarifying the new significance taken on by regional currencies based on Steiner’s discussions, particularly those on gifting. The first distinctive system design characteristic of the Chiemgauer is its relevance in the gifting process, even for those with few assets. Second, the Chiemgauer makes it easy to make voluntary gifting. Third, a system designed so that the ones actually giving the gifts are stores, and not consumers, enables the direct usage of the economic value created by the currency’s lending characteristics through the currency’s gifting characteristics. Skillfully incorporating gifting into the currency’s design makes it easier to ensure qualitative development in the region. The Chiemgauer incorporates the above ideas that go beyond increasing the velocity of currency circulation (Gesell’s idea of currency demurrage). KEYWORDS Chiemgauer, R. -

Democratizing Money-Chiemgauer Community Currency As a Collective
EasyChair Preprint № 1384 Democratizing Money - Chiemgauer Community Currency as a collective designed money Christian Gelleri EasyChair preprints are intended for rapid dissemination of research results and are integrated with the rest of EasyChair. August 9, 2019 Democratizing Money Chiemgauer Community Currency as a collective designed money RAMICS-conference 2019 at Hida-Takayama, Japan Author: Christian Gelleri University of Wuerzburg [email protected] How can the institutional design of money may be employed to strengthen self- determination, social cohesion and sustainability? Example of the Chiemgauer Currency Starting point is the example of the Chiemgauer that is located in the southeast of Germany between Munich and Salzburg. The Chiemgauer currency has begun as a school project in 2002 with six female students who wanted to experience an alternative form of money in a students projekt. Students (and teachers) should learn about what money is, what money does and what money can change with the help of a action-oriented pedagogic approach. For this purpose students, teachers and parents formed a non-profit organization in 2003 (‘Chiemgauer e. V.’) as issuer of the local currency. The non-profit-organization prints the money, do education and research work and look for members. What are the objectives of the Chiemgauer Currency? Main objectives of the Chiemgauer are regional development, promoting non-profits, increasing the share of ‘gift money’ and sustainability. In the case of output gaps and unemployment the local currency should work as a ‘lifeboat’. Except for a small period in 2009 the last function wasn’t necessary in the booming area of upper bavaria which belongs to the ten procent top regions in Europe1. -
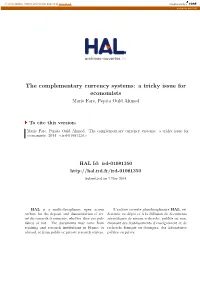
The Complementary Currency Systems: a Tricky Issue for Economists Marie Fare, Pepita Ould Ahmed
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL-UJM The complementary currency systems: a tricky issue for economists Marie Fare, Pepita Ould Ahmed To cite this version: Marie Fare, Pepita Ould Ahmed. The complementary currency systems: a tricky issue for economists. 2014. <ird-01081350> HAL Id: ird-01081350 http://hal.ird.fr/ird-01081350 Submitted on 7 Nov 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. The complementary currency systems: a tricky issue for economists Abstract: By complementary currency systems (CCS) we mean a specific unit of account that complements the official currency and has been developed on a group of agents that have formed a network or operate in a defined territory, with a view to accounting for and regulating exchanges of goods and services. Despite the topicality and the number of CCS, economists seem apparently pays only marginal attention to them. This article suggests that economics is based on a particular methodological and epistemological approach and on theoretical and normative conceptions of money that prevent it from taking into account the CCS’s practices, their logics and their impacts. -

Waluta Lokalna – Empiryczna Analiza Poziomu Znajomości I Akceptacji Wśród Przedstawicieli Młodego Pokolenia
Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl Data: 30/09/2021 20:25:43 DOI:10.17951/h.2021.55.1.67-84 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA VOL. LV, 1 SECTIO H 2021 MIROSŁAW SOŁTYSIAK [email protected] Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów, Polska ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3366-1537 Waluta lokalna – empiryczna analiza poziomu znajomości i akceptacji wśród przedstawicieli młodego pokolenia Local Currency – an Empirical Analysis of the Level of Knowledge and Acceptance among the Representatives of the Young Generation Keywords: local currency; issue; young generation of Poles Słowa kluczowe: waluta lokalna;UMCS emisja; młode pokolenie Polaków JEL: G21 Propozycja cytowania: Sołtysiak, M. (2021). Waluta lokalna – empiryczna analiza poziomu znajomości i akceptacji wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 55, No. 1. Abstract Theoretical background: The issue of the functioning of local currencies is very rarely discussed in Polish literature, there are no comprehensive studies on this subject. Currently, there are several thousand local currencies in the world, the issue of which is aimed at stimulating the local economy. In Poland, there are also attempts to introduce local currencies into circulation. Therefore, it is important to examine the attitude of citizens to such a currency. Purpose of the article: Determining the level of knowledge of issues -

On Velocity in Several Complementary Currencies
On Velocity in Several Complementary Currencies Josep Lluis de la Rosa1 and James Stodder2 1TECNIO Centre EASY, University of Girona, Catalonia, EU; [email protected] 2 Rensselaer Polytechnic Institute, Hartford, CT, USA; [email protected] Keywords: Velocity, WIR, Berkshares, RES, Chiemgauer, Sol Violette, Talente, Bristol Pound, Palmas Abstract: We analyse the velocity of several complementary currencies, notably the WIR, with RES, Chiemgauer, Sol, Berkshares dollars, and several other cases. Then, we describe the diversity in their velocities, and potential explanations for that. For example, WIR velocity is 2.6 while RES velocity is 1.9. Despite being similar currencies, the difference is in WIR blended loans among other benefits. A hypothesis on how velocity is increased, apart from prevailing demurrage approaches, will be described using the comparative method among cases. Introduction For the principal author of this study (Josep Lluis), although I’ve been working with virtual currencies for social networks and intelligent agents since 2006 and published a paper in the IJCCR [Carrillo et al., 2007], this is a first contribution in studies of velocities to the community of complementary currencies in the main stream of this new research area. This was done from a perspective of an academic in IT; i.e., a novice practitioner in complementary currencies. So I’m approaching the subject of the velocities from a naïve perspective of a practitioner, and I am eager to understand the success factors for the deployment of a new currency from the perspective of the velocity. I’m narrowing the focus of the study to velocity for the sake of simplicity. -

FX Wars, Currency Wars & Money Wars
Dinero electrónico FX wars, currency wars & money wars Part 2: Fiat Money vs. Cryptocurrencies Private vs. Public digital currencies… Discussion Paper # 44 I January 2020 Philippe ITHURBIDE, Senior Economic Advisor Document for the exclusive attention of professional clients, investment services providers and any other professional of the financial industry FX wars, currency wars and money wars Part 2: Fiat Money vs. Cryptocurrencies – Private vs. Public digital currencies… Philippe ITHURBIDE Abstract (Part 2) Senior Economic Advisor he first part of this study analysed the Tcompetition between USD, RMB and EURO and presented the challenges for China and Europe January 4, 2020 (*) to develop a genuine international currencies, having the capacity to compete with the USD (see Part 1: “FX wars vs. currency wars: SD vs. EUR vs. RMB vs …”; DP # 43, January 2020)). However, currency competition goes well beyond the “simple” competition between sovereign currencies (USD, EUR, RMB, JPY, CHF...). The advent of private digital currencies and very soon the first central bank digital currencies represent an important and new phenomenon: it shows that the world has entered a “total digital (disruptive) era”, and currencies are Value does not no exception. exist outside the In less than 10 years, consciousness of men” additional forms of monies have Carl MENGER (1840 – 1921), “Principles of Economics” – 1871 (1976 surfaced: central English editior banks digital currencies (a few), digital currencies (plenty), local currencies (some) and investment money (major projects ongoing), while electronic monies are gaining ground (vs. cash). Digital (*) The first version of this article had been prepared for an Amundi Advisory Board meeting (7 November 2019).