Antrag Von BÜNDNIS 90
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Drucksache 19/24635
Deutscher Bundestag Drucksache 19/24635 19. Wahlperiode 24.11.2020 Antrag der Abgeordneten Margit Stumpp, Kai Gehring, Dr. Anna Christmann, Beate Walter-Rosenheimer, Dr. Janosch Dahmen, Erhard Grundl, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Maria Klein-Schmeink, Ulle Schauws, Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Kordula Schulz-Asche, Annalena Baerbock, Ekin Deligöz, Markus Kurth, Sven Lehmann, Claudia Müller, Beate Müller- Gemmeke, Lisa Paus, Corinna Rüffer und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bildungschancen gewährleisten, Kinder und Beschäftigte schützen und das Infektionsgeschehen eindämmen – Förderprogramm für mobile Luftfilter in Klassenräumen und Kindertageseinrichtungen Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Der erste Lockdown hat offenbart, wie sehr Bildungschancen und ein für Kinder wich- tiges Sozialgefüge eingeschränkt werden, wenn Bildungs- und Betreuungseinrichtun- gen geschlossen werden. Obwohl mit einer Verschärfung der Infektionslage im Herbst und Winter gerechnet werden konnte, wurde vielerorts zu wenig getan, um wichtige Bereiche wie Bildungseinrichtungen bei der Vorbereitung auf diese Phase zu unter- stützen und vorzubereiten. Um das Infektionsrisiko für Kinder, Jugendliche, Betreue- rInnen und LehrerInnen zu reduzieren, braucht es ein ganzes Set von Maßnahmen. Mit der Verengung auf Einzelmaßnahmen wird ein angemessenes Schutzniveau nicht zu erreichen sein. Nun müssen deshalb mit hohem Tempo alle Möglichkeiten ausge- schöpft werden, damit Schulen und Kitas auch im weiteren Verlauf der Pandemie weit- -

BT Drs. 19/17750
Deutscher Bundestag Drucksache 19/17750 19. Wahlperiode 10.03.2020 Vorabfassung Antrag der Abgeordneten Renate Künast, Dr. Irene Mihalic, Dr. Konstantin von Notz, Tabea Rößner, Luise Amtsberg, Canan Bayram, Katja Dörner, Erhard Grundl, Britta Haßelmann, Katja Keul, Monika Lazar, Steffi Lemke, Cem Özdemir, Filiz Polat, Claudia Roth, Dr. Manuela Rottmann, Ulle Schauws, Charlotte Schneidewind- Hartnagel, Kordula Schulz-Asche, Margit Stumpp, Beate Walter-Rosenheimer und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - wird Hass und Hetze wirksam bekämpfen, Betroffene stärken und Bürgerrechte schützen durch Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: die Zur wirksamen Bekämpfung von Rechtsextremismus, der Bedrohung ganzer Be- völkerungsgruppen sowie von Hass und Hetze im Netz bedarf es einer koordinier- ten Gesamtstrategie, die das Problemfeld auf seinen sämtlichen Ebenen bearbei- lektorierte tet: als rechtsextreme Strategie zur Aushöhlung der Demokratie, als gesamtgesell- schaftliches Phänomen einer Verrohung der Debattenkultur und als Fortsetzung wie Befeuerung analoger Formen von Diskriminierung und Gewalt. Rassistischer, antisemitischer, antiziganistischer, muslimfeindlicher, völkischer, antifeministischer, homo- und transfeindlicher Propaganda und Agitation muss mit aller Entschlossenheit begegnet werden. Menschenverachtenden Ideologien der Ungleichwertigkeit muss entschieden widersprochen und der Strategie einer Normalisierung des vormals Unsagbaren entschlossen begegnet werden. Die dem Gesetzentwurf der Bundesregierung -

Zeitschrift: Profil:GRÜN, Ausgabe Juli 2021
DAS MAGAZIN DER PROFIL BUNDESTAGSFRAKTION GRüN Freiheit BRAUCHT KLIMASCHUTZ 04/2007/21 07/21 EDITORIAL FREIHEIT BRAUCHT KLIMASCHUTZ Konsequenter Klimaschutz bringt uns und kommenden Generationen mehr Freiheit. Wir müssen sie aber neu denken. Anton Hofreiter, Lisa Badum, Oliver Krischer und Manuela Rottmann leuchten das Thema aus. Seite 4 Paul Bohnert Foto: Ebenso zukunftsvergessen sieht ihre Haushalts- planung aus. Nach der Corona-Krise stehen die öffentlichen Haushalte vor großen Schwierig- SNach der Pandemie braucht unser Land einen neuen keiten. Zugleich sind jetzt zusätzliche Investitio- WIN-WINVESTIEREN Aufbruch.S Zeit für ein kraftvolles Investitionsprogramm in nen erforderlich: in gute Bildung, schnelles Klimaschutz und Digitalisierung, in Bildung und Gesundheit, sagen Anja Hajduk und Sven-Christian Kindler. Seite 10 Internet, neue klimaneutrale Infrastrukturen. Mehr Mittel müssen auch in Forschung, in die Technologien von morgen und in eine gute regi- Liebe Leser*innen, onale Daseinsfürsorge fließen. Wenn wir das Wwirkt Kirsten Kappert-Gonther. Kunst und Kultur sind jetzt nicht anpacken, setzen wir unsere Zukunft ANSTECKEND POSITIVzz ihr Lebenselixier. Die Gesundheitspolitikerin im Porträt die 19. Wahlperiode des Bundestages liegt fast schon hinter uns. aufs Spiel. Wir laufen nicht nur Gefahr, den von Gisela Hüber. Seite 12 Auch auf den letzten Metern haben Regierung und Große Koaliti- wirtschaftlichen Anschluss zu verlieren, son- on nicht mehr als den kleinsten gemeinsamen Nenner zustande dern beschädigen auch immer mehr den sozia- gebracht. len Zusammenhalt in unserem Land. Um die Frage, wie die so dringend notwendige Investi- SKinderrechte gehören ins Grundgesetz, schon seit Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts stand die Koali- tionsoffensive gelingen soll, mogeln sich die Langem. In dieser Wahlperiode gab es die Chance, tion unter Druck, die Ziele im Klimaschutzgesetz nachzuschär- KINDER INS ZENTRUM Fraktionen von Union und SPD herum. -

Motion: Europe Is Worth It – for a Green Recovery Rooted in Solidarity and A
German Bundestag Printed paper 19/20564 19th electoral term 30 June 2020 version Preliminary Motion tabled by the Members of the Bundestag Agnieszka Brugger, Anja Hajduk, Dr Franziska Brantner, Sven-Christian Kindler, Dr Frithjof Schmidt, Margarete Bause, Kai Gehring, Uwe Kekeritz, Katja Keul, Dr Tobias Lindner, Omid Nouripour, Cem Özdemir, Claudia Roth, Manuel Sarrazin, Jürgen Trittin, Ottmar von Holtz, Luise Amtsberg, Lisa Badum, Danyal Bayaz, Ekin Deligöz, Katja Dörner, Katharina Dröge, Britta Haßelmann, Steffi Lemke, Claudia Müller, Beate Müller-Gemmeke, Erhard Grundl, Dr Kirsten Kappert-Gonther, Maria Klein-Schmeink, Christian Kühn, Stephan Kühn, Stefan Schmidt, Dr Wolfgang Strengmann-Kuhn, Markus Tressel, Lisa Paus, Tabea Rößner, Corinna Rüffer, Margit Stumpp, Dr Konstantin von Notz, Dr Julia Verlinden, Beate Walter-Rosenheimer, Gerhard Zickenheiner and the Alliance 90/The Greens parliamentary group be to Europe is worth it – for a green recovery rooted in solidarity and a strong 2021- 2027 EU budget the by replaced The Bundestag is requested to adopt the following resolution: I. The German Bundestag notes: A strong European Union (EU) built on solidarity which protects its citizens and our livelihoods is the best investment we can make in our future. Our aim is an EU that also and especially proves its worth during these difficult times of the corona pandemic, that fosters democracy, prosperity, equality and health and that resolutely tackles the challenge of the century that is climate protection. We need an EU that bolsters international cooperation on the world stage and does not abandon the weakest on this earth. proofread This requires an EU capable of taking effective action both internally and externally, it requires greater solidarity on our continent and beyond - because no country can effectively combat the climate crisis on its own, no country can stamp out the pandemic on its own. -

KI-Monitor 2021 Status Quo Der Künstlichen Intelligenz in Deutschland Gutachten
KI-Monitor 2021 Status quo der Künstlichen Intelligenz in Deutschland Gutachten www.bvdw.org Das dieser Publikation zugrundliegende Gutachten wurde durchgeführt im Auftrag des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V Schumannstraße 2 10117 Berlin vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Konrad-Adenauer-Ufer 21 50668 Köln Ansprechpartner BVDW: Marco Junk, Geschäftsführer Redaktion BVDW: Dr. Anna Dietrich, Referentin Mobilität, KI & Smart Cities Ansprechpartner IW: Dr. Vera Demary Dr. Henry Goecke Autoren IW: Jan Büchel Dr. Vera Demary Dr. Henry Goecke Enno Kohlisch Dr. Oliver Koppel Dr. Armin Mertens Dr. Christian Rusche Dr. Marc Scheufen Jan Wendt KI-Monitor 2021 Status quo der Künstlichen Intelligenz in Deutschland Gutachten Zusammenfassung 2 1 Einleitung 5 2 Entwicklungen und vorhandene Literatur 6 2.1 Aktuelle politische Entwicklungen 6 2.2 Literaturanalyse zu KI 8 3 Struktur und Bestandteile des KI-Index 12 3.1 Kategorie Rahmenbedingungen 13 3.1.1 Digitale Infrastruktur 13 3.1.2 KI in Bundestagsprotokollen 15 3.1.3 Informatikabsolventen 16 3.1.4 Wissenschaftliche KI-Publikationen 16 3.1.5 Kooperationen zwischen KI-Forschung und Unternehmen 18 3.2 Kategorie Wirtschaft 20 3.2.1 Einschätzung der Bedeutung von KI durch Unternehmen 20 3.2.2 Einsatz von KI in Unternehmen 21 3.2.3 KI in Geschäftsberichten 22 3.2.4 KI-Patentanmeldungen 23 3.2.5 KI in Stellenanzeigen 25 3.3 Kategorie Gesellschaft 27 3.3.1 Bekanntheit von KI in der Gesellschaft 27 3.3.2 KI in den Printmedien 27 3.3.3 KI auf Twitter 30 3.3.4 Google-Suchinteresse an KI 31 4 Ergebnisse des KI-Index 34 4.1 Entwicklungen bei den Rahmenbedingungen 35 4.2 Entwicklungen in der Wirtschaft 37 4.3 Entwicklungen in der Gesellschaft 40 5 Handlungsempfehlungen 42 5.1 Rahmenbedingungen 42 5.2 Wirtschaft 46 5.3 Gesellschaft 53 6 Fazit 50 Anhang 51 Literaturverzeichnis 54 Über uns 63 Impressum 64 Zusammenfassung Zusammenfassung Bei der Künstlichen Intelligenz (KI) handelt es sich um eine Schlüsseltechnologie, die nahezu in allen Bereichen der Gesellschaft sowie der Wirtschaft Anwendung finden kann. -

Drucksache 19/15089 19
Deutscher Bundestag Drucksache 19/15089 19. Wahlperiode 13.11.2019 Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Manuela Rottmann, Kordula Schulz-Asche, Maria Klein- Schmeink, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Dr. Bettina Hoffmann, Katja Dörner, Dr. Anna Christmann, Kai Gehring, Erhard Grundl, Ulle Schauws, Margit Stumpp, Beate Walter-Rosenheimer und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Borreliose und FSME – Evaluierung und besserer Schutz für Risikogruppen Im Zusammenhang mit sich häufenden Hitzeperioden in Deutschland warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor einem erhöhten Infektionsrisiko bei Zeckenbissen (www.br.de/nachrichten/wissen/2019-wird-ein-zeckensom mer-bayern-fast-komplett-risikogebiet,RJ52aVA) sowie vor neuen Zeckenar- ten, die sich aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen in Deutsch- land ansiedeln. Immer mehr Menschen erkranken infolge eines Zeckenbisses an der sogenannten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). So wurde für das Hitzerekord-Jahr 2018 mit 538 gemeldeten Fällen der höchste Wert seit Einfüh- rung der Meldepflicht im Jahr 2001 erfasst (vgl. www.labor-enders.de/ 224.98.html). Aufgrund mangelnder Routine in der Diagnostik und teilweise diffuser Symptomatik ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Angehöri- ge von berufsbedingten Risikogruppen wie Försterinnen und Förster oder Schä- ferinnen und Schäfer sind einer besonderen Gefahr ausgesetzt, gegen die es derzeit keine zuverlässige Absicherung gibt. So lehnte das Landessozialgericht Hessen die Anerkennung von Borreliose als Berufskrankheit zuletzt ab – unter anderem mit der Begründung, dass der Vollbeweis einer klinisch manifesten Lyme-Borreliose-Erkrankung nicht erbracht werden konnte (vgl. https://open jur.de/u/307942.html). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es bisher nicht geglückt, einen eindeutigen Vollbeweis für eine Borreliose und den Zu- sammenhang mit diversen Folgeerkrankungen zu erbringen. -

All Together Now!
Foto: Mauritius Foto: All together DIE BUNDESTAGSFRAKTION IN DER 19. WAHLPERIODE now! UNS GEHT'S UMS GANZE INHALT . _____ S. 4 Die Fraktionsvorsitzenden . _____ S. 8 Der Fraktionsvorstand . _____ S. 10 So arbeitet der Vorstand . _____ S. 12 All together now – die grüne Bundestagsfraktion . _____ S. 14 So arbeiten die Abgeordneten . _____ S. 16 Organigramm der Fraktion . _____ S. 18 Arbeitskreis 1 . _____ S. 26 Arbeitskreis 2 . _____ S. 34 Arbeitskreis 3 . _____ S. 40 Arbeitskreis 4 . _____ S. 48 Arbeitskreis 5 . _____ S. 53 Kontakt . _____ S. 54 Index der MdB 2 3 Nach der längsten Regierungsbildung in Mit ihrer Wahlentscheidung haben die Bürgerinnen und Bürger der Geschichte der Bundesrepublik folgt einen unübersehbaren Hinweis gegeben, dass es in unserem DIE FRAKTIONSVORSITZENDEN in dieser 19. Wahlperiode zum ersten Land wieder ums Grundsätzliche geht. Diese Auseinanderset- Mal unmittelbar auf eine Große Koali- zung über die Grundwerte und Grundordnung unseres Zusam- tion gleich die nächste. Was eigentlich menlebens sowie über die Rolle der parlamentarischen Demo- DR. ANTON HOFREITER KATRIN GÖRING-ECKARDT die Ausnahme sein sollte, wird zur kratie für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft nehmen wir Regel. Es ist schon absehbar, dass dieser entschieden an. Regierung Mut, Weitblick und Tatkraft Wir gehen mit einem klaren Kompass in diese Wahlperiode. fehlen werden. Und zum allerersten Mal Dem Klein-Klein, wie es von der Großen Koalition des gegenseiti- sitzt im Bundestag eine rechtspopulisti- gen Misstrauens zu erwarten ist, setzen wir genau umrissene sche, teils rechtsextreme Fraktion. Schwerpunkte entgegen: Zur Bewältigung der großen Zukunfts- Unsere Aufgabe als Opposition sehen aufgaben wollen wir vernetzt und jenseits starrer Ressortzustän- Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzende wir natürlich darin, notwendige Kritik digkeiten in sechs übergreifenden Arbeitsfeldern innovative und Dipl. -

Drucksache 19/26439 19
Deutscher Bundestag Drucksache 19/26439 19. Wahlperiode 05.02.2021 Fragen für die Fragestunde der 208. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, dem 10. Februar 2021 Verzeichnis der Fragenden Abgeordnete Nummer Abgeordnete Nummer der Frage der Frage Akbulut, Gökay (DIE LINKE.) ...............88, 89 Holtz, Ottmar von Amtsberg, Luise (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ...............90, 91 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .................. 78 Hunko, Andrej (DIE LINKE.) .................32, 45 Badum, Lisa (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ......5 Jelpke, Ulla (DIE LINKE.) ....................17, 41 Baerbock, Annalena Jung, Christian, Dr. (FDP) ....................60, 61 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ...............12, 37 Kappert-Gonther, Kirsten, Dr. Bayram, Canan (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ...............51, 92 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ...............46, 71 Kekeritz, Uwe Brandner, Stephan (AfD) ........................1, 2 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ...............67, 68 Dağdelen, Sevim (DIE LINKE.) ..............18, 84 Kindler, Sven-Christian De Masi, Fabio (DIE LINKE.) ................82, 83 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ...............53, 54 Dröge, Katharina Klein-Schmeink, Maria (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ................4, 42 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ...............49, 50 Faber, Marcus, Dr. (FDP) ......................6, 52 Kotting-Uhl, Sylvia (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ................9, 63 Friesen, Anton, Dr. (AfD) .....................35, 85 Kraft, Rainer, Dr. (AfD) .......................8, 69 Gastel, Matthias (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ...............55, 56 Krischer, Oliver (BÜNDNIS -

Causales DEMOKRATISCH
CULTUREINVEST!-CONGRESS PROGRAM 2020 Location: Hans-Otto-Theater Reithalle Fabrik T-Werk Kunstraum Fluxus Waschhaus EUROPE’S LEADING CULTURE CONGRESS MAIN PANEL A. B. C. D. E. WORKSHOP DO 26.11. CLIMATE, CRISIS & CULTURE GREEN CULTURAL MANAGEMENT DIGITAL TRANSFORMATION WORK CLIMATE & RECRUITING CULTURAL FACILITIES RURAL AREAS CULTURAL DEVELOPMENT KLIMANEUTRAL. Topic Partner causales DEMOKRATISCH. Moderation Stephan Abarbanell Dr. Annett Baumast Holger Kurtz Prof. Dr. Oliver Scheytt Dr. Pablo v. Frankenberg Claudia Kühn Dr. Eckhard Braun 8:00 — 9:00 Check-In 9:00 — 9:45 Opening Session | Moderation: Andrea Thilo | Hans-Conrad Walter, Causales GmbH, Managing Partner PARTIZIPATIV. Noosha Aubel, Councillor Education, Culture,Youth an9d: 0Sp0o—rt9 o:4f t5 he State Capital Potsdam Dr. Manja Schüle, Minister for Science, Research and Culture of the State of Brandenburg Keynote: Robert Habeck, Federal President of the Green Party Inspiring cultural leadership for Technology as foundation for a sustainable The Role of Recruitment For a Functioning Impacts of climate change on historic Off to the counrty! – Opportunities and Welcome 10:00 — 10:45 Challenge Climate Change! Dr. Robert Habeck, Federal President of Green Party a sustainable future (tbc) digital transformation in the areas of arts Work Climate (Conversation) buildings and interior conditions challenges for art and culture in rural areas Noosha Aubel, Councillor Education, Culture, Prof. Dr. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, Director Alison Tickell, Julie's Bicycle, and culture Jasmin Vogel, Kulturforum Witten, CEO | Dr. Johanna Leissner, Fraunhofer-Gesellschaft / Brigitte Faber-Schmidt, Cultural Region Branden - Youth and Sport of the State Capital Potsdam 25.—2 7. November 2020 Emeritus of the Potsdam Institute for Climate Founder Timo Deiner, SAP Deutschland SE & Co KG, Dr. -
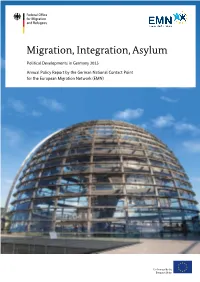
Migration, Integration, Asylum
Migration, Integration, Asylum Political Developments in Germany 2015 Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) Co-financed by the European Union Migration, Integration, Asylum Political Developments in Germany 2015 Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN) Federal Office for Migration and Refugees 2016 Summary 5 Summary The German Bundestag passed a number of amendments The 2015 Policy Report of the German National Contact over the course of 2015, which include Point for the European Migration Network (EMN) provides an overview of the most important political dis- ■■ the Act on the redefinition of the right to stay and cussions as well as political and legislative developments the termination of residence (entry into force: in the areas of migration, integration, and asylum in the 1 August 2015), Federal Republic of Germany in the year 2015. The report ■■ Act on the Acceleration of Asylum Procedures – refers specifically to measures taken by the Federal Asylum Package I (entry into force: 24 October 2015), Republic of Germany to implement the Global Approach ■■ Act to improve accommodation, care and assistance to Migration and Mobility, the EU Strategy towards for foreign children and young persons (entry into the Eradication of Trafficking in Human Beings and the force: 1 November 2015), European Agenda for the Integration of Third-Country ■■ Third Victims’ Rights Reform Act (entry into force: Nationals. The report also describes the general struc- 31 December 2015). ture of the political and legal system in Germany. In addition to the legislation of the Bundestag, the Federal Ministry for Labour and Social Affairs (BMAS) revised the The jump in asylum migration and how to deal with it Employment Ordinance (BeschV) in 2015, which forms the was the central migration, integration and asylum issue basis for allowing immigrants in certain occupations and in 2015. -

Deutscher Bundestag Drucksache 19/3143
Deutscher Bundestag Drucksache 19/3143 19. Wahlperiode 03.07.2018 Vorabfassung Antrag der Abgeordneten Kai Gehring, Ekin Deligöz, Dr. Anna Christmann, Margit Stumpp, Beate Walter-Rosenheimer, Katja Dörner, Erhard Grundl, Dr. Kirsten Kappert- Gonther, Maria Klein-Schmeink, Ulle Schauws, Kordula Schulz-Asche, Kerstin Andreae, Katharina Dröge, Stefan Schmidt und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - wird Neue Dynamik für die Hochschulfinanzierung durch Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deusche Bundestag stellt fest: Die Hochschulen in Deutschland sind unverzichtbare Orte unserer Wissensgesell- die schaft. An ihnen wird gelehrt, gelernt und geforscht. In Hörsälen, Seminarräumen und Forschungslaboren entwickeln kluge Köpfe und kreative Talente zukunfts- weisende Ideen, arbeiten an technischen, sozialen und ökologischen Innovationen und geben Antworten auf die drängenden Herausforderungen unserer Zeit. lektorierte In den letzten zehn Jahren wurden seitens des Bundes und der Länder erhebliche öffentliche Zusatzmittel in das Wissenschaftssystem investiert, unter anderem durch den Pakt für Forschung und Innovation, die Exzellenzstrategie, den Hoch- schulpakt 2020 und den Aufwuchs bei den Projektfördermitteln. Die Hauptprob- leme des deutschen Wissenschaftssystems, die mangelnde Grundfinanzierung der Hochschulen und die unsicheren Perspektiven für den wissenschaftlichen Nach- wuchs, wurden damit nicht behoben. So sind die Grundmittel pro Studierenden zwischen 2007 und 2015 von 7.500 auf rund 6.600 Euro gesunken. Die Verhand- lungen zwischen -

Bundeskanzleramt Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
Bundeskanzleramt Agnieszka Brugger Frau Bundeskanzlerin Erhard Grundl Ottmar von Holtz Dr. Angela Merkel Dr. Kirsten Kappert-Gonther Uwe Kekeritz POSTAUSTAUSCH Omid Nouripour Claudia Roth Frithjof Schmidt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Platz der Republik 1 11011 Berlin 24. Oktober 2018 Äußerungen Günter Nookes zu Afrika Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, die Äußerungen Ihres persönlichen Afrika-Beauftragten Günter Nooke in einem Interview mit der B.Z. vom 7. Oktober bereiten uns große Sorgen und werfen eine Reihe von Fragen auf. Herr Nooke behauptet in dem Interview, der Kolonialismus sei für Afrika weniger schädigend als der Kalte Krieg gewesen und habe gar „dazu beigetragen, den Kontinent aus archaischen Strukturen zu lösen“. Dies macht uns angesichts der Faktenlage und der immer noch laufenden Aufarbeitung der Kolonialzeit in ihrer Gesamtheit sprachlos. Dieser Blick auf den Kontinent impliziert, die vorkolonialen afrikanischen Gesellschaften seien als Ganze „rückständig“ gewesen und hätten der gewaltsamen Erlösung durch eine als fortschrittlicher postulierte europäische Zivilisation bedurft. Das ist im Kern rassistisch. Allein mit diesem Halbsatz disqualifiziert sich Herr Nooke als Afrika-Beauftragter der Bundesregierung. Seine lange Reihe stereotyper Charakterisierungen eines „anderen“ afrikanischen Kontinents, der geprägt sei von „Stammesführern“, „Ethnien“ und „tradierten Verhaltensweisen“ zementieren diesen Eindruck. Hinsichtlich der Beschreibung und Bewertung des Kolonialismus sind es aber auch die Unterlassungen, die wir erschreckend finden. Zwar erwähnt Herr Nooke die Sklaventransporte, die im Rahmen des Kolonialismus organisiert wurden. Doch die Millionen Todesopfer des Kolonialismus durch Krieg, Zwangsarbeit, Vertreibung und willkürliche Gewaltakte würdigt er nicht mit einer Silbe. Er unterlässt es, den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia durch deutsche „Schutztruppen“ zu verurteilen. Er verschweigt, dass die verheerenden wirtschaftlichen und kulturellen Nachwirkungen des Kolonialismus den afrikanischen Kontinent noch heute kennzeichnen.