Forum Musikbibliothek 1 / 2015 36. Jahrgang
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Forum Musikbibliothek Forum Musikbibliothek Beiträge Und Informationen Aus Der Musikbibliothekarischen Praxis 2013 34
ISSN 0173-5187 Forum Forum Musikbibliothek Forum Musikbibliothek Beiträge und Informationen aus der musikbibliothekarischen Praxis 2013 34. Jahrgang Beispiel eines reich ausgeschmück- ten Chorbuchs aus dem 16. Jahr- hundert mit sieben Messen, einer / 2013 3 Motette und einem deutschen geistlichen Lied als Nachtrag 3 (D-Mbs/Mus.ms. C, fol.41v–42r) Musikgeschichte im Spiegel von Liturgie und Herrschergunst – Die Digitalisierung der Chorbuch- sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek 7 Die Musikbibliothek Peters: Ein kulturhistorischer Schatz für Leipzig 13 Autographen und Handschriften von M. I. Glinka in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 18 Musikbibliothekarische Aus- und Fortbildung in Deutschland 24 ortus ortus _blau_FM_heft2/13_umschlag__hks ?+20%TF+45%ziffer Kopie.indd 1 14.10.13 14:22 Forum Musikbibliothek 3 / 2013 34. Jahrgang Forum Musikbibliothek Beiträge und Informationen aus der musikbibliothekarischen Praxis Herausgegeben von der AIBM/Gruppe Bundesrepublik Deutschland e. V. Redaktion Dr. Renate Hüsken, Frankfurt a. M. E-Mail [email protected] Schriftleitung Jürgen Diet (kommissarisch) c/o Bayerische Staatsbibliothek Musikabteilung Ludwigstr. 16 D-80539 München Fon +49 (0) 89 28638-2768 Bitte richten Sie Ihre Briefe und Fax +49 (0) 89 28638-2479 Anfragen ausschließlich an die Schrift- E-Mail [email protected] leitung, nicht an den Verlag! Unverlangt zugesandte Rezensions- Rezensionen Marina Gordienko exemplare können leider nicht zurück- E-Mail [email protected] geschickt werden. Internet www.aibm.info/publikationen/forum-musikbibliothek/ Dort auch Redaktionsschlüsse und Richtlinien zur Manuskriptgestaltung. Beirat Susanne Frintrop, München Marina Gordienko, Berlin Cornelia Grüneisen, Frankfurt a. M. Kristina Richts, Detmold Torsten Senkbeil, Lübeck Cordula Werbelow, Berlin Kathrin Winter, Mannheim Erscheinungsweise Jährlich 3 Hefte (März, Juli, November) Bezugsbedingungen Abonnementpreis Deutschland FM: 41,– EUR Jahresabonnement inkl. -

Ausgewählte Werke
Gottfried August Homilius Ausgewählte Werke Reihe 4: Instrumentalwerke Band 2 herausgegeben von Uwe Wolf In Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig Gottfried August Homilius 32 Praeludia zu geistlichen Liedern für zwei Claviere und Pedal Choralvorspiele für Orgel herausgegeben von Uwe Wolf Urtext 37.107 Vorwort […] Im nachmittäglichen Gottesdienste wurden 3 Lieder gesungen, und der seelige Mann hatte es sich zum Gesetz gemacht, allemal drey Gottfried August Homilius wurde am 2. Februar 1714 in Rosenthal verschiedene Vorspiele, auf die er sich den Sonnabend vorher sorgfältig vorbereitete, zu den 3 Liedern zu machen. […] Alle Musikkenner und (Sachsen) als Sohn eines Pastors geboren. Bereits kurz nach seiner Liebhaber versammelten sich Nachmittags in der Kirche, um diese Prälu- Geburt zog die Familie nach Porschendorf bei Pirna, wo Homilius dien zu hören, und Homilius erwarb sich damit den Ruhm eines großen, die ersten Jahre seines Lebens verbrachte.1 Nach dem Tod des Vaters selbst des größten Organisten seiner Zeit, wenn man Erfindung und Ge- wechselte er 1722 – wohl auf Betreiben seiner Mutter – an die von schmack mit in Anschlag bringt.7 deren Bruder geleitete Annenschule nach Dresden. Gegen Ende seiner Schulzeit übernahm Homilius bereits vertretungsweise den Von Daniel Gottlob Türk, einem anderen Schüler Homilius’, erfah- Organistendienst an der Annen-Kirche. ren wir, dass die erwähnte sorgfältige Vorbereitung tatsächlich im Im Mai 1735 wurde Homilius als Jurastudent an der Universität schriftlichen Fixieren der Praeludien bestand, -

ABKÜRZUNGEN 1. Allgemein ADB = Allgemeine Deutsche Biographie
ABKÜRZUNGEN 1. Allgemein ADB = Allgemeine Deutsche Biographie, hrsg. von der Historischen Commission bei der Königlichen Akademie der Wissen- schaften München, 56 Bde., Leipzig 1875 –1912 (Nach- druck 1967 –1971) AfMw = Archiv für Musikwissenschaft, 1918 –1926, 1952 ff. Am. B. = Amalien-Bibliothek (Dauerleihgabe in D-B) AMZ = Allgemeine Musikalische Zeitung, Leipzig 1799 –1848 Bach- Kolloquium Rostock = Das Frühwerk Johann Sebastian Bachs. Kolloquium, ver- anstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universi- tät Rostock 11. –13. September 1990, hrsg. von Karl Heller und Hans-Joachim Schulze, Köln 1995 Bach- Symposium Marburg = Bachforschung und Bachinterpretation heute. Wissen- schaftler und Praktiker im Dialog. Bericht über das Bach- fest-Symposium 1978 der Philipps-Universität Marburg, hrsg. von Reinhold Brinkmann, Kassel 1981 BC = Hans-Joachim Schulze und Christoph Wolff, Bach Com- pendium. Analytisch-bibliographisches Repertorium der Werke Johann Sebastian Bachs, Bd. I / 1– 4, Leipzig 1986 bis 1989 Beißwenger = Kirsten Beißwenger, Johann Sebastian Bachs Notenbib- liothek, Kassel 1992 (Catalogus Musicus. 13.) BG = J. S. Bachs Werke. Gesamtausgabe der Bachgesellschaft, Leipzig 1851–1899 BJ = Bach-Jahrbuch, 1904 ff. BuxWV = Georg Karstädt, Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Dietrich Buxtehude. Buxte- hude-Werke-Verzeichnis (BuxWV), Wiesbaden 1974 BWV = Wolfgang Schmieder, Thematisch-systematisches Ver- zeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach. Bach-Werke-Verzeichnis, Leipzig 1950 BWV2 = Bach-Werke-Verzeichnis (wie oben); 2. überarbeitete und erweiterte Ausgabe, Wiesbaden 1990 Bach-JB_2015.indb 5 11.11.15 14:27 6 Abkürzungen BWV2a = Bach-Werke-Verzeichnis. Kleine Ausgabe nach der von Wolfgang Schmieder vorgelegten 2. Ausgabe, hrsg. von Alfred Dürr und Yoshitake Kobayashi, unter Mitarbeit von Kirsten Beißwenger, Wiesbaden 1998 DDT = Denkmäler deutscher Tonkunst, hrsg. -

Jahresbericht 2017
JAHRESBERICHT 2017 BACHS ERbe – EiN AUFTRAG FÜR DIE ZUKUNFT Unser herzlicher Dank gilt allen Förderern, Sponsoren und Partnern des Bachfestes 2017 sowie des Meisterkurses 2017 in Leipzig. • arcona LIVING BACH14 Leipzig • Hochschule für Technik, Wirtschaft • nextbike GmbH • Bärenreiter-Verlag und Kultur Leipzig (HTWK) • PROMENADEN Hauptbahnhof Leipzig Karl Vötterle GmbH & Co. KG • HypoVereinsbank – Member of • Sächsisches Staatsministerium für • Die Beauftragte der Bundesregierung UniCredit Wissenschaft und Kunst (SMWK) für Kultur und Medien • Institut Français • Seaside Park Hotel Leipzig • BMW Niederlassung Leipzig • Leipzig Hotel Alliance • Sparkasse Leipzig • Christa Bach-Marschall-Stiftung • Leipzig Tourismus und • Stadt Leipzig • Deutschlandradio Kultur Marketing GmbH • Stiftung Chorherren zu St. Thomae • DIE ZEIT • Leipziger Verkehrsbetriebe • Ströer Deutsche Städte • Evangelisch-Lutherische Landes- GmbH (LVB) Medien GmbH kirche Sachsens • Leipziger Volkszeitung • TOTAL Raffinerie • fairgourmet GmbH • MDR Kultur Mitteldeutschland GmbH • GENUIN Classics • Mitteldeutsche Barockmusik in • Turkish Airlines Inc. • Goethe-Institut e. V. Sachsen, Sachsen-Anhalt und • Vereinigung der Freunde des • Hochschule für Musik und Theater Thüringen e. V. Bach-Archivs Leipzig e. V. „Felix Mendelssohn Bartholdy“ • Musikschule Leipzig Leipzig (HMT) „Johann Sebastian Bach“ JAHRESBERICHT 2017 BACHS ERbe – EIN AUFTRAG FÜR DIE ZUKUNFT INHALT 1. GRUSSWORT 4 2. VORWORT 6 3. BACH-ARCHIV LEIPZIG – AUFGABEN UND ZIELE 9 4. DAS INKLUSIVE BACH-MUSEUM 12 5. AN BACH VERERBEn – NACHLASSSPENDEN FÜR DAS BACH-ARCHIV 16 6. TÄTIGKEITSBERICHTE UND PROJEKTE 19 6.1. Forschungsinstitut 19 6.2. Bibliothek 25 6.3. Museum 34 6.4. Bachfest Leipzig 46 6.5. Meisterkurs 51 6.6. Kommunikation und Vermittlung 52 7. KOOPERATIONEN 57 7.1. Das Bach-Archiv – Institut an der Universität Leipzig 57 7.2. Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater 58 „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (HMT) 7.3. -
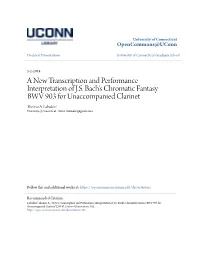
A New Transcription and Performance Interpretation of J.S. Bach's Chromatic Fantasy BWV 903 for Unaccompanied Clarinet Thomas A
University of Connecticut OpenCommons@UConn Doctoral Dissertations University of Connecticut Graduate School 5-2-2014 A New Transcription and Performance Interpretation of J.S. Bach's Chromatic Fantasy BWV 903 for Unaccompanied Clarinet Thomas A. Labadorf University of Connecticut - Storrs, [email protected] Follow this and additional works at: https://opencommons.uconn.edu/dissertations Recommended Citation Labadorf, Thomas A., "A New Transcription and Performance Interpretation of J.S. Bach's Chromatic Fantasy BWV 903 for Unaccompanied Clarinet" (2014). Doctoral Dissertations. 332. https://opencommons.uconn.edu/dissertations/332 A New Transcription and Performance Interpretation of J.S. Bach’s Chromatic Fantasy BWV 903 for Unaccompanied Clarinet Thomas A. Labadorf, D. M. A. University of Connecticut, 2014 A new transcription of Bach’s Chromatic Fantasy is presented to offset limitations of previous transcriptions by other editors. Certain shortcomings of the clarinet are addressed which add to the difficulty of creating an effective transcription for performance: the inability to sustain more than one note at a time, phrase length limited by breath capacity, and a limited pitch range. The clarinet, however, offers qualities not available to the keyboard that can serve to mitigate these shortcomings: voice-like legato to perform sweeping scalar and arpeggiated gestures, the increased ability to sustain melodic lines, use of dynamics to emphasize phrase shapes and highlight background melodies, and the ability to perform large leaps easily. A unique realization of the arpeggiated section takes advantage of the clarinet’s distinctive registers and references early treatises for an authentic wind instrument approach. A linear analysis, prepared by the author, serves as a basis for making decisions on phrase and dynamic placement. -

Vocalsacred Vocal Music Stuttgarter Bach-Ausgaben Urtext Im Dienste Historisch Informierter Complete Edition in 23 Volumes Aufführungspraxis
Kantaten · Messen · Oratorien Passionen · Motetten Bach The vocalSacred Vocal Music Stuttgarter Bach-Ausgaben Urtext im Dienste historisch informierter Complete Edition in 23 volumes Aufführungspraxis Attractive introductory price! valid through 31.1.2019 for study & performance Johann Sebastian Bach The Sacred Vocal Music Complete Edition in 23 volumes Edited by Ulrich Leisinger and Uwe Wolf in collaboration with the Bach-Archiv Leipzig I unreservedly recommend this to Bach lovers everywhere. Choir & Organ • For study and performance: the authoritative Urtext of the Stuttgart Bach Edition • Each volume contains a preface reflecting the latest state of Bach research • Complete performance material for all works available for sale: full score, vocal score, choral score, and the complete orchestral parts • Reader-friendly format, also suitable for conducting (19 x 27 cm, like a vocal score) Carus has placed great importance on scholarly new editions of the music. But the editions always have the performance in mind. Schweizer Musikzeitung With the Bach vocal project, we have published ‘mixed’ version as well as all complete surviving ver- Johann Sebastian Bach’s complete sacred vocal sions. Also, nine cantatas – such as the famous “Ein music in modern Urtext editions geared towards feste Burg” BWV 80/80b – are available in several historically- informed performance practice. We are versions. convinced that the needs of performing musicians Wherever the source material allowed a reconstruc- are best met by a scholarly authoritative music text, tion to be made, and the works were also relevant which neither patronizes the interpreters nor leaves for practical performance, Bach’s fragmentary them perplexed by decisions they need to make. -

Vocal Bach CV 40.398/30 KCMY Thevocal Sacred Vocal Music Stuttgart Bach Editions Complete Edition in 23 Volumes Urtext for Historically Informed Performance
Cantatas · Masses · Oratorios Bach Passions · Motets vocal Bach CV 40.398/30 KCMY Thevocal Sacred Vocal Music Stuttgart Bach Editions Complete Edition in 23 volumes Urtext for historically informed performance • The complete sacred vocal music by J. S. Bach • Musicologically reliable editions for the practical pursuit of music, taking into account the most current state of Bach research • Informative forewords on the work’s history, reception and performance practice • Complete performance material available: full score, vocal score, choral score, and orchestral parts • carus plus: innovative practice aids for choir singers (carus music, the choir app, Carus Choir Coach, practice CDs) and vocal scores XL in large print for the major choral works available • With English singable texts www.carus-verlag.com/en/composers/bach available from: for study & performance Johann Sebastian Bach: The Sacred Vocal Music Carus has placed great importance on scholarly new editions of the music. But the editions always have the performance in mind. Complete Edition in 23 volumes Schweizer Musikzeitung Edited by Ulrich Leisinger and Uwe Wolf in collaboration with the Bach-Archiv Leipzig With the Bach vocal project, we have published Wherever the source material allowed a reconstruc- • Reader-friendly and handy format Reconstructions Johann Sebastian Bach’s complete sacred vocal tion to be made, and the works were also relevant (like a vocal score) Pieter Dirksen: BWV 1882 music in modern Urtext editions geared towards for practical performance, Bach’s fragmentary Andreas Glöckner / Diethard Hellmann: BWV 2473 historically- informed performance practice. We are surviving vocal works have been included in the • User-friendly order following the Diethard Hellmann: BWV 186a3, 197a3 convinced that the needs of performing musicians Bach vocal publishing project, and some have been Bach Works Catalogue Klaus Hofmann: BWV 80b3, 1391, 1573 are best met by a scholarly authoritative music text, published for the first time in performable versions. -

An Outline of the Edition History of the Solo Cello Suites by JS Bach
Problematic Sources, Problematic Transmission: An Outline of the Edition History of the Solo Cello Suites by J. S. Bach Zoltán Szabó A Thesis submitted in fulfilment of requirements for the degree of PhD in Music (Musicology) Sydney Conservatorium of Music The University of Sydney 2016 P a g e | 1 Declaration I, Zoltán Szabó, hereby confirm that the work submitted is my own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgment. Signed: ___________________ Date: 15 July 2016 P a g e | 2 Acknowledgments This thesis was instigated by four decades of continuous exploration, practising, learning, performing and teaching of the Bach Cello Suites; the last four years of researching and collecting the editions and writing the dissertation was an added bonus. These four years have never ceased to be pleasurable and astonishing in their discoveries about myself, about the Master: Johann Sebastian, about how to read fast and write carefully, about how to conduct academic research and about learning a new style of thinking. I would have stumbled constantly on this road, had I not received professional and personal help from so many people. Librarians played a chief role in guiding me through the maze of confusing catalogues, books in storage and many intricate details of how to track down and obtain a source that may or may not even exist. Ludwig Sugiri and his colleagues at the Sydney Conservatorium of Music never grew tired of giving me time and attention or getting hold of yet another source, book or rare edition. -

Motetten Motets
Johann Sebastian BACH Motetten Motets Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226 Jesu, meine Freude BWV 227 Fürchte dich nicht, ich bin bei dir BWV 228 Komm, Jesu, komm BWV 229 Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230 Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn BWV Anh. 159 herausgegeben von/edited by Uwe Wolf Stuttgarter Bach-Ausgaben · Urtext In Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig C Carus 31.224/10 Inhalt Zur Neuausgabe III In ihrer Echtheit unbestrittene Motetten J. S. Bachs: 1. Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 1 Coro I: SATB, Coro II: SATB 2. Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226 33 Coro I: SATB, Coro II: SATB 3. Jesu, meine Freude BWV 227 49 Coro: SSATB 4. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir BWV 228 74 Coro I: SATB, Coro II: SATB 5. Komm, Jesu, komm BWV 229 90 Coro I: SATB, Coro II: SATB In ihrer Echtheit als Kompositionen J. S. Bachs umstrittene Motetten: 6. Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230 110 Coro: SATB, Bc 7. Ich lasse dich nicht BWV Anh. 159 124 Coro I: SATB, Coro II: SATB Kritischer Bericht 134 Die Motetten Bachs sind in folgenden Ausgaben erhältlich: – Partitur ohne Generalbassaussetzung, deutsch (Carus 31.224/10) – Partitur mit Generalbassaussetzung, deutsch /englisch (Carus 31.224, enthält zusätzlich BWV Anh. 160) Alle Motetten sind zudem in Einzelausgaben erhältlich (Partituren und Colla-parte-Stimmen) Die Motetten sind mit dem Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius auf CD eingespielt (Carus 83.298). -

Early Music Review EDITIONS of MUSIC Oboe, Violin, Viola and Cello Impressive, As Far As It Goes
Early Music Review EDITIONS OF MUSIC oboe, violin, viola and cello impressive, as far as it goes. But there’s a gap from bar 74 of the first movement: bars Frescobaldi Canzonen a 4... 75-164 are omitted. There is then a completely editorial , with no basis for it’s presence. The first section for four-part instrumental ensemble (Canto, Alto, Tenore Menuetto of the third and last movement ( 2/2 e Basso) and Basso continuo, Vol. II: Nos. V-X. Score and Rondo poco Andante – where does the heading come from?) is interrupted by Parts. a 6/8 beginning at bar 88, before the movement Edited by Friedrich Cerha. DM 1452. Allegro resumes at bar 104: the remaining 26 bars have no close Doblinger: Diletto Musicale. 36pp +5 parts. relationship with the first 20. I was struck when I played through the first movement, especially the exposition, reviewed the first volume in December 2014. The six which is varied and very impressive: I can understand that items here complete the final group of the 1634 edition. the editor longed to complete it, but there are no grounds They are numbered in continuation of Vol. 1. All are I for completely inventing most of the work. It could be notated in SATB except for the first canzon (No. V), Sopra an interesting adaptation by a student, but hardly worth Rugier, which is in high clefs except that the bass is F4: No. publication. Since it is published, it should be ascribed VI is Sopra Romanesca, the other four canzonas lack titles. -

Schauet Doch Und Sehet Look Ye Then and See Now BWV 46
Johann Sebastian BACH Schauet doch und sehet Look ye then and see now BWV 46 Kantate zum 10. Sonntag nach Trinitatis für Soli (ATB), Chor (SATB) 2 Blockflöten, 2 Oboen da caccia, Zugtrompete 2 Violinen, Viola und Basso continuo herausgegeben von Paul Horn revidiert von Uwe Wolf Cantata for the 10th Sunday after Trinity for soli (ATB), choir (SATB) 2 recorders, 2 oboes da caccia, slide trumpet 2 violins, viola and basso continuo edited by Paul Horn, revised by Uwe Wolf English version by Henry S. Drinker revised by Gordon Paine Stuttgarter Bach-Ausgaben · Urtext In Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig Partitur/Full score C Carus 31.046 Inhalt Vorwort / Foreword / Avant-propos 3 1. Coro 7 Schauet doch und sehet Look ye then and see now 2. Recitativo (Tenore) 36 So klage, du zustörte Gottesstadt Lament and wail thou ruined town of God 3. Aria (Basso) 39 Dein Wetter zog sich auf von weiten Thy storm of wrath was long in coming 4. Recitativo (Alto) 48 Doch bildet euch, o Sünder, ja nicht ein Imagine not, ye sinners 5. Aria (Alto) 48 Doch Jesus will auch bei der Strafe But Jesus’ grace remains eternal 6. Choral 54 O großer Gott von Treu O God of mercy sure Kritischer Bericht 57 Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor: Partitur (Carus 31.046), Studienpartitur (Carus 31.046/07), Klavierauszug (Carus 31.046/03), Chorpartitur (Carus 31.046/05), komplettes Orchestermaterial (Carus 31.046/19). The following performance material is available: full score (Carus 31.046), study score (Carus 31.046/07), vocal score (Carus 31.046/03), choral score (Carus 31.046/05), complete orchestral material (Carus 31.046/19). -
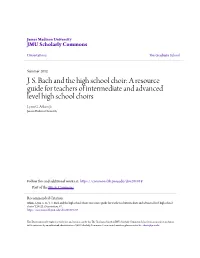
JS Bach and the High School Choir
James Madison University JMU Scholarly Commons Dissertations The Graduate School Summer 2012 J. S. Bach and the high school choir: A resource guide for teachers of intermediate and advanced level high school choirs Lynn G. Atkins Jr. James Madison University Follow this and additional works at: https://commons.lib.jmu.edu/diss201019 Part of the Music Commons Recommended Citation Atkins, Lynn G. Jr., "J. S. Bach and the high school choir: A resource guide for teachers of intermediate and advanced level high school choirs" (2012). Dissertations. 87. https://commons.lib.jmu.edu/diss201019/87 This Dissertation is brought to you for free and open access by the The Graduate School at JMU Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of JMU Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. J. S. Bach and the High School Choir: A Resource Guide for Teachers of Intermediate and Advanced Level High School Choirs Lynn Gary Atkins, Jr. A thesis submitted to the Graduate Faculty of JAMES MADISON UNIVERSITY In Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Musical Arts School of Music August 2012 Dedication To Grace C. and Joseph Atkins, who picked up the torch and helped to mold me into the musician I am today. To Rochelle Ellis, Faith Esham, Lillian Livingston, James Jordan, J. A. Kawarsky, Ken MacLean, Marj Mottola, Rodney Somerville, Carrie Stevens, Al Wright, and Kris Zook, who gave me the knowledge to access my wildest dreams. To Rita M. Bland and Lynn G. Atkins, Sr., thank you for your gift of life…I pray I make you proud.