SWR2 Musikstunde
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Comparative Analysis of the Six Duets for Violin and Viola by Michael Haydn and Wolfgang Amadeus Mozart
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SIX DUETS FOR VIOLIN AND VIOLA BY MICHAEL HAYDN AND WOLFGANG AMADEUS MOZART by Euna Na Submitted to the faculty of the Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree, Doctor of Music Indiana University May 2021 Accepted by the faculty of the Indiana University Jacobs School of Music, in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music Doctoral Committee ______________________________________ Frank Samarotto, Research Director ______________________________________ Mark Kaplan, Chair ______________________________________ Emilio Colón ______________________________________ Kevork Mardirossian April 30, 2021 ii I dedicate this dissertation to the memory of my mentor Professor Ik-Hwan Bae, a devoted musician and educator. iii Table of Contents Table of Contents ............................................................................................................................ iv List of Examples .............................................................................................................................. v List of Tables .................................................................................................................................. vii Introduction ...................................................................................................................................... 1 Chapter 1: The Unaccompanied Instrumental Duet... ................................................................... 3 A General Overview -

Franz Anton Hoffmeister’S Concerto for Violoncello and Orchestra in D Major a Scholarly Performance Edition
FRANZ ANTON HOFFMEISTER’S CONCERTO FOR VIOLONCELLO AND ORCHESTRA IN D MAJOR A SCHOLARLY PERFORMANCE EDITION by Sonja Kraus Submitted to the faculty of the Jacobs School of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree, Doctor of Music Indiana University December 2019 Accepted by the faculty of the Indiana University Jacobs School of Music, in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Music Doctoral Committee ______________________________________ Emilio Colón, Research Director and Chair ______________________________________ Kristina Muxfeldt ______________________________________ Peter Stumpf ______________________________________ Mimi Zweig September 3, 2019 ii Copyright © 2019 Sonja Kraus iii Acknowledgements Completing this work would not have been possible without the continuous and dedicated support of many people. First and foremost, I would like to extend my deepest gratitude to my teacher and mentor Prof. Emilio Colón for his relentless support and his knowledgeable advice throughout my doctoral degree and the creation of this edition of the Hoffmeister Cello Concerto. The way he lives his life as a compassionate human being and dedicated musician inspired me to search for a topic that I am truly passionate about and led me to a life filled with purpose. I thank my other committee members Prof. Mimi Zweig and Prof. Peter Stumpf for their time and commitment throughout my studies. I could not have wished for a more positive and encouraging committee. I also thank Dr. Kristina Muxfeldt for being my music history advisor with an open ear for my questions and helpful comments throughout my time at Indiana University. I would also like to thank Dr. -

Copyright by Denise Parr-Scanlin 2005
Copyright by Denise Parr-Scanlin 2005 The Treatise Committee for Denise Parr-Scanlin Certifies that this is the approved version of the following treatise: Beethoven as Pianist: A View Through the Early Chamber Music Committee: K.M. Knittel, Supervisor Anton Nel, Co-Supervisor Nancy Garrett Robert Mollenauer David Neumeyer David Renner Beethoven as Pianist: A View Through the Early Chamber Music by Denise Parr-Scanlin, B.M., M.F.A. Treatise Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Musical Arts The University of Texas at Austin December, 2005 Dedication To my mother and first piano teacher, Daisy Elizabeth Liles Parr Acknowledgements I wish to acknowledge the kind assistance of my treatise committee, Dr. Kay Knittel, Dr. Anton Nel, Professor Nancy Garrett, Dr. Robert Mollenauer, Dr. David Neumeyer, and Professor David Renner. I especially thank Dr. Kay Knittel for her expert guidance throughout the project. I also thank Janet Lanier for her assistance with the music examples and my husband, Paul Scanlin, for his constant support and encouragement v Beethoven as Pianist: A View Through the Early Chamber Music Publication No._____________ Denise Parr-Scanlin, D.M.A. The University of Texas at Austin, 2005 Supervisors: K.M. Knittel, Anton Nel Our inability to reconstruct what Ludwig van Beethoven must have sounded like as a pianist is one of the more vexing questions of music history. Unreliable sources and his short performing career, in addition to a lack of virtuoso public pieces, have contributed to this situation. -
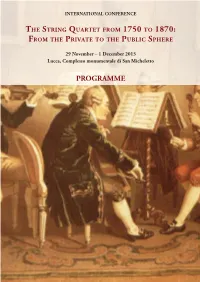
The String Quartet from 1750 to 1870: from the Private to the Public Sphere
INTERNATIONAL CONFERENCE THE STRING QUARTET FROM 1750 TO 1870: FROM THE PRIVATE TO THE PUBLIC SPHERE 29 November – 1 December 2013 Lucca, Complesso monumentale di San Micheletto PROGRAMME ORGANIZED BY CENTRO STUDI OPERA OMNIA LUIGI BOCCHERINI www.luigiboccherini.org THE STRING QUARTET FROM 1750 TO 1870: FROM THE PRIVATE TO THE PUBLIC SPHERE International Conference 29 November – 1 December 2013 Lucca, Complesso monumentale di San Micheletto Organized by Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Lucca Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, Venice In association with Italian National Edition of Luigi Boccherini’s Complete Works Ad Parnassum Journal ef SCIENTIFIC COMMITEE Roberto Illiano (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini) Étienne Jardin (Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française) Fulvia Morabito (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini) Luca Lévi Sala (Université de Poitiers) Massimiliano Sala (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini) Christian Speck (Universität Koblenz-Landau) ef KEYNOTE SPEAKERS Cliff Eisen (King’s College, London) Christian Speck (Universität Koblenz-Landau) FRIDAY 29 NOVEMBER 9.00-10.00: Welcome and Registration 10.00-10.30: Opening • MASSIMILIANO SALA (President Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini) • ÉTIENNE JARDIN (Scientific Coordinator Palazzetto Bru Zane) • CHRIstIAN SPECK (President Italian National Edition of Boccherini’s Complete Works) Room 1 – Beethoven and the String Quartet (Chair: Rohan H. Stewart-MacDonald, Cheltenham, UK) 10.30-12.30 • Nancy -

An Essay in Carnal Musicology
Boccherini’s Body Boccherini’s Body An Essay in Carnal Musicology Elisabeth Le Guin UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS Berkeley Los Angeles London University of California Press, one of the most distinguished university presses in the United States, enriches lives around the world by advancing scholarship in the humanities, social sciences, and natural sciences. Its activities are supported by the UC Press Foundation and by philanthropic contributions from individuals and institutions. For more information, visit www.ucpress.edu. University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. London, England © 2006 by Elisabeth Le Guin Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Le Guin, Elisabeth, 1957– Boccherini’s body : an essay in carnal musicology / Elisabeth Le Guin. p. cm. Includes bibliographical references and index. isbn 0-520-24017-0 (cloth : alk. paper) 1. Boccherini, Luigi, 1743–1805—Criticism and interpretation. 2. Music—Interpretation (Phrasing, dynamics, etc.) I. Title. ml410.b66l4 2006 780'.92—dc22 2005023224 Manufactured in the United States of America 13 12 11 10 09 08 07 06 10987654321 This book is printed on Natures Book, which contains 50% post-consumer waste and meets the minimum requirements of ansi/niso z39.48-1992 (r 1997) (Permanence of Paper).8 But what do my cold and exaggerated expressions mean, my lines without character and without life, these lines that I have just traced, one on top of the other? Nothing, nothing at all; one must see the thing. Mais que signifient mes expressions exagérées et froides, mes lignes sans caractères et sans vie, ces lignes que je viens de tracer les unes au-dessus des autres? Rien, mais rien du tout; il faut voir la chose. -
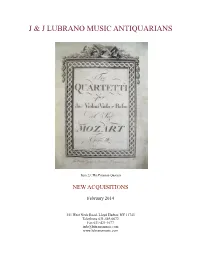
New Acquisitions
J & J LUBRANO MUSIC ANTIQUARIANS Item 23: The Prussian Quartets NEW ACQUISITIONS February 2014 351 West Neck Road, Lloyd Harbor, NY 11743 Telephone 631-549-0672 Fax 631-421-1677 [email protected] www.lubranomusic.com Autograph Manuscripts of “A... Composer Whose Music Embraces a Wide Variety of Contemporary Styles” 1. ADLER, Samuel born 1928. Drifting on Winds and Currents A Poem for Orchestra. Autograph musical manuscript sketches, ca. 2010. 4 pp. on two large oblong folio leaves (ca. 294 mm. x 286 mm.) notated in pencil on 18-stave music manuscript paper, each leaf signed by the composer and containing approximately 100 measures, primarily in short score. A working manuscript. The present was first performed by the Las Vegas Philharmonic with David Itkin conducting on November 20, 2010 in Las Vegas. Adler studied composition with Aaron Copland, Paul Fromm, Paul Hindemith, Hugo Norden, Walter Piston and Randall Thompson. "His works have been performed by major symphony orchestras, choral and chamber ensembles throughout the USA, Europe, South America and Israel... [He] is a prolific composer whose music embraces a wide variety of contemporary styles. His works exhibit great rhythmic vitality, with a predilection for asymmetrical rhythms and metres, and a keen sensitivity to counterpoint." Marie Rolf in Grove online A fine example of the composer's working methods. (22478) $1,200. 2. ADLER. Recalling the Yesterdays. Song cycle for mezzo soprano, flute, clarinet, violin, cello, piano and percussion, nos. 2: "The Saturday Matinee," 3: "Child of the Plains," 4: "The Medicine Keepers" and 5: "Season Song." Autograph musical manuscript full score, signed. -

Beethoven's Expanding Orchestral Horizons, 1795-1800 Theodore Albrecht Haydn's Concert in the Kleiner Redoutensaal, December
Beethoven’s Expanding Orchestral Horizons, 1795-1800 Theodore Albrecht Once Beethoven had tasted his initial success before the Viennese Tonkünstler-Societät’s public (as opposed to salon concerts of the nobility) on March 29-30, 1795, he began planning an Akademie of his own. For a typical potpourri program, he would need a new concerto, a symphony, plus works by other composers, and at least one or two vocal works. Even though he would need to get further use from his Piano Concerto in B-flat, he already had a Concerto in C Major in the works. He was also sketching a Symphony, likewise in C major. He worked on it, periodically, through 1795 and 1796, but it never progressed very far.1 Haydn’s Concert in the Kleiner Redoutensaal, December 18, 1795 Beethoven’s next public appearance playing his Concerto in B-flat was at a concert given by Joseph Haydn, primarily to introduce three of the six Symphonies (recently composed in London) to Viennese audiences on December 18, 1795. The concert took place in the Kleiner Redoutensaal, the smaller of the Imperial Ballrooms, often used for chamber music performances. The identity of the orchestra was not specified,2 but given the location---that is, not in the Burgtheater itself---and Griesinger’s mention that the Kärntnertor Theater’s orchestra under Wranitzky had performed Haydn symphonies,3 it is possible that this ensemble was in fact the orchestra employed. If so, Beethoven would probably again have had a positive experience in making music with Wranitzky. 1Beethoven did not use bound sketchbooks before the so-called “Grasnick 1 Sketchbook,” begun in the middle of 1798. -

Viennese Chamber Music with Clarinet and Piano, 1783-1827: Repertory and Performance Strategy
Viennese Chamber Music with Clarinet and Piano, 1783-1827: Repertory and Performance Strategy MARTIN DA VID HARLOW Submitted for the degree of Doctor of Philosophy Department of Music June 2004 Appendix 1 Thematic Catalogue: Viennese Chamber Music with Clarinet and Piano, 1783-1827 Contents Work entries v Abbreviations vi Duos a) Sonatas and Sonatines Beethoven, Ludwig van Sonata in F major, Op.17 (with basset horn) 1 Eberl, Anton Sonata in B flat major, Op.1 0 no.2 2 Hoffmeister, Franz Anton Duo No.l in D major 4 Hoffmeister, Franz Anton Duo No.2 in F major 5 Hoffmeister, Franz Anton Duo No.3 in G minor 6 Hoffmeister, Franz Anton Duo No.4 in C major 7 Hoffmeister, Franz Anton Duo No.5 in E flat major 8 Hoffmeister, Franz Anton Duo No.6 in A major 9 KrIDuner, Caroline Sonatine 10 Mozart, Wolfgang Amadeus Grande Sonate [after K.581] 11 Ries, Ferdinand Sonata in G minor/major, Op.29 12 Riotte, Jakob Philipp Grand Sonate in E flat major, Op.33 14 Rudolph, Archduke Sonata in A major, Op.2 15 Struck, Paul Grand Duo in B flat major, Op.7 17 Wanhal, Giovanni Sonata in B flat major, Weinmann XI a 26 19 Wanhal, Giovanni Sonata in B flat major, Weinmann X a 45 20 Wanhal, Giovanni Sonata in C major, Weinmann XI a 27 21 Wanhal, Giovanni Sonata in E flat major, Weinmann XI a 69 and X a45 22 Wanhal, Giovanni Sonatina in C major, Weinmann XI b 31 23 b) Others (fantasies; variation sets; divertissements etc.) Kreutzer, Conradin Romance Favorite, KWV 5115 24 Kreutzer, Conradin Fantasy and Variations, Op.66, KWV 5107 25 Kreutzer, Conradin Masurka varie, Op.76 no.5, KWV 5111 26 Krufft, Baron Nicolaus de Variations on the Air 'La Sentinelle' 27 Moritz, C.T. -

8067 Beethoven Trios
(LEMS 8067) Beethoven Sonatas & Trios The Queen’s Chamber Trio Robert Zubrycki, violin Peter Seidenberg, violoncello Elaine Comparone, harpsichord 2 CD SET CD ONE Sonata in G minor for Cello and Harpsichord, Op. 5, No. 2 (1796) Dedicated to King Friedrich Wilhelm II of Prussia Adagio sostenuto e espressivo Allegro molto più tosto presto Rondo: Allegro Sonata in D Major for Violin and Harpsichord, Op. 12, No. 1 (1797/98) Dedicated to Antonio Salieri Allegro con brio Tema con 4 Variazioni: Andante con moto Rondo: Allegro Ludwig van Beethoven (1772-1827) 1 CD TWO Trio in E-flat Major for Violin, Cello and Harpsichord, Op. 1, No. 1 (1795) Dedicated to Count Karl von Lichnowsky Allegro Adagio cantabile Scherzo: Allegro assai Finale: Presto Trio in C minor for Violin, Cello and Harpsichord, Op. 1, No. 3 Dedicated to Count Karl von Lichnowsky Allegro con brio Andante cantabile con 5 Variazioni e Coda Menuetto: Quasi allegro Finale: Prestissimo Program Notes....Elaine Comparone Beethoven’s First Dedication At age eleven, Beethoven dedicated three keyboard sonatas to Maximilian Friedrich, Prince Elector of Cologne. His dedication letter reads: Most illustrious! Music from my fourth year began to be the first of my youthful occupations. Thus early acquainted with the gracious muse who tuned my soul to pure harmonies, I became fond of her, and, as it often seemed to me, she of me. I have already reached my eleventh year; and since then often has my muse whispered to me in inspired hours: “Try for once and write down the harmonies of thy soul!” Eleven years old— methought [sic]—and how would an author’s air become me? And what would masters of the art probably say to it? I almost became diffident. -

Chamber Music
New Mozart Edition VIII/23/2 Sonatas and Variations for Keyboard & Violin WOLFGANG AMADEUS MOZART Series VIII CHAMBER MUSIC WORK GROUP 23: SONATAS AND VARIATIONS FOR KEYBOARD AND VIOLIN · VOLUME 2 PRESENTED BY EDUARD REESER 1965 International Mozart Foundation, Online Publications III New Mozart Edition VIII/23/2 Sonatas and Variations for Keyboard & Violin Neue Mozart-Ausgabe (New Mozart Edition)* WOLFGANG AMADEUS MOZART The Complete Works BÄRENREITER KASSEL BASEL LONDON En coopération avec le Conseil international de la Musique Editorial Board: Dietrich Berke Wolfgang Plath Wolfgang Rehm Agents for BRITISH COMMONWEALTH OF NATIONS: Bärenreiter Ltd. London BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Bärenreiter-Verlag Kassel SWITZERLAND and all other countries not named here: Bärenreiter-Verlag Basel As a supplement to each volume a Critical Report (Kritischer Bericht) in German is available The editing of the NMA is supported by City of Augsburg City of Salzburg Administration Land Salzburg City of Vienna Konferenz der Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, represented by Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, with funds from Bundesministerium für Forschung und Technologie, Bonn and Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Ministerium für Kultur der Deutschen Demokratischen Republik Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Vienna * Hereafter referred to as the NMA. The predecessor, the "Alte Mozart-Edition" (Old Mozart Edition) is referred to as the AMA. International Mozart Foundation, Online -

Mozart's String Quartet in D Minor, K
THE BIOGRAPHY OF A STRING QUARTET: Mozart’s String Quartet in D minor, K. 421 (417b) by Alexa Vivien Wilks A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts Faculty of Music University of Toronto © Copyright by Alexa Vivien Wilks 2015 The Biography of a String Quartet: Mozart’s String Quartet in D minor, K. 421 (417b) Alexa Vivien Wilks Doctor of Musical Arts Faculty of Music University of Toronto 2015 Abstract Wolfgang Amadeus Mozart’s String Quartet K. 421 in D minor remains one of his most celebrated quartets. K. 421 is the second work in a set of six quartets dedicated to Mozart’s colleague and mentor, Joseph Haydn, and is the only ‘Haydn’ Quartet in a minor key. An overview of the historical background of K. 421, the significance of D minor in Mozart’s compositions, as well as the compositional relationship between Mozart and Haydn situates this work amongst Mozart’s other string quartet compositions and provides context for the analysis of different editions. An outline of the historical practices and roles of editors, as well as a detailed analysis and comparison of different editions against the autograph manuscript and the first edition published by Artaria in 1785 examines the numerous discrepancies between each of the different publications of K. 421. Using the information acquired from the comparative study of selected historical editions, some possibilities for future editions of K. 421 are discussed. When undertaking the study of a new quartet, performers can learn a great deal from listening to recordings. -

Luigi Boccherini Dictionary of Persons, Places and Terms
LUIGI BOCCHERINI DICTIONARY OF PERSONS , PLACES AND TERMS by JAIME TORTELLA TO READERS: This book will be periodically updated with new research outcome and data, and amended of any error detected. If you want to collaborate towards this task, please contact the author or the Asociación Luigi Boccherini: [email protected] [email protected] ------- The Spanish version of this book has been published in traditional paperback as: Luigi Boccherini. Diccionario de Términos, Lugares y Personas, Asociación Luigi Boccherini, Madrid, 2008 and is distributed worldwide by Marcial Pons: [email protected] CONTENTS Pages FOREWORD by Begoña Lolo ............................................................................. 4 PREAMBLE ....................................................................................................... 7 ACRONYMS OF ARCHIVING INSTITUTIONS ............................................... 13 ABBREVIATIONS ............................................................................................. 14 BRIEF BIOGRAPHICAL ACCOUNT ABOUT LUIGI BOCCHERINI .............. 16 DICTIONARY (A TO Z) ................................................................................... 19 BIBLIOGRAPHY ............................................................................................. 448 DISCOGRAPHY (COMPACT DISC) ................................................................ 460 FOREWORD Luigi Boccherini. Dictionary of Persons, Places and Terms is a work encompassing the difficult equilibrium and even proportion