LASSNIG – RAINER Das Frühwerk
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
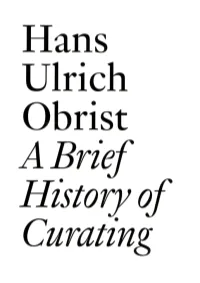
Hans Ulrich Obrist a Brief History of Curating
Hans Ulrich Obrist A Brief History of Curating JRP | RINGIER & LES PRESSES DU REEL 2 To the memory of Anne d’Harnoncourt, Walter Hopps, Pontus Hultén, Jean Leering, Franz Meyer, and Harald Szeemann 3 Christophe Cherix When Hans Ulrich Obrist asked the former director of the Philadelphia Museum of Art, Anne d’Harnoncourt, what advice she would give to a young curator entering the world of today’s more popular but less experimental museums, in her response she recalled with admiration Gilbert & George’s famous ode to art: “I think my advice would probably not change very much; it is to look and look and look, and then to look again, because nothing replaces looking … I am not being in Duchamp’s words ‘only retinal,’ I don’t mean that. I mean to be with art—I always thought that was a wonderful phrase of Gilbert & George’s, ‘to be with art is all we ask.’” How can one be fully with art? In other words, can art be experienced directly in a society that has produced so much discourse and built so many structures to guide the spectator? Gilbert & George’s answer is to consider art as a deity: “Oh Art where did you come from, who mothered such a strange being. For what kind of people are you: are you for the feeble-of-mind, are you for the poor-at-heart, art for those with no soul. Are you a branch of nature’s fantastic network or are you an invention of some ambitious man? Do you come from a long line of arts? For every artist is born in the usual way and we have never seen a young artist. -

Presskit Maria Lassnig.Pdf
Contents Exhibition facts Press release Wall texts Quotes Biography Exhibition facts Opening 4 May 2017 | 6.30 pm Duration 5 May – 27 August 2017 Venue Tietze Galleries for Prints and Drawings Curator Dr Antonia Hoerschelmann, Albertina Exhibits 80 Catalogue The catalogue is available for EUR 29,90 (German/English) in the Albertina’s museum shop and at www.albertina.at Contact Albertinaplatz 1 | A-1010 Vienna T +43 (0)1 534 83–0 [email protected] | www.albertina.at Opening hours Daily 10 am – 6 pm, Wednesdays 10 am – 9 pm Press contact Mag. Verena Dahlitz T +43 (01) 534 83 - 510 | M +43 (0) 699 10981746 [email protected] Mag. Ivana Novoselac-Binder T +43 (01) 534 83 - 514 | M +43 (0)699 12178741 [email protected] Mag. Fiona Sara Schmidt T +43 (01) 534 83 - 511 | M +43 (0)699 12178720 [email protected] Mag. Barbara Walcher T +43 (01) 534 83 – 512 | M +43 (0)699 10981743 [email protected] Partner Sponsor Medianpartner Maria Lassnig – Dialogues 5 May – 27 August 2017 Maria Lassnig (1919–2014) numbers among the most outstanding and important artists of the recent past. In the oeuvre that she built, Lassnig strove consistently to put her very own perception of her body and emotions to paper. The pictures she created revolve around deep- reaching sentiments and sensations. Three years after Maria Lassnig’s death, the Albertina is paying homage to Lassnig’s drawn work with a retrospective showing that will bring together around 80 of the artist’s most evocative drawings and watercolors. -

MARIA LASSNIG Curated by Andrea Teschke November 19 – December 23, 2005 Opening Reception: Saturday, November 19, 6-8 Pm
FOR IMMEDIATE RELEASE MARIA LASSNIG curated by Andrea Teschke November 19 – December 23, 2005 Opening reception: Saturday, November 19, 6-8 pm Friedrich Petzel Gallery is pleased to announce a solo exhibition of paintings and drawings by Vienna-based artist Maria Lassnig curated by Andrea Teschke. This is the artist’s second gallery show in New York since 1989. Maria Lassnig is considered one of the most preeminent international artists today. Her work has been exhibited in galleries, museums and institutions since the early 1950s. She has become well known for her body-awareness paintings, drawings for which she first started creating in 1948: At first I called my body awareness “paintings”, then “introspective” experiences; later on I did not call them anything at all after I had been ridiculed for claiming that my blobs and piles of color were “self portraits.” I recommend my body awareness paintings as an ideal application of art because the subject matter can never be exhausted. I have only abandoned this “content” when outside events were stronger than I was, when I encountered love, death and oppression and had to submit to or revolt against something.1 MARIA LASSNIG For this exhibition, the artist selected a group of 11 paintings and 11 Untitled (crutches, broken leg) drawings, all of which feature the artist as her own model in different 2005 Oil on canvas emotional and physical states. These pictures are not traditional self-portraits; instead they express the artist’s inner awareness. Four paintings show the artist in different positions on crutches. Despite displaying a disability they are funny and grotesque because, according to Lassnig, “imperfections may be overcome through humor.” The figures are painted on a white background with strong contours as in “Death and the Girl” which shows the artist dancing with a skeleton. -

New Directions in Figurative Painting at Whitechapel Gallery Radical Figures
New directions in figurative painting at Whitechapel Gallery Radical Figures: Painting in the New Millennium 6 February – 10 May 2020 Galleries 1, 8 & 9 Radical Figures: Painting in the New Millennium brings together a new generation of artists who represent the body in radical ways to tell stories and explore vital social concerns. Presenting for the first time this new direction in painting, the exhibition features ten painters at the heart of this zeitgeist: Michael Armitage, Cecily Brown, Nicole Eisenman, Sanya Kantarovsky, Tala Madani, Ryan Mosley, Christina Quarles, Daniel Richter, Dana Schutz and Tschbalala Self. Painting had its last big hurrah in the 1980s when the stock market boom fuelled the brash brushwork and swagger of Neo-Expressionism. Leading critics were quick to pronounce its death. Through 40 canvases created over the last two decades, Whitechapel Gallery’s spring 2020 exhibition surveys the renewed interest in expressive and experimental modes of figuration among painters who have come to prominence since 2000. The artists explore contemporary subjects including gender and sexuality, society and politics, race and body image. Pushing the notion of what figurative painting can be, the bodies they depict may be fragmented, morphed, merged and remade but never completely cohesive. They may also be fluid and non-gendered; drawn from news stories; represented by animals; or simply formed from the paint itself. Embodying the painterly gesture to critique from within or broaden the lineage of a style long associated with canonical Eurocentric male painters, each artist references and creates work in dialogue with 19th and 20th- century painters including Victor Eugene Delacroix (1798–1863), Paul Gauguin (1848–1903), Willem de Kooning (1904–1997) and Maria Lassnig (1919–2014). -

MARIA LASSNIG Curated by Andrea Teschke October 24 - November 30, 2002
FOR IMMEDIATE RELEASE MARIA LASSNIG curated by Andrea Teschke October 24 - November 30, 2002 Friedrich Petzel Gallery is pleased to announce a solo exhibition of recent paintings and drawings by Vienna-based artist Maria Lassnig. The opening is scheduled for Thursday, October 24 from 6 pm until 8 pm and the exhibition will continue through November 30. Maria Lassnig was born in Carinthia, Austria. She studied at the Akademie der Bildenden Kuenste in Vienna. After several stays in Paris in the 1950s and a 12-year residence in New York, she returned to Vienna in 1980 and represented Austria that same year at the Biennale di Venezia. Even though she never considered herself part of a feminist circle, one entire generation of women artists is indebted to her, allowing for radically subjective if diverse vocabularies through Competition III, oil on canvas, 2000 the representation of the body. For more than half a century, Maria Lassnig has pursued a meditative observation of herself through painting. She considers the body as a source of knowledge with painting serving as an instrument of self-realization. For the exhibition at Friedrich Petzel Gallery, Lassnig selected a group of 11 paintings, most of them featuring the artist as a soccer player. Even though she is always her own model, these pictures are not self-portraits in the traditional sense. The "players" are painted rude and funny, sometimes grotesque but also treated with great tenderness. Titles such as "Competition 1", "In the Net", and "Defense" reveal her disdain for sentimentality and psychological cliches. Instead, she borrows from the language of sports to challenge her expressive abilities and de-notate internal visions of herself. -

Laughing at Our Inadequacies: Contemporary Cartoonish Painting, Internet Culture and the Tragicomic Character
Laughing at Our Inadequacies: Contemporary Cartoonish Painting, Internet Culture and the Tragicomic Character Amber Boardman A thesis in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy School of Art and Design Faculty of Art and Design October 2018 Thesis/Dissertation Sheet Surname Boardman Given Name Amber Degree PhD Faculty Art and Design School Art and Design Thesis Title Laughing at Our Inadequacies: Contemporary Cartoonish Painting, Internet Culture and the Tragicomic Character Abstract This practice-based project examines ‘cartoonish painting’, an emerging trend of contemporary figurative painting which draws on links between cartoons, humour, narrative, character and bodily transformation. In my practice, cartoonish painting depicts and comments on the endless desire to transform body and self as promoted by Internet culture and social media. This thesis argues that the social media driven desire for self-improvement—bodily alteration and transformations of the self—creates a tragicomic effect that unfolds through the devices of narrative and character. I examine the still influential, Romantic theory of character developed by William James. James articulated well-rounded characters evolve over time through a series of identifications with external others. This thesis proposes that James’s formulations about character retain currency, as people identify with depictions of idealised bodies, high-performing and socially sanctioned selves disseminated through the Internet. This thesis argues, however, that this aspirational selfhood and identifying with idealised others creates feelings of inadequacy. The ideology of a striving, perfected self in search of the ‘American Dream’ will be analysed through Henri Bergson’s theory of the comic. Bergson argued that the failure of machine-like pursuits uncontrolled by consciousness can be manifested through comic depictions of the human body. -

Maria Lassnig Counts As One of the Most Important Artists of the Present
Maria Lassnig counts as one of the most important artists of the present and has set new standards for generations of artists in both her subject-matter and her radical presentation of it, in drawing and painting as well as film and video. The artist achieved international recognition through her participation in the 1980 Venice Biennale, the documenta 1982 and the documenta 1997. Large- scale solo exhibitions of her work were mounted most recently at the Serpentine Gallery in London in 2008, the MUMOK Vienna in 2009, the Lenbachhaus, Munich in 2010 and the Museum Ludwig in Cologne in 2011. Maria Lassnig was born in Kappel in Krappfeld (Austria) in 1919 and today lives and works in Vienna and Carinthia. Since the 1940s Maria Lassnig has dealt, through painting and drawing, almost exclusively with the visualization of internal sensations of the body, a theme she terms “Body Awareness-Drawings and - Paintings”. Through this approach she has created a lifetime’s body of work which takes as its starting point a recognition of the human body’s potential as a medium for generating images. In 1980, after residing for many years in Paris and New York, the artist returned to Vienna, where she was appointed to a post at the Academy of Art, becoming the first female Professor of painting in a german-speaking country. Capitain Petzel shows ten paintings, most of which were created in the last three years. All canvases come directly from Maria Lassnig’s atelier and are presented in public for the first time. In these new large-format works Maria Lassnig investigates themes including gender-roles, with figurative elements presented against monochromatic backgrounds in a colour-palette characteristic of the artist‘s work. -

Universalmuseum Joanneum Press Office Maria Lassnig Biography
Universalmuseum Joanneum Press office Universalmuseum Joanneum [email protected] Mariahilferstraße 4, 8020 Graz, Austria Telephone +43-316/8017-9211 www.museum-joanneum.at Maria Lassnig Biography 8th September 1919 Born in Garzern in Kappel am Krappfeld, Carinthia (AT), daughter of Mathilde Gregorz. Lassnig’s father does not meet Maria until she is an adult. Maria was raised by her grandmother on account of her mother’s occupation. 1925 Mother marries baker Jacob Lassnig and the family relocates to Klagenfurt. Until 1939 Attends the Ursuline Convent School in Klagenfurt, secondary school until graduation. Drawing lessons from ages 6–10. Member of the Wandervögel, a back-tonature youth group. 1939–41 Training as a primary school teacher, teaches at elementary schools in Metnitz valley. Lassnig draws portraits of the children. 1941–43 Studies at the Academy of Fine Arts in Vienna (diploma) Prof. Wilhelm Dachauer gives a negative evaluation of Lassnig’s paintings, referring to them as ‘degenerate’. Lassnig switches to Prof. Ferdinand Andri’s class, studies life drawing under Prof. Herbert Boeckl. Develops her notion of subjective colour 1943 Visits Franz Wiegele (Nötsch Circle) 1945 Returns to Klagenfurt Lassnig studio becomes a meeting place for artists and writers (including, among others, Arnold Clementschitsch, Michael Guttenbrunner, Max Holzer, Wolf in der Maur, and Arnold Wande.) Influenced by Carinthian Colourism (Herbert Boeckl, Arnold Clementschitsch, Anton Kolig, Franz Wiegele) Portraits, nudes, interiors, still lifes, animal pictures Page 2 Starting 1948 Investigates Post-Cubism, Orphism, Surrealism, Automatism 1948 First ‘body awareness drawings’: introspective experiences First solo exhibition at Galerie Kleinmayr, Klagenfurt Becomes acquainted with Arnulf Rainer 1951 Relocates to Vienna Member of the Hundsgruppe (Arik Brauer, Ernst Fuchs, Wolfgang Hollegha, Anton Lehmden, Josef Mikl, Markus Prachensky, Arnulf Rainer). -
Wirwegbereiter-Wandtexte-E.Pdf
We Trailblazers: Pioneers of Postwar Modernism Collection and archive stand in the focus of this exhibition on two levels of the mumok. They are illustrated by means of the museum’s first collection—which its founding director Werner Hofmann began to gather together in 1959— and by means of its first archive: a media archive of visual art from the postwar period, which Viktor Matejka donated to the museum in 1979. Matejka (1901–1993) was a writer, public educator, and politician responsible for cultural affairs as well as a constant and often unconventional supporter of the arts. As a member of Vienna’s city council, he was made responsible for culture and public education in 1945. Often referred to as the »conscience of the nation,« he compiled multiple archives of magazine and newspaper clippings, beginning in the 1920s. Werner Hofmann (1928–2013) was an art historian, exhibition organizer, and museum director. As adherent of the Vienna School of Art History, it was important to him to link education and museum, theory and practice. In the ten years he worked here (1959–69), he built up Austria’s first internationally oriented museum of modern art, something that had been demanded from cultural policy makers since Otto Wagner. In different ways and at different times, Hofmann and Matejka were confronted with the question of a cultural new beginning. As a declared antifascist, Matejka made efforts to bring emigrants like Oskar Kokoschka and Arnold Schoenberg back to Vienna. With his purchases and exhibitions, Hofmann primarily brought to Vienna prewar international modern art, which he saw as the pivotal turning point for the developments of the entire century. -

Press Preview Kit
PRESS PREVIEW KIT MASCULINE ←→ FEMININE Featuring: Cassils, Freewaves, Micol Hebron, Julie Heffernan, Robert Heinecken, Maria Lassnig, Lynn Hershman Leeson, Danial Nord, Hiromi Ozaki, Alexis Smith, Laetitia Sonami, & Victoria Vesna Curated by David Familian with support From Micol Hebron On View: January 28 – May 13, 2017 Opening Reception: January 28, 2017, 2-5pm Holiday Closure: March 27 – April 3, 2017 IRVINE, Calif. (January 4, 2017) – This Spring, the Donald R. and Joan F. Beall Center for Art + Technology at UC Irvine’s Claire Trevor School of the Arts will present Masculine ←→ Feminine, an intermedia exhibition featuring twelve international contemporary artists. Curated by David Familian (Artistic Director, Beall Center) with support from Micol Hebron (interdisciplinary artist, curator, and associate professor at Chapman University), Masculine ←→ Feminine will open to the public on Saturday, January 28, with an artist reception from 2-5pm. The exhibition will remain on view through Saturday, May 13, 2017. Masculine ←→Feminine focuses on the gendered body, and how artists project gender and sexual identity. Whether it’s historical works like Robert Heineken’s He/She series (1979)─in which the artist represents how gender difference affects communication ─ or contemporary pieces like Julie Heffernan’s Self-Portrait series (2011)─allegorical oil paintings that often depict the artist in androgynous or non-human states ─ the artworks featured in this exhibition attempt to free us from the masculine/feminine binary. Some works react to a state of being where there is no distinction between masculine and feminine signifiers, as is the case in Victoria Vesna’s new version of Bodies Incorporated (1995-2017), a pioneering net.art work that allows viewers to design their own avatars using both human and animal features. -

Download Press Release
Maria Lassnig Ways of Being 6 September – 1 December 2019 This comprehensive presentation of Maria Lassnig’s work marks what would have been the 100th birthday of the artist, who died in 2014. Lassnig is considered one of the most important women artists of the twentieth and twenty-first centuries. She is primarily known for her body-awareness paintings, in which the perception of her own body becomes the starting point for her exploration of the world. This is where the exhibition sets in: at the very moment in which Maria Lassnig was no longer in search of her language of expression in an artistic dialogue with the movements of modernism and contemporary art, but had developed an innovative pictorial language of her own which she knew how to unfold autonomously for the themes with which she was concerned. Lassnig’s idiosyncratic use of color is an equally essential aspect of her intriguing art, as is the virtually inexhaustible diversity of the subject matter and content of her imagery. Her painting carries inner bodily sensations and emotions to the outside, analyzing the relationship between body and environment. The artist began discovering this path for herself as early as 1948, which makes her one of the first pioneers of the body art of the 1970s. Starting out from the conviction that our perception of reality is purely subjective, Lassnig resorted to her own bodily sensations to deal with such primal themes as love and death, art and technology, violence, and the endangerment of nature while playing with the contradictions between her own self-image and how others saw her—as a woman, artist, and human being. -

Grand Opening of the National Gallery in Prague: the Trade Fair Palace Is Dominated by Women 15
PRESS RELEASE Grand Opening of the National Gallery in Prague: The Trade Fair Palace is dominated by women 15. 2. 2018 – The National Gallery in Prague begins the 2018 exhibition season at the Trade Fair Palace by five new exhibitions. The main protagonists this year are two important female artists from Germany and Austria. Ai Weiwei’s art in the Big Hall is replaced by Katharina Grosse’s site-specific installation Wunderbild, while the first floor hosts Maria Lassnig’s extensive retrospective, prepared in collaboration with Tate Liverpool. “In the first half of the current year, the Trade Fair Palace features two major figures of international art. In the autumn, in celebration of Czechoslovakia’s centenary anniversary, we will focus on a newly conceived presentation of the National Gallery’s collections from 1918 to the present. This year’s Grand Opening will be held as early as today, and in addition to five exhibitions, including those by Katharina Grosse and Maria Lassnig, visitors can also enjoy a concert by Katarína Máliková, the rising star of the Slovak alternative scene,” says Jiří Fajt, General Director of the National Gallery in Prague. Katharina Grosse: Wunderbild The Big Hall of the Trade Fair Palace is converted into a completely new space by the German artist Katharina Grosse (born 1961). After Ai Weiwei’s installation Law of the Journey, this is already the second project when an internationally renowned contemporary artist has made a new work directly for Prague, specifically for the space that hosted Mucha’s Slav Epic for several years. „For the National Gallery in Prague, Katharina Grosse has created a large-scale, site-specific painterly installation Wunderbild, which radically redefines painting and responds to the space of the Trade Palace’s Big Hall.