S2K Leitlinie Notfallpsychiatrie 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
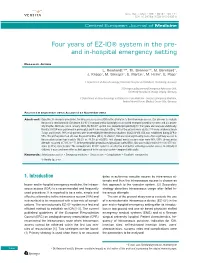
Four Years of EZ-IO® System in the Pre- and In-Hospital Emergency Setting
Cent. Eur. J. Med. • 8(2) • 2013 • 166-171 DOI: 10.2478/s11536-012-0125-6 Central European Journal of Medicine Four years of EZ-IO® system in the pre- and in-hospital emergency setting Research Article L. Reinhardt1*#, Th. Brenner1#, M. Bernhard2, J. Knapp1, M. Sikinger1, E. Martin1, M. Helm3, E. Popp1 1 Department of Anaesthesiology, University Hospital of Heidelberg, Heidelberg, Germany 2 Emergency Department/Emergency Admission Unit, University Hospital of Leipzig, Leipzig, Germany 3 Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine - Section Emergency Medicine, Federal Armed Forces Medical Centre Ulm, Germany Received 8 September 2012; Accepted 22 November 2012 Abstract: Objective: In emergency medicine, the intraosseous access (IOA) is the alternative to the intravenous access. Our aim was to evaluate the use of a semiautomatic IOA device (EZ-IO®) in ground and air based physician staffed emergency medical systems and at a univer- sity hospital. Methods: Since January 2008, the EZ-IO® system was evaluated prospectively for four years and analysed statistically. Results: 83 IOA were performed in prehospital and 5 in in-hospital setting. 78% of the patients were adults; 22% were children between 7 days and 6 years. 98% of all patients were in potentially life-threatening situations (NACA IV-VII). IOA was established during CPR in 55%. The primary insertion site was the proximal tibia (98%). In children, IOA was used significantly more often as primary access to the vascular system than in adults (86.2% vs. 38.9%, p <0.001). First attempt/ overall success rates were 94% / 99%. Unsuccessful attempts occurred in 7.8% (n=7). -

(HEMS) Rescue Missions with Helicopter Hoist Operations: Analys
Pietsch et al. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (2021) 29:92 https://doi.org/10.1186/s13049-021-00898-y ORIGINAL RESEARCH Open Access Incidence and challenges of helicopter emergency medical service (HEMS) rescue missions with helicopter hoist operations: analysis of 11,228 daytime and nighttime missions in Switzerland Urs Pietsch1,2,3,4*, Jürgen Knapp2,5, Michael Mann2, Lorenz Meuli6, Volker Lischke2, Mario Tissi4, Stephen Sollid7,8, Simon Rauch9,10, Volker Wenzel11, Stefan Becker4 and Roland Albrecht1,4 Abstract Objective: We aimed to investigate the medical characteristics of helicopter hoist operations (HHO) in HEMS missions. Methods: We designed a retrospective study evaluating all HHO and other human external cargo (HEC) missions performed by Swiss Air-Rescue (Rega) between January 1, 2010, and December 31, 2019. Results: During the study period, 9,963 (88.7 %) HEMS missions with HHO and HEC were conducted during the day, and 1,265 (11.3 %) at night. Of the victims with time-critical injuries (NACA ≥ 4), 21.1 % (n = 400) reached the hospital within 60 min during the day, and 9.1 % (n = 18) at night. Nighttime missions, a trauma diagnosis, intubation on-site, and NACA Score ≥ 4 were independently and highly significantly associated with longer mission times (p < 0.001). The greatest proportion of patients who needed hoist or HEC operations in the course of the HEMS mission during the daytime sustained moderate injuries (NACA 3, n = 3,731, 37.5 %) while practicing recreational activities (n =5,492, 55.1 %). In daytime HHO missions, the most common medical interventions performed were insertion of a peripheral intravenous access (n = 3,857, 38.7 %) and administration of analgesia (n = 3,121, 31.3 %). -

Use of Peripheral Vascular Access in the Prehospital Setting: Is There Room for Improvement?
Use of peripheral vascular access in the prehospital setting: is there room for improvement? Erin Gonvers Universite de Lausanne Faculte de biologie et medecine Thierry Spichiger ambulances riviera, vevey Eric Albrecht Centre hospitalier universitaire vaudois Departement des services de chirurgie et d'anesthesiologie Fabrice Dami ( [email protected] ) Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Institut Universitaire de Pathologie de Lausanne https://orcid.org/0000-0002-6994-4478 Research article Keywords: peripheral vascular access, prehospital, out-of-hospital, paramedic Posted Date: November 26th, 2019 DOI: https://doi.org/10.21203/rs.2.17748/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License Version of Record: A version of this preprint was published at BMC Emergency Medicine on June 9th, 2020. See the published version at https://doi.org/10.1186/s12873-020-00340-z. Page 1/7 Abstract Background: Previous studies have shown that prehospital-insertion of peripheral vascular access is highly variable. The aim of this study is to establish the rate of peripheral vascular access placement and its use with regard to both the severity of cases and the main problem suspected by the paramedics involved. Over-triage was considered to have taken place where peripheral vascular access was placed but unused and these cases were specically analysed in order to evaluate the possibility of improving current practice. Methods: This is a one-year retrospective study conducted throughout one state of Switzerland. Data were extracted from the state’s public health service database, collected electronically by paramedics on RescueNet® from Siemens. -

Challenges of Helicopter Mountain Rescue Missions by Human External
Pietsch et al. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (2019) 27:17 https://doi.org/10.1186/s13049-019-0598-2 ORIGINAL RESEARCH Open Access Challenges of helicopter mountain rescue missions by human external cargo: need for physicians onsite and comprehensive training Urs Pietsch1,2,3*, Giacomo Strapazzon4,5, Dimitri Ambühl6,7, Volker Lischke2,3, Simon Rauch4,8 and Jürgen Knapp2,7 Abstract Background: Human external cargo (HEC) extrication during helicopter rescue missions is commonly used in mountain emergency medical services. Furthermore, longline or winch operations offer the opportunity to deliver professional medical care onsite. As the safety and quality of emergency medical care depends on training and experience, we aimed to investigate characteristics of mountain rescue missions with HEC. Methods: We retrospectively reviewed all rescue missions conducted by Air Zermatt (a commercial rescue service in the high-alpine region of Switzerland) from January 2010 to September 2016. Results: Out of 11,078 rescue missions 1137 (10%) required a HEC rescue. In 3% (n = 29) rapid sequence induction and endotracheal intubation, in 2% (n = 14) cardiopulmonary resuscitation, and in 0.4% (n = 3) a chest tube insertion had to be performed onsite prior to HEC extraction. The most common medical intervention onsite is analgesia or analgosedation, in 17% (n = 142) fentanyl or ketamine was used in doses of ≥ 0.2 mg or ≥ 50 mg, respectively. Conclusions: As these interventions have to be performed in challenging terrain, with reduced personnel resources, and limited monitoring, our results point out the need for physicians onsite who are clinically experienced in these procedures and specially and intensively trained for the specific characteristics and challenges of HEC rescue missions. -

International Alpine Trauma Registry
International Alpine Trauma Registry The following Case Report Form and inclusion / exclusion criteria where defined by the expert panel for the Alpine Trauma Register. 1. INCLUSION & EXLUSION CRITERIA INCLUSION CRITERIA • A pre – hospital NACA-Score ≥ IV • A New Injury Severity Score (ISS) > 15 • The accident must occur in extra urban, mountain, alpine or remote areas, not readily accessible by regular Emergency Medical Service. EXCLUSION CRITERIA • Patient should be excluded if they are already in cardiac arrest upon arrival of rescue team at the scene • Patient who suffer drowning are not included • Burn patients should be excluded if the burn represents the predominant injury or if the patient is treated in a specialized burn unit OPTIONAL EXCLUSION CRITERIA • Under specified circumstances accidents how occur on ski slopes can be excluded from the data collection. If a reporting hospital is going to choose this option, it will last for the whole of the study. Also the project coordinator of the Alpine Trauma Register must be informed 2. CASE REPORT FORM Automatically recorded information A Patient ID Automaticly generatet ID B Hospital Hospital ID / Hospital transfer history C Logged in as: LDM-User-Name CRF HEADER D Last modified by: LDM-User-Name E Last modification on: Date / Time Patient´s record & case history Patient´s date of • 1 Date of birth birth • Male • 2 Gender Female • Unkown • ASA 1 • ASA 2 • ASA 3 Patient data Patient • 3 ASA classification ASA 4 • ASA 5 • ASA 6 • Unknown • Date Date & time of • 5 Time accident • Unknown • Date Date & time of • 6 first emergency Time • Unkown call • Freeride / Backcountry • Skiing/Snowboarding • Skitouring • Sledging • Snowshoeing • Riding a snowmobile • Hiking • Climbing 7 Type of activity • Mountainbiking Accident characteristics Accident • Canyoning • Rafting / Wildwater kayaking • Paragliding • Hang-gliding • Working in wilderness /mountain area • Other (should be sprecified) • Unknown • Fall (inc. -

Prehospital Care of Severely Injured Trauma Patients: Studies on Management, Assessment, and Outcome
From the DEPARTMENT OF CLINICAL SCIENCE AND EDUCATION, SÖDERSJUKHUSET Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden PREHOSPITAL CARE OF SEVERELY INJURED TRAUMA PATIENTS: STUDIES ON MANAGEMENT, ASSESSMENT, AND OUTCOME Rebecka Rubenson Wahlin Stockholm 2016 All previously published papers were reproduced with the permission of the publisher. Cover photo © Johan Larsson Published by Karolinska Institutet. Printed by Eprint AB 2016 © Rebecka Rubenson Wahlin, 2016 ISBN 978-91-7676-481-7 Prehospital Care of Severely Injured Trauma Patients: Studies on Management, Assessment and Outcome THESIS FOR DOCTORAL DEGREE (Ph.D.) By Rebecka Rubenson Wahlin Principal Supervisor: Opponent: Professor Sari Ponzer Associate Professor Lovisa Strömmer Karolinska Institutet Karolinska Institutet Department of Clinical Science and Education, Department of Clinical Science, Intervention, Södersjukhuset and Technology Co-supervisor(s): Examination Board: Professor Maaret Castrén Associate Professor Marie Hasselberg University of Helsinki, Finland Karolinska Institutet Department of Emergency Medicine and Services Department of Public Health Sciences and Karolinska Institutet Department of Clinical Science and Education, Associate Professor Lennart Boström Södersjukhuset Karolinska Institutet Department of Clinical Science and Education Professor Hans Morten Lossius Södersjukhuset University of Stavanger, Norway Field of Prehospital Critical Care, Network for Professor Björn-Ove Suserud Medical Sciences University of Borås and Karolinska Institutet Faculty of Caring -

Trends of Pre-Hospital Emergency Medical Services Activity Over 10 Years: a Population-Based Registry Analysis
Pittet et al. BMC Health Services Research 2014, 14:380 http://www.biomedcentral.com/1472-6963/14/380 RESEARCH ARTICLE Open Access Trends of pre-hospital emergency medical services activity over 10 years: a population-based registry analysis Valérie Pittet1*, Bernard Burnand1, Bertrand Yersin2 and Pierre-Nicolas Carron2 Abstract Background: The number of requests to pre-hospital emergency medical services (PEMS) has increased in Europe over the last 20 years, but epidemiology of PEMS interventions has little be investigated. The aim of this analysis was to describe time trends of PEMS activity in a region of western Switzerland. Methods: Use of data routinely and prospectively collected for PEMS intervention in the Canton of Vaud, Switzerland, from 2001 to 2010. This Swiss Canton comprises approximately 10% of the whole Swiss population. Results: We observed a 40% increase in the number of requests to PEMS between 2001 and 2010. The overall rate of requests was 35/1000 inhabitants for ambulance services and 10/1000 for medical interventions (SMUR), with the highest rate among people aged ≥ 80. Most frequent reasons for the intervention were related to medical problems, predominantly unconsciousness, chest pain respiratory distress, or cardiac arrest, whereas severe trauma interventions decreased over time. Overall, 89% were alive after 48 h. The survival rate after 48 h increased regularly for cardiac arrest or myocardial infarction. Conclusion: Routine prospective data collection of prehospital emergency interventions and monitoring of activity was feasible over time. The results we found add to the understanding of determinants of PEMS use and need to be considered to plan use of emergency health services in the near future. -

Changes in Coagulation in Standard Laboratory Tests and ROTEM in Trauma Patients Between On-Scene and Arrival in the Emergency Department
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2015 Changes in coagulation in standard laboratory tests and ROTEM in trauma patients between on-scene and arrival in the emergency department Theusinger, Oliver M ; Baulig, Werner ; Seifert, Burkhardt ; Müller, Stefan M ; Mariotti, Sergio ; Spahn, Donat R Abstract: BACKGROUND: When trauma patients arrive in the emergency department (ED), coagu- lopathy frequently is present. The time course, however, in which this coagulopathy develops is poorly understood. No study has fully evaluated the coagulation status, including thromboelastometry on- scene and at hospital arrival. We hypothesized that measured coagulation variables might change when measured at the scene of injury and upon arrival to the ED. METHODS: We performed a prospective, single-center, observational study investigating coagulation status in 50 trauma patients on-scene and at arrival in the ED. Measurements included arterial blood gases, ROTEM®, protein S100, protein C activity, protein S, Quick value, international normalized ratio, activated partial thromboplastin time, D-dimer, coagulation factor V (FV), coagulation factor XIII (FXIII), fibrinogen, hemoglobin, hematocrit, platelets, and volume and blood products being administered during the first 24 hours. RESULTS: Signif- icant changes between on-scene and the ED were observed for the following values: partial venous oxygen pressure increased and sodium, glucose, and lactate decreased. For EXTEM, INTEM, and APTEM, clotting time and clot formation time increased significantly, whereas maximal clot firmness and angle decreased significantly (all P 0.004). For FIBTEM, clotting time increased significantly andmaximal clot firmness decreased significantly. In the laboratory, significant reductions in hemoglobin, hematocrit, platelets, activated partial thromboplastin time, fibrinogen, FV, FXIII, protein C activity, protein S, and protein S100 were observed (all P 0.001). -

The Impact of the Patient's Initial NACA Score on Subjective and Physiological Indicators of Workload During Pre-Hospital Emergency Care
RESEARCH ARTICLE The impact of the patient's initial NACA score on subjective and physiological indicators of workload during pre-hospital emergency care Frederick Schneider*, Jan Martin, Gerhard Schneider, Christian M. Schulz Department of Anesthesiology, Klinikum rechts der Isar, School of Medicine, Technical University of Munich, MuÈnchen, Germany * [email protected] a1111111111 Abstract a1111111111 a1111111111 a1111111111 a1111111111 Background Excessive workload may impair patient safety. However, little is known about emergency care providers' workload during the treatment of life-threatening cases including cardiopul- monary resuscitation (CPR). Therefore, we tested the hypothesis that subjective and physi- OPEN ACCESS ological indicators of workload are associated with the patient's initial NACA score and that workload is particularly high during CPR. Citation: Schneider F, Martin J, Schneider G, Schulz CM (2018) The impact of the patient's initial NACA score on subjective and physiological Methods indicators of workload during pre-hospital emergency care. PLoS ONE 13(8): e0202215. NASA task load index (NASA-tlx) and alarm codes were obtained for 216 sorties of pre-hos- https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202215 pital emergency medical care. Furthermore, initial NACA scores of 140 patients were Editor: Ashish K. Khanna, Cleveland Clinic Lerner extracted from the physicians' protocols. The physiological workload indicators mean heart College of Medicine of Case Western Reserve rate (HR) and permutation entropy (PeEn) were calculated for 51 sorties of primary care. University, UNITED STATES General linear mixed models were used to analyze the association of NACA scores with Received: March 24, 2018 subjective (NASA-tlx) and physiological (mean HR, PeEn) measures of workload. -

Identification of the Technical and Medical Requirements for HEMS
Kottmann et al. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (2018) 26:54 https://doi.org/10.1186/s13049-018-0520-3 ORIGINALRESEARCH Open Access Identification of the technical and medical requirements for HEMS avalanche rescue missions through a 15-year retrospective analysis in a HEMS in Switzerland: a necessary step for quality improvement Alexandre Kottmann1,2* , Pierre-Nicolas Carron1, Lorenz Theiler2,3, Roland Albrecht2, Mario Tissi2 and Mathieu Pasquier1 Abstract Background: Avalanche rescues mostly rely on helicopter emergency medical services (HEMS) and include technical rescue and complex medical situations under difficult conditions. The adequacy of avalanche victim management has been shown to be unexpectedly low, suggesting the need for quality improvement. We analyse the technical rescue and medical competency requirements of HEMS crewmembers for avalanche rescue missions, as well as their clinical exposure. The study aims to identify areas that should be the focus of future quality improvement efforts. Methods: This 15-year retrospective study of avalanche rescue by the Swiss HEMS Rega includes all missions where at least one patient had been caught by an avalanche, found within 24 h of the alarm being raised, and transported. Results: Our analyses included 422 missions (596 patients). Crews were frequently confronted with technical rescue aspects, including winching (29%) and patient location and extrication (48%), as well as multiple casualty accidents (32%). Forty-seven percent of the patients suffered potential or overt vital threat; 29% were in cardiac arrest. The on-site medical management of the victims required a large array of basic and advanced medical skills. Clinical exposure was low, as 56% of the physicians were involved in only one avalanche rescue mission over the study period. -

Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) Response in Rural Areas in Poland: Retrospective Study
International Journal of Environmental Research and Public Health Article Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) Response in Rural Areas in Poland: Retrospective Study Patryk Rzo ´nca 1,* , Stanisław Paweł Swie˙zewski´ 2 , Rakesh Jalali 3 , Joanna Gotlib 4 and Robert Gał ˛azkowski 2 1 Department of Emergency Medicine, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, 4-6 Staszica St., 20-081 Lublin, Poland 2 Department of Emergency Medical Services, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, 81 Zwirki˙ i Wigury St., 02-091 Warsaw, Poland; [email protected] (S.P.S.);´ [email protected] (R.G.) 3 Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Collegium Medicum University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 30 Aleja Warszawska St., 10-082 Olsztyn, Poland; [email protected] 4 Division of Teaching and Outcomes of Education, Faculty of Health Science, Medical University of Warsaw, 81 Zwirki˙ i Wigury St., 02-091 Warsaw, Poland; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +48-81-448-6830; Fax: +48-81-448-6832 Received: 7 March 2019; Accepted: 30 April 2019; Published: 30 April 2019 Abstract: The aim of the study was to identify the characteristics of missions performed by HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) crews and the analysis of health problems, which are the most common cause of intervention in rural areas in Poland. The study was conducted using a retrospective analysis based on the medical records of patients provided by the HEMS crew, who were present for the emergencies in rural areas in the period from January 2011 to December 2018. -

A Difficult Part of EMS Transport: a Swiss Cross-Sectional Study
RESEARCH ARTICLE The dead and the dying - a difficult part of EMS transport: A Swiss cross-sectional study Rebecca Maria Hasler1,2*, Sandra Stucky1, Heinz BaÈhler2, Aristomenis K. Exadaktylos1, Frank Neff2,3 1 Department of Emergency Medicine, Inselspital, University Hospital Bern, Bern, Switzerland, 2 SanitaÈtspolizei Bern, Emergency Medical Service Bern, Bern, Switzerland, 3 Department of Anesthesiology and Pain Therapy, Inselspital, University Hospital Bern, Bern, Switzerland * [email protected], [email protected] Abstract a1111111111 Objective a1111111111 a1111111111 Most deaths occur in the pre-hospital setting, whereas mortality in the emergency depart- a1111111111 ment (ED) is low (<1%). However, our clinical impression is that some patients are being a1111111111 transported to hospital in devastating conditions with no likelihood of survival, but demanding extensive hospital resources. The decision on whether to transport a dying person to hospital or not is a difficult task for emergency medical services (EMS) personnel. As there is little epi- demiological data about these patients, this paper aims to describe this special population. OPEN ACCESS Citation: Hasler RM, Stucky S, BaÈhler H, Methods Exadaktylos AK, Neff F (2018) The dead and the dying - a difficult part of EMS transport: A Swiss Retrospective cross-sectional study on adult patients transported by ground ambulance to cross-sectional study. PLoS ONE 13(2): e0191879. the ED of a Swiss university hospital, who died during their stay in the ED between January https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191879 2008 and December 2012. Data was collected on the basis of ambulance report forms and Editor: Chiara Lazzeri, Azienda Ospedaliero discharge summaries of the ED.