Trendbuch Inhalt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ideologies of Autonomy
Wikipedia @ 20 Ideologies of Autonomy Christopher M. Cox Published on: Jun 11, 2019 Updated on: Jun 21, 2019 Wikipedia @ 20 Ideologies of Autonomy Introduction When I first began routinely using Wikipedia in the early 2000s, my interest owed as much to the model for online curation the site helped to popularize as it did Wikipedia itself. As a model for leveraging the potential of collective online intelligence, emerging modes of online productivity enabled everyday people to help build Wikipedia and, just as importantly for me, proliferated the use of “Wikis” to centralize and curate content ranging from organizational workflows to repositories for the intricacies of pop culture franchises. As a somewhat obsessive devotee of the television series Lost (2004-2011), I was especially enthusiastic about the latter, since the Lostpedia wiki was an essential part of my engagement with the series’ themes, mysteries, and motifs. On an almost daily basis during the show’s run, I found myself plunging ever deeper into Lostpedia, gleaming reminders of previous plot points and character interactions and using this knowledge to piece together ideas about the series’ sprawling mythology. Steadily, as Wikipedia also became a persistent fixture in my online media diet, I found myself using the site in a similar manner, often going down “Wikipedia holes” wherein I bounced from page to page, topic to topic, probing for knowledge of topics both familiar and obscure. This newfound ability to find, consume, and interact with a universe of ideas previously diffuse among various types of sources and institutions made me feel empowered to more readily self- direct my intellectual interests. -

Télécharger Le Texte Intégral En Format
ANNUAIRE FRANÇAIS DE RELATIONS INTERNATIONALES 2019 Volume XX PUBLICATION COURONNÉE PAR L’ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES (Prix de la Fondation Edouard Bonnefous, 2008) Université Panthéon-Assas Centre Thucydide AFRI_2019_v3_1124p.indd 3 24/04/2019 11:44 WIKIPÉDIA PAR VALÉRIE NICOLAS (*) Wikipédia (1) est un site Internet collaboratif qui se décrit lui-même comme « encyclopédie en libre accès, en lecture comme en écriture » (2). Multilingue, ce site est servi par un logiciel identique le Mediawiki. Il est adossé à une fondation à but non lucratif Wikimedia, qui assure son fonctionnement et gère d’autres projets frères. Le contenu de Wikipédia est disponible sous licence libre (3). Ainsi chacun peut le recopier, le modifier et l’utiliser. Le projet encyclopédique est alimenté par chaque utilisateur par une écriture collaborative, participative et bénévole. Crée en 2001 par deux ressortissants américains (4), Wikipédia (WP) est en 2014 le 5e site le plus fréquenté au monde (5). 500 millions de visiteurs le consultent chaque mois. Il offre aux lecteurs plus de 30 millions d’articles dans plus de 300 versions linguistiques. La version en anglais – matrice du projet –, compte plus de 5 millions de contributions. Les chiffres sont évocateurs du formidable recueil de connaissances que WP constitue. Internet est le moteur et le vecteur du succès du projet Wikipédia. Internet est un réseau de réseaux informatiques international organisé grâce à un protocole unique de communication (TCP/IP). Outil de communication, le World Wide Web (Web), un des services fournis par le réseau (6), a bouleversé les échanges entre les individus. Le réseau permet leur multiplication sans considération de frontières, ni de temps. -

DELTA Summit • Dr Abdalla Kablan, Entrepreneur & Fintech Expert
INNOVATION STAGE POWERED BY CONFERENCE AGENDA 4TH OCTOBER INSPIRING STORIES 11:30 Welcome to track: Inspiring stories Josh o’Cock | Moderator 11:35 The future of crypto finance in the start-up ecosystem [Keynote] Calvin Cheng 11:50 Blockchain: The disruption in finance [Keynote] Hermann Hauser 12:05 The future of cryptocurrency payments [Keynote] Sanja Kon 12:20 How growth is changing [Fireside Chat] Josh o’Cock | Moderator • David Darmanin 12:35 An entrepreneur’s journey [Keynote] Rahul Sood 12:50 The future of community [Fireside Chat] Tugce Ergul | Moderator • Liz Hagelthorn 13:05 The anthropology of blockchains: Centralization, decentralization, trust and memory [Keynote] Natalie Smolenski FUTURE OF CONNECTIVITY 14:30 Welcome to track: Future of connectivity Luke Todd 14:35 The future of disruption in an AI world [Keynote] Angelo Dalli 14:50 Connectivity 2025 [Panel] Sarah Austin | Moderator • Sonia Hernandez • Harald Rösch • Nikhil Patil 15:20 The digital airline passenger experience [Keynote] Louis Giordimaina 15:35 Preparing for the next wave - IOT, sharing economy, jobs and skill [Keynote] Tanya Sammut Bonnici 15:50 Exploring successful business models with open data [Keynote] Ryan Goodman 16:05 Cloud computing powered blockchain [Keynote] Konstantinos Pantos 16:20 Why your next financial advisor will be a robot [Keynote] Andrew Cachia SPOTLIGHT 16:40 An interview with Edward de Bono [Fireside Chat] Julian Azzopardi | Moderator • Edward de Bono INNOVATION STAGE POWERED BY CONFERENCE AGENDA 5TH OCTOBER SPOTLIGHT 10:00 Smart cities -
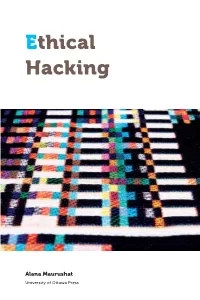
Ethical Hacking
Ethical Hacking Alana Maurushat University of Ottawa Press ETHICAL HACKING ETHICAL HACKING Alana Maurushat University of Ottawa Press 2019 The University of Ottawa Press (UOP) is proud to be the oldest of the francophone university presses in Canada and the only bilingual university publisher in North America. Since 1936, UOP has been “enriching intellectual and cultural discourse” by producing peer-reviewed and award-winning books in the humanities and social sciences, in French or in English. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Title: Ethical hacking / Alana Maurushat. Names: Maurushat, Alana, author. Description: Includes bibliographical references. Identifiers: Canadiana (print) 20190087447 | Canadiana (ebook) 2019008748X | ISBN 9780776627915 (softcover) | ISBN 9780776627922 (PDF) | ISBN 9780776627939 (EPUB) | ISBN 9780776627946 (Kindle) Subjects: LCSH: Hacking—Moral and ethical aspects—Case studies. | LCGFT: Case studies. Classification: LCC HV6773 .M38 2019 | DDC 364.16/8—dc23 Legal Deposit: First Quarter 2019 Library and Archives Canada © Alana Maurushat, 2019, under Creative Commons License Attribution— NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Printed and bound in Canada by Gauvin Press Copy editing Robbie McCaw Proofreading Robert Ferguson Typesetting CS Cover design Édiscript enr. and Elizabeth Schwaiger Cover image Fragmented Memory by Phillip David Stearns, n.d., Personal Data, Software, Jacquard Woven Cotton. Image © Phillip David Stearns, reproduced with kind permission from the artist. The University of Ottawa Press gratefully acknowledges the support extended to its publishing list by Canadian Heritage through the Canada Book Fund, by the Canada Council for the Arts, by the Ontario Arts Council, by the Federation for the Humanities and Social Sciences through the Awards to Scholarly Publications Program, and by the University of Ottawa. -
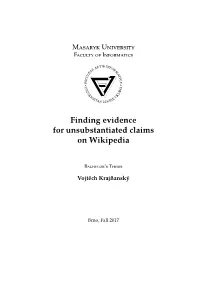
Finding Evidence for Unsubstantiated Claims on Wikipedia
Masaryk University Faculty of Informatics Finding evidence for unsubstantiated claims on Wikipedia Bachelor’s Thesis Vojtěch Krajňanský Brno, Fall 2017 Masaryk University Faculty of Informatics Finding evidence for unsubstantiated claims on Wikipedia Bachelor’s Thesis Vojtěch Krajňanský Brno, Fall 2017 This is where a copy of the official signed thesis assignment and a copy ofthe Statement of an Author is located in the printed version of the document. Declaration Hereby I declare that this paper is my original authorial work, which I have worked out on my own. All sources, references, and literature used or excerpted during elaboration of this work are properly cited and listed in complete reference to the due source. Vojtěch Krajňanský Advisor: Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D. i Acknowledgements I would like to thank my advisor, Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D., for his patient guidance which proved invaluable in helping me finish this work. My thanks also belong to Mgr. Michal Krajňanský, who first sparked my interest in the field of computer science, andwho provided me with helpful insights in our various discussions about computational linguistics and natural language processing. Finally, I would like to express my gratitude to Lorcan Cook, for proofreading this work. iii Abstract The goal of this thesis is the creation of a Python script to help Wikipedia annotators semi-automate the process of source searching for claims which have been marked as requiring an external source. The result is a language independent tool which parses a given set of Wikipedia articles, retrieves parts of text which have been deemed to be unsubstantiated claims, formulates a free text search query for a given claim and retrieves relevant responses via the Bing Web Search API. -

Social-Collaborative Determinants of Content Quality in Online Knowledge Production Systems: Comparing Wikipedia and Stack Overf
Social Network Analysis and Mining (2018) 8:36 https://doi.org/10.1007/s13278-018-0512-3 ORIGINAL ARTICLE Social‑collaborative determinants of content quality in online knowledge production systems: comparing Wikipedia and Stack Overflow Sorin Adam Matei1 · Amani Abu Jabal2 · Elisa Bertino2 Received: 20 December 2017 / Revised: 18 April 2018 / Accepted: 18 April 2018 © Springer-Verlag GmbH Austria, part of Springer Nature 2018 Abstract Online knowledge production sites, such as Wikipedia and Stack Overflow, are dominated by small groups of contributors. How does this affect knowledge quality and production? Does the persistent presence of some key contributors among the most productive members improve the quality of the knowledge, considered in the aggregate? The paper addresses these issues by correlating week-by-week value changes in contribution unevenness, elite resilience (stickiness), and content quality. The goal is to detect if and how changes in social structural variables may influence the quality of the knowledge produced by two representative online knowledge production sites: Wikipedia and Stack Overflow. Regression analysis shows that on Stack Overflow both unevenness and elite stickiness have a curvilinear effect on quality. Quality is optimized at specific levels of elite stickiness and unevenness. At the same time, on Wikipedia, quality increases linearly with a decline in entropy, overall, and with an increase in stickiness in the maturation phase, after an entropy elite stickiness, quality of content peak is reached. Keywords Wikipedia · Stack Overflow · Unevenness · Elite stickiness · Quality of Content 1 Introduction world from formal institutions to voluntary groups and what is commonly called “peer-production”. We live in a world dominated by social media and user- If we are to differentiate between modes of knowledge generated content. -

The Rise of Decentralized Autonomous Organizations: Coordination and Growth Within Cryptocurrencies
Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 6-6-2018 10:30 AM The Rise of Decentralized Autonomous Organizations: Coordination and Growth within Cryptocurrencies Ying-Ying Hsieh The University of Western Ontario Supervisor Vergne, Jean-Philippe The University of Western Ontario Graduate Program in Business A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree in Doctor of Philosophy © Ying-Ying Hsieh 2018 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Business Administration, Management, and Operations Commons Recommended Citation Hsieh, Ying-Ying, "The Rise of Decentralized Autonomous Organizations: Coordination and Growth within Cryptocurrencies" (2018). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 5393. https://ir.lib.uwo.ca/etd/5393 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. Abstract The rise of cryptocurrencies such as Bitcoin is driving a paradigm shift in organization design. Their underlying blockchain technology enables a novel form of organizing, which I call the “decentralized autonomous organization” (DAO). This study explores how tasks are coordinated within DAOs that provide decentralized and open payment systems that do not rely on centralized intermediaries (e.g., banks). Guided by a Bitcoin pilot case study followed by a three-stage research design that uses both qualitative and quantitative data, this inductive study examines twenty DAOs in the cryptocurrency industry to address the following question: How are DAOs coordinated to enable growth? Results from the pilot study suggest that task coordination within DAOs is enabled by distributed consensus mechanisms at various levels. -

Creation, Enrichment and Application of Knowledge Graphs
CREATION, ENRICHMENT AND APPLICATION OF KNOWLEDGE GRAPHS Von der Fakult¨atf¨urElektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universit¨atHannover zur Erlangung des Grades DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN Dr. rer. nat. genehmigte Dissertation von M. Sc. Simon Gottschalk geboren am 22. April 1992 in Hannover, Deutschland Hannover, Deutschland, 2021 Referent: Prof. Dr. techn. Wolfgang Nejdl Korreferent: Prof. Dr. Elena Demidova Korreferent: Prof. Dr. S¨orenAuer Tag der Promotion: 29. April 2021 ABSTRACT The world is in constant change, and so is the knowledge about it. Knowledge-based systems { for example, online encyclopedias, search engines and virtual assistants { are thus faced with the constant challenge of collecting this knowledge and beyond that, to understand it and make it accessible to their users. Only if a knowledge-based system is capable of this understanding { that is, it is capable of more than just reading a collection of words and numbers without grasping their semantics { it can recognise relevant information and make it understandable to its users. The dynamics of the world play a unique role in this context: Events of various kinds which are relevant to different communities are shaping the world, with examples ranging from the coronavirus pandemic to the matches of a local football team. Vital questions arise when dealing with such events: How to decide which events are relevant, and for whom? How to model these events, to make them understood by knowledge-based systems? How is the acquired knowledge returned to the users of these systems? A well-established concept for making knowledge understandable by knowledge-based systems are knowledge graphs, which contain facts about entities (persons, objects, locations, . -
EOS Market Research Summary
EOS Market Research EOS Market Research Summary EOS is by far the largest Initial Coin Offering (ICO) in the history of cryptocurrencies. Having raised more than $3.5 billion, it promises to become an extremely fast and scalable blockchain protocol with zero transaction fees. Even though the EOS main-net has not gone live yet, many believe it has the potential of becoming a standard for decentralized applications that require fast, secure and free interactions between their users. If Bitcoin is digital gold and Ethereum is digital oil, EOS has been likened to digital real estate. The limited supply and everlasting nature of the tokens make it a prime target for investors who feel strongly about a decentralized future. However, this coin is still in the very early stages so should be approached with extreme caution and only as small part of a well-diversified portfolio. All information is valid as of May 11th, 2018. All feedback is welcome. eToro: @MatiGreenspan | Twitter: @MatiGreenspan | LinkedIn: MatiGreenspan EOS Market Research Basic Stats An Initial Coin Offering (ICO) is the • Crypto-asset type: Utility Token equivalent in the crypto-sphere of • Initial supply (June 1st, 2018): securities’ IPOs. Unlike IPOs, which are 1,000,000,000 EOS harshly regulated, ICOs are still lacking • Circulating supply (to date): significant regulation and allow average 950,000,000 EOS Joe investors to support their favourite • Market Capitalization: $14.2 bn projects from a very early stage. • Token Economics: Inflationary Asset o Block producers are Some ICOs have been extremely compensated for creating successful, raising hundreds of millions blocks with new tokens (The of dollars. -
Technology Review of Blockchain Data Privacy Solutions Market
Technology Review of Blockchain Data Privacy Solutions Market Research Document Authors Jack Tanner, Blockchain and SSI developer at Jack and the Blockstalk Roshaan Khan, Product Manager at Block One Contributors Alexandre Bourget, Co-founder and CTO at Dfuse Andres Gomez Ramirez, Security Researcher at EOS Costa Rica Brendon Ross, Co-founder at Rewired.one Duncan Westland, Head of Global Blockchain R&D at Ernst & Young Edgar Fernandez, Co-founder at EOS Costa Rica Felix Shnir, Quorum Engineering at JPMorgan Jeremy Nation, Content Writer at Block One Mark Woods, VP of Product Management at Block One Max Gravitt, Blockchain Lead and Founder at Digital Scarcity Michael Harris, Product Manager at Block One Paul Sitoh, Freelance Consultant at Applied Consentia Rhett Oudkerk Pool, CEO at Europechain & EOS Amsterdam Sneha Damle, Developer Evangelist at R3 Suneet Bendre, Software Engineer Tech Lead at RobustWealth Torben Anderson, Co-founder at Rewired.one Xavier Fernandez, Blockchain Developer at EOS Costa Rica Yannick Slenter, Digital Strategist at Europechain & EOS Amsterdam Reviewers Amanda Clark, Manager of Product Management at Block One Caspar Roelofs, Founder at Gimly Daniel Larimer, Former CTO at Block One Ian Holsman, VP of Software Engineering at Block One The views, thoughts, and opinions expressed in this article belong solely to the authors, and not necessarily to the authors’ employers. Any reference in this article to any product, resource or service is not an endorsement or recommendation. We are not responsible for, and disclaim any and all responsibility and liability for, your use of or reliance on any of these products, resources or services or any content in this article. -

+ Everipedia(IQ)
(IQ) ساتوشی Everipediaناکاموتو چیست؟ +کیست؟کاربردهابررسی و راز مزایایبزرگ این چند ارز سالهدیجیتال نویسندهنویسنده:: امیدامید فدفدویوی (Everipedia(IQ چیست؟ + کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال همه چیز درباره ارز دیجیتال اوری پدیا (Everipedia(IQ ؛ نسخه بﻻک چینی ویکی پدیا قبل از اینکه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که Everipedia چیست، بیایید مشکﻻت کنونی را که در دانشنامه های آنﻻینی نظیر ویکی پدیا وجود دارد، بررسی کنیم. مقاﻻتی که در ویکی پدیا منتشر شده است، توسط کاربرانی نوشته شده است که اغلب برای نوشتن چنین مقاﻻتی هیچگونه پاداشی دریافت نمی کنند و لذا افراد کمی تمایل دارند که مقاله بنویسند. از دیگر مشکﻻتی که در رابطه با چنین دانشنامه هایی ممکن است وجود دارد، امکان سانسور مطالب توسط دولت ها است. دولت ها به راحتی می توانند با ساخت یک اکانت در ویکی پدیا اقدام به تغییر اطﻻعات موجود کنند. عﻻوه براین، دولت ها این توانایی را دارند که صفحات مختلف یک دانشنامه ی آنﻻین را فیلتر کنند. چنانچه شما جزء دنبال کنندگان مقاﻻت دنیای بﻻک چین باشید، به خوبی می دانید که هرکدام از بﻻک چین ها و پلتفرم های غیرمتمرکز قرار است که مشکﻻت کنونی یک صنعت را حل کنند؛ به عنوان مثال می توان حل مشکﻻت صنعت ذخیره سازی توسط فایل کوین را نام برد. پلتفرمی که قادر است تا مشکﻻت کنونی دانشنامه های آنﻻین را برطرف کند، Everipediaاست. در این مقاله به معرفی ارز دیجیتال Everipedia و تفاوت ها و ویژگی های منحصربه فرد آن با دانشنامه های فعلی نظیر ویکی پدیا خواهیم پرداخت. فهرست مطالب ✓ اِوْری پِدیا چیست؟ ✓ چرا اوری پدیا در بستر بﻻک چین ایاس ساخته شده است و نه بﻻک چین اتریوم؟ ✓ توکن هایIQ ✓ تفاوت های اوری پدیا با ویکی پدیا ✓ PredIQt: بازار پیش بینی ✓ نحوه ی نگارش و ویرایش مقاﻻت در اوری پدیا ✓ سواﻻت متداول ✓ جمع بندی 2 www.omidfadavi.me (Everipedia(IQ چیست؟ + کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال اِوْری پِدیا چیست؟ اوری پدیا (Everipedia) را می توان یک دایرة المعارف یا دانشنامه ی (encyclopedia) آنﻻین و بﻻک چین محور درنظر گرفت. -
Igrifikacijski Elementi Na Mrežnim Stranicama Enciklopedija1
Studia lexicographica, 14(2020) 27, STR. 15–32 Josip Mihaljević: Igrifikacijski elementi na mrežnim stranicama enciklopedija Izvorni znanstveni rad Primljeno: 11. II. 2021. Prihvaćeno: 15. III. 2021. UDK https://doi.org/10.33604/sl.14.27.1 030:004.031.4]:794/795 030=163.42]:004.031.4 Igrifikacijski elementi na mrežnim stranicama enciklopedija1 Josip Mihaljević Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb [email protected] SAŽETAK: U radu se analiziraju igre i igrifikacijski elementi koji se nalaze na mrežnim stra- nicama enciklopedija. Analizirano je 92 mrežnih stranica općih i posebnih enciklopedija, od kojih 14 sadržava obrazovne mrežne igre ili određene igrifikacijske elemente. Te su igre razvrstane s obzirom na tip: kviz, križaljka, vješala, slagalica ili zagonetka, jedinstvene igre, igre povezivanja itd. Također su unutar igara enciklopedija te stranica enciklopedija identificirani igrifikacijski elementi koji su često prisutni: bodovanje, razine, priča, sustav nagrađivanja itd. Rezultati provedene analize pokazuju da još uvijek malo mrežnih enciklopedija sadržava igre i igrifikacijske elemente (15%) te da od enciklopedija koje imaju igre većina ima kvizove (70%), ali također da postoje neke jedinstvene obrazovne igre koje sadržavaju priču te mogu pomoći korisnicima u učenju geografije, činjenica o životinjama itd. Postoje i igre poput The Wikipedia Adventure, koje poučavaju korisnike kako se koristiti Wikipedijom. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik kako bi se osmislio konceptualni okvir igrifikacije mrežnoga rječnika. Metodologija izrade konceptualnoga okvira e-rječnika uz neke se preina- ke može iskoristiti i za izradu konceptualnoga okvira igrifikacije enciklopedije. Ključne riječi: crowdsource enciklopedije; enciklopedije; igrifikacija; igrifikacijski elementi; kvi- zovi; mrežne stranice; obrazovne igre 1.