Wintersemester 2015/16 Vorlesungszeit:12.10.2015 - 13.02.2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Development and Interactions of Instructor and Student Musical Identities in a University Introductory Music Course for Non-Music Majors
University of Northern Colorado Scholarship & Creative Works @ Digital UNC Master's Theses Student Research 5-3-2021 Development and Interactions of Instructor and Student Musical Identities in a University Introductory Music Course for Non-Music Majors Nicholas Booker [email protected] Follow this and additional works at: https://digscholarship.unco.edu/theses Recommended Citation Booker, Nicholas, "Development and Interactions of Instructor and Student Musical Identities in a University Introductory Music Course for Non-Music Majors" (2021). Master's Theses. 201. https://digscholarship.unco.edu/theses/201 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by the Student Research at Scholarship & Creative Works @ Digital UNC. It has been accepted for inclusion in Master's Theses by an authorized administrator of Scholarship & Creative Works @ Digital UNC. For more information, please contact [email protected]. UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO Greeley, Colorado The Graduate School DEVELOPMENT AND INTERACTIONS OF INSTRUCTOR AND STUDENT MUSICAL IDENTITIES IN A UNIVERSITY INTRODUCTORY MUSIC COURSE FOR NON-MUSIC MAJORS A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Music Nicholas Alexander Booker College of Performing and Visual Arts School of Music Music Education May 2021 This Thesis by: Nicholas Alexander Booker Entitled: Development and Interactions of Instructor and Student Musical Identities in a University Introductory Music Course for Non-music Majors has been approved as meeting the requirement for the Degree of Master of Music in the College of Arts, Humanities, and Social Sciences in the Department of Music program of Music Education Accepted by the Thesis Committee: ______________________________________________ Brian Casey, D.M.A., Chair, Advisor ______________________________________________ Nancy Glen, D.A., Committee Member Accepted by the Graduate School _____________________________________________________ Jeri-Anne Lyons, Ph.D. -

Traditional Song
3 TraditionalSong l3-9 Traditional Song Week realizes a dream of a comprehensive program completely devoted to traditional styles of singing. Unlike programs where singing takes a back seat to the instrumentalists, it is the entire focus of this week, which aims to help restore the power of songs within the larger traditional music scene. Here, finally, is a place where you can develop and grow in confidence about your singing, and have lots of fun with other folks devoted to their own song journeys. Come gather with us to explore various traditional song genres under the guidance of experienced, top-notch instructors. When singers gather together, magical moments are bound to happen! For Traditional Song Week’s ninth year and our celebration of The Swannanoa Gathering’s 25th Anniversary, we are proud to present a gathering of highly influential singers and musicians who have remained devoted over the years to preserving and promoting traditional song. Tuesday evening will be our big Hoedown for a Traditional Country, Honk-Tonk, Western Swing Song and Dance Night. Imagine singing to a house band of Josh Goforth, Robin and Linda Williams and Ranger Doug or Tim May, Tim O’Brien, and Mark Weems! So, bring your boots and hats, your voices and instruments, and get ready to bring on the fun! Our Community Gathering Time each day just after lunch affords us the opportunity to experience together, as one group, diverse topics concerning our shared love of traditional song. This year’s spotlight will feature folks who have been “on the road” and singing for quite a while. -

The Sociology of Music and Social Distinctions: P!NK's Career As an Example of Social Linkage
Digital Commons @ Assumption University Honors Theses Honors Program 2019 The Sociology of Music and Social Distinctions: P!NK's Career as an Example of Social Linkage David Cifarelli Assumption College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.assumption.edu/honorstheses Part of the Music Commons, and the Social and Behavioral Sciences Commons Recommended Citation Cifarelli, David, "The Sociology of Music and Social Distinctions: P!NK's Career as an Example of Social Linkage" (2019). Honors Theses. 49. https://digitalcommons.assumption.edu/honorstheses/49 This Honors Thesis is brought to you for free and open access by the Honors Program at Digital Commons @ Assumption University. It has been accepted for inclusion in Honors Theses by an authorized administrator of Digital Commons @ Assumption University. For more information, please contact [email protected]. The Sociology of Music and Social Distinctions: P!NK’s Career as an Example of Social Linkage David Cifarelli Faculty Supervisor: Christopher Gilbert, Ph. D Department of English A Thesis Submitted to Fulfill the Requirements of the Honors Program at Assumption College Spring 2019 Cifarelli 1 Introduction Music is extremely social. It is one of the most expressive art forms our society holds. Due this expressive nature, the art of making music can hold many social connotations and directly involve or relate itself to social occurrences, movements and ideals. This intertwined relationship thus allows music to be a conductor of social change by existing and working within these various social constructs. In addition, those involved with the music-making business are, by association, also potential conductors of social change. -

Fall 2019 Library Newsletter
ChaptersTHE NEWSLEttER OF THE SHREWSBURY PUBLIC LIBRARY - FALL 2019 Children and their families enjoy the new outdoor “Construction Zone” play space. A letter from Library Director Ellen Dolan: As described by Wikipedia, “Being Mortal is In this issue I wish to tell you about a new a personal meditation on how people can community wide reading project we will be better live with age-related frailty, serious launching this fall. Some might recall our past illness, and approaching death. Gawande community-wide reading projects based on calls for a change in the way that medical the books My Antonia by Willa Cather, which professionals treat patients approaching focused on the immigrant experience, The their ends. He recommends that instead of Things They Carried by Tim O’Brien, which focusing on survival, practitioners should spoke to the veteran’s experience, and The focus on improving quality of life and enabling Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. well-being.” Pulitzer Prize-winning journalist Katherine Boo noted that Being Mortal is, “A Past projects were predominantly run by deeply affecting, urgently important book library staff and funded through a National — one not just about dying and the limits of Endowment for Humanities grant program medicine, but about living to the last with called the Big Read. In this new project autonomy, dignity, and joy.” the planning team is much broader. It includes representatives from various The project will include various informational town departments (Library, Senior Center, programs on topics such as estate planning, Shrewsbury Public Schools, Parks & Recreation, caregiver stress, and end-of-life planning. -
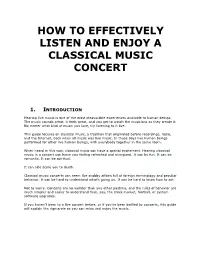
How to Effectively Listen and Enjoy a Classical Music Concert
HOW TO EFFECTIVELY LISTEN AND ENJOY A CLASSICAL MUSIC CONCERT 1. INTRODUCTION Hearing live music is one of the most pleasurable experiences available to human beings. The music sounds great, it feels great, and you get to watch the musicians as they create it. No matter what kind of music you love, try listening to it live. This guide focuses on classical music, a tradition that originated before recordings, radio, and the Internet, back when all music was live music. In those days live human beings performed for other live human beings, with everybody together in the same room. When heard in this way, classical music can have a special excitement. Hearing classical music in a concert can leave you feeling refreshed and energized. It can be fun. It can be romantic. It can be spiritual. It can also scare you to death. Classical music concerts can seem like snobby affairs full of foreign terminology and peculiar behavior. It can be hard to understand what’s going on. It can be hard to know how to act. Not to worry. Concerts are no weirder than any other pastime, and the rules of behavior are much simpler and easier to understand than, say, the stock market, football, or system software upgrades. If you haven’t been to a live concert before, or if you’ve been baffled by concerts, this guide will explain the rigmarole so you can relax and enjoy the music. 2. THE LISTENER'S JOB DESCRIPTION Classical music concerts can seem intimidating. It seems like you have to know a lot. -
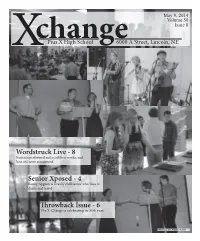
Throwback Issue - 6 the X-Change Is Celebrating Its 50Th Year
May 9, 2014 Volume 50 Issue 8 XchangePius X High School 6000 A Street, Lincoln, NE Wordstruck Live - 8 Students performed and read their works, and 'best ofs' were announced. Senior Xposed - 4 Kenny Nyguen is a really chill senior who likes to dance and travel. Throwback Issue - 6 The X-Change is celebrating its 50th year. PHOTOS BY ANNIE ALBIN 2 News May 9, 2014 Primary election day draws near Pinnacle Bank Arena tion on healthcare policy and previous comments NICK ESPARZA ends season in the red Sports Editor on the issue, and he has also raised questions about Sasse’s ties to the state. This year’s basketball Major stakes are involved in Nebraska’s On the other hand however, the gubernato- HAYLEE DILTZ season really took a toll on Republican primary, with national tea party groups rial race has been heating up as well. Staff Writer the arena as well. State bas- and figures backing Republican Ben Sasse as their With 6 people running for governor, the ketball back in February put a best hope for a Senate victory this election season. competition has stiffened up to take control of the The new Pinnacle halt on concerts and big events, Urgent: Should Obamacare Be Repealed? popular vote. Bank Arena is in the red causing the arena to lose a lot Vote Here Now! Specifically, two canidates have been spar- due to its income loss. more money than expected. With most of the senior class being of age to ring for the lead. The Pinnacle Bank The city of Lincoln is vote, the up and coming primary election is just the Omaha businessman Pete Ricketts and Arena is an indoor arena in said not to have been responsible start of their influence in politics. -

My Voice Is My Weapon: Music, Nationalism, and the Poetics Of
MY VOICE IS MY WEAPON MY VOICE IS MY WEAPON Music, Nationalism, and the Poetics of Palestinian Resistance David A. McDonald Duke University Press ✹ Durham and London ✹ 2013 © 2013 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of America on acid- free paper ♾ Cover by Heather Hensley. Interior by Courtney Leigh Baker Typeset in Minion Pro by Tseng Information Systems, Inc. Library of Congress Cataloging- in- Publication Data McDonald, David A., 1976– My voice is my weapon : music, nationalism, and the poetics of Palestinian resistance / David A. McDonald. pages cm Includes bibliographical references and index. isbn 978-0-8223-5468-0 (cloth : alk. paper) isbn 978-0-8223-5479-6 (pbk. : alk. paper) 1. Palestinian Arabs—Music—History and criticism. 2. Music—Political aspects—Israel. 3. Music—Political aspects—Gaza Strip. 4. Music—Political aspects—West Bank. i. Title. ml3754.5.m33 2013 780.89′9274—dc23 2013012813 For Seamus Patrick McDonald Illustrations viii Note on Transliterations xi Note on Accessing Performance Videos xiii Acknowledgments xvii introduction ✹ 1 chapter 1. Nationalism, Belonging, and the Performativity of Resistance ✹ 17 chapter 2. Poets, Singers, and Songs ✹ 34 Voices in the Resistance Movement (1917–1967) chapter 3. Al- Naksa and the Emergence of Political Song (1967–1987) ✹ 78 chapter 4. The First Intifada and the Generation of Stones (1987–2000) ✹ 116 chapter 5. Revivals and New Arrivals ✹ 144 The al- Aqsa Intifada (2000–2010) CONTENTS chapter 6. “My Songs Can Reach the Whole Nation” ✹ 163 Baladna and Protest Song in Jordan chapter 7. Imprisonment and Exile ✹ 199 Negotiating Power and Resistance in Palestinian Protest Song chapter 8. -

Albany Fire Department 2020 Annual Report Mission, Vision, and Values
Albany Fire Department 2020 Annual Report Mission, Vision, and Values The Albany Fire Department has an established mission: Prevent and Protect From Harm. It is the vision of the Albany Fire Department to be a diversified, safety- conscious, professional organization striving to be a leader in the fire service and community; participating in partnerships with private, public, and nonprofit organizations; continually looking for innovative means of delivering services; maintaining a high level of technical proficiencies through training and education; and understanding that the priority is to prevent rather than react to an emergency. We are courteous, caring, take pride in doing our job, and provide excellent community services. Chief’s Message was an unprecedented year in the history of the Albany Fire Department and our members handled the challenges presented with professionalism, flexibility, and a 2020 focus on safety for our community. As Chief, I am extremely proud of the work the members of Albany Fire Department did this past year. It was busy with emergency calls, requests for services, and adapting to a changing world but our members responded to these challenges in a manner that can make our community proud. In March, the coronavirus put our department in a position where we had to evolve the way we deliver service. Unlike many other professions, we cannot work from home, nor can we close. Instead, we had to adapt and transform how we respond to emergencies in manner that protects those we serve, treats those who need our help, and still protect firefighters and their families from contracting the virus. -

Festival Playbill Festival Playbill 5/8/2017 12:01 AM Page 1
Festival Playbill_Festival Playbill 5/8/2017 12:01 AM Page 1 21ST ANNUAL PLAYGROUND FESTIVAL OF NEW WORKS Potrero Stage / San Francisco / May 11-June 18, 2017 Festival Playbill_Festival Playbill 5/8/2017 12:01 AM Page 2 FROM THE ARTISTIC DIRECTOR ELCOME to the 21st PlayGround Festival of New Works, the Bay Area’s largest showcase of local playwrights and new plays. From May 11 to June 18, we’ll present Wmore than a dozen short and full-length plays over forty-six performances and readings, including our evening of shorts, Best of PlayGround 21 (May 11–28), the world premieres of Robin Lynn Rodriguez’s Hedge (May 15–June 17) and Ignacio Zulueta’s Kano + Abe (May 22–June 18), curtain raisers by top high school dramatists as part of our 9th annual Young Playwrights Project (May 18–21), and staged readings of new full-length works by Crish Barth, Patricia Cotter, Victoria Chong Der, and Kirk Shimano (May 20–21 and May 27–28). Over six weeks, the PlayGround Festival offers you a singular opportunity to sample the very best the Bay Area has to offer in new plays and new voices for the stage! The Festival is just one of the many ways in which PlayGround supports the development of new writers, new plays, and new audiences. In October 2015, PlayGround signed the master lease for Thick House Theater and, over the last year-and-a-half, we raised more than $260,000 to complete major renovations to the theatre, including new air conditioning, seats, theatrical lighting, signage, and upgrades to the lobby and restrooms. -

Center School District 58 Regular Session Meeting 8701 Holmes Road Kansas City, MO 64131
Center School District 58 Regular Session Meeting 8701 Holmes Road Kansas City, MO 64131 There will be a regular meeting of the Board of Education of Center School District #58 in the Board Room at Boone Elementary School, 8817 Wornall, on Monday, November 19, 2018, at 7:00 p.m. Dr. Sharon K. Nibbelink, Superintendent of Schools Comments to the Public Individuals are welcome to address the Board on specific agenda items when that item is reached on the agenda. Individuals who wish to address an agenda item should give their name to the Board secretary prior to the meeting. When your name is called, please come up to the microphone, introduce yourself, and limit your comments to three minutes. I. CALL TO ORDER AND ROLL CALL II. PLEDGE OF ALLEGIANCE III. APPROVAL OF AGENDA - ACTION IV. ANNOUNCEMENTS – Read by Board President A. 11/21-23 Thanksgiving Break B. 11/28 – CMS Choir Concert, 6:30pm C. 12/1 – CMS Wrestling Tournament, 8:00am D. 12/1 – All District Skating Party, 4-6pm Skate City, OP, KS E. 12/3 – 5th Grade Parent Meeting, 6:00pm @ CMS F. 12/4 – All District Holiday Reception, 3-5pm @ CHS G. 12/10-14 CMS Food Drive H. 12/17 – CHS Winter Choir Concert, 6:00pm @CHS I. 12/17 – Regular School Board Meeting, 7:00pm For additional announcements, please check your student’s school website and the Center School District calendar V. RECOGNITIONS - None VI. CONSENT ITEMS - ACTION A. Approval of Bills B. Attendance Report C. Permission to Bid - None D. Approval of Bids - None E. -
ASCAP Music Money.Pdf
By Todd Brabec and Jeff Brabec This information has been provided as a service by American Society of Composers, Authors and Publishers Updated May 2008 TABLE OF CONTENTS Income Chart 2 Music and Money 3 Copyright Protection 4 Performing Right Payments 5 Download, CD and Record Sales 7 Controlled Composition Clauses 8 Television 10 Motion Pictures 11 Home Video 13 Advertising Commercials 13 Broadway Musicals 14 Internet 15 Other Income Sources 16 Recording Artist Royalties 16 Foreign Country Royalties 18 z Songwriter/Music Publisher MUSIC and MONEY Income Chart The songwriter/publisher income chart on the opposite page U.S. singles sales (100,000 copies) $ 9,100 shows some of the many ways a songwriter, recording artist or U.S. album sales (500,000 copies) 45,500 publisher can generate income. U.S. downloads (200,000) 18,200 U.S. radio and TV performances 700,000 A songwriter makes money when songs are downloaded or Foreign single/Album sales 110,000 when a CD or cassette containing one of his or her songs is sold, when the songs are played on the radio, or performed in a TV Foreign radio and TV performances 600,000 show or concert hall, or broadcast in a foreign country. Royalties Sheet music and folios 25,000 can also be generated from the sale of sheet music, a ringtone Advertising commercial 175,000 or from the use of a song in a commercial, a motion picture, Song in a television series 15,000 Broadway musical, subscription service or video game. Song in a motion picture 40,000 Foreign theatrical performances 4,000 Since each source of income has its own distinct payment Broadway show use 110,000 structure, figuring out exactly how a songwriter, artist or music publisher makes money and where that money comes Dolls and toys 20,000 from can be a major challenge. -

22804 JFM Educators Guide Layout
The Hartford’s Junior Fire Marshal® Program www.thehartford.com/jfm BE FIRE SAFE EDUCATORS’ GUIDE Teaching Fire Safety and Prevention TEACHING FIRE SAFETY: Introduction to the Educators’ Guide and the Junior Fire Marshal Program® Thank you for your commitment to teaching fire safety to our nation’s children. Education plays an important role in reducing the number of fire-related injuries and deaths. The Hartford’s Junior Fire Marshal program empowers children by giving them the tools they need to take an active role in reducing risk in their homes and communities. This guide is organized into two sections. The first, Fire Safety: Causes and Prevention, identifies common fire risks, such as smoking and cooking, and offers strategies for reducing those risks. The second section, Fire Safety: Preparing for and Reacting to an Emergency, provides children with information on what to do if they are confronted by a hazardous situation. Each lesson includes an objective, supporting information and one or two activities. The program is designed for children in kindergarten through 3rd grade. For nearly 200 years, The Hartford has helped families remain safe and secure. It is for this reason that the Junior Fire Marshal Program was created in 1947 to teach children the basics of personal fire safety and give families the information they need to be prepared in a fire emergency. The program helps educators and parents share fire safety and prevention tips with children in an easy, engaging way. You can also find additional resources at www.thehartford.com/jfm BE FIRE SAFE EDUCATORS’ GUIDE TABLE OF CONTENTS I.