Creative Access
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
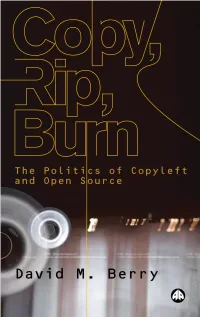
Copy, Rip, Burn : the Politics of Copyleft and Open Source
Copy, Rip, Burn Berry 00 pre i 5/8/08 12:05:39 Berry 00 pre ii 5/8/08 12:05:39 Copy, Rip, Burn The Politics of Copyleft and Open Source DAVID M. BERRY PLUTO PRESS www.plutobooks.com Berry 00 pre iii 5/8/08 12:05:39 First published 2008 by Pluto Press 345 Archway Road, London N6 5AA www.plutobooks.com Copyright © David M. Berry 2008 The right of David M. Berry to be identifi ed as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 978 0 7453 2415 9 Hardback ISBN 978 0 7453 2414 2 Paperback Library of Congress Cataloging in Publication Data applied for This book is printed on paper suitable for recycling and made from fully managed and sustained forest sources. Logging, pulping and manufacturing processes are expected to conform to the environmental standards of the country of origin. The paper may contain up to 70% post consumer waste. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Designed and produced for Pluto Press by Chase Publishing Services Ltd, Sidmouth, EX10 9QG, England Typeset from disk by Stanford DTP Services, Northampton Printed and bound in the European Union by CPI Antony Rowe, Chippenham and Eastbourne Berry 00 pre iv 5/8/08 12:05:41 CONTENTS Acknowledgements ix Preface x 1. The Canary in the Mine 1 2. The Information Society 41 3. -

The Entertainment Industry Is Cracked, Here Is the Patch !
The Entertainment Industry is Cracked, Here is the Patch ! Alban MARTIN The Entertainment Industry is Cracked, Here is the Patch ! Publibook Dialoguez avec l’auteur, et retrouvez cet ouvrage accompagné de la critique de notre club de lecture, des commentaires des lecteurs, sur le site Publibook : http://www.publibook.com Publibook, Paris, 2004 Ce texte publié par Publibook est protégé par les lois et traités internationaux rela- tifs aux droits d’auteur. Son impression sur papier est strictement réservée à l’acquéreur et limitée à son usage personnel. Toute autre reproduction ou copie, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon et serait passible des sanctions prévues par les textes susvisés et notamment le code français de la pro- priété intellectuelle et les conventions internationales en vigueur sur la protection des droits d’auteur. Éditions Publibook, 14, rue des Volontaires 75015 Paris – France Tél : 33 (0)1 53 69 65 55 IDDN.FR.010.0103320.000.R.P.2004.035.40000 Sommaire Introduction........................................................................................................................13 The internet and the new technologies have modified our experience of entertainment products on a long term basis ....................................15 1. Consumers have been empowered by the internet and the new technologies .............15 1.1. The role of intermediaries is put into question ....................................................15 1.1.1. Music Majors are challenged by Peer-To-Peer Networks...........................15 1.1.2. The promotion of entertainment products is more and more direct.............16 1.1.3. Direct added value is determinant for intermediary services ......................17 1.2. Consumers have higher expectations toward entertainment products .................19 1.2.1. -

The Record Industry and Competition Law in the Twenty-First Century
THE RECORD INDUSTRY AND COMPETITION LAW IN THE TWENTY-FIRST CENTURY O. CHISCENCO PhD 2009 THE RECORD INDUSTRY AND COMPETITION LAW IN THE TWENTY-FIRST CENTURY OXANA CHISCENCO A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the University of Westminster for the degree of Doctor of Philosophy September 2009 2 Abstract This research argues for recognition of the importance of cultural industries and cultural diversity and their special treatment by competition law. It uses the record industry as a tool to demonstrate how independent music labels contribute to diversity in a record business dominated by four major players. Whilst some scholars have advocated the inclusion of cultural issues under competition law, no concrete suggestions have been made as to how exactly to do that and no study has been made to determine what pitfalls may lay in doing so. This thesis deals with the lacuna by adopting a number of approaches and shows why cultural industries require special protection by competition law. The aforesaid is the unique feature of this thesis, which should help bridge the existing gap between theory and practice. In order to address the research question, a three-stranded methodological approach is utilised. Firstly, the historical analysis demonstrates the different competitive dynamics of the record industry since its inception, and it shows that musical diversity generally increased when the industry concentration was low. Secondly, the legal analysis focuses on the EU merger test and Article 81 of the EC Treaty; the US approach is also analysed for comparative purposes. Legal analysis examines how competition law has dealt with the regulation of competitive dynamics in the record industry, drawing analysis from a number of mergers and acquisitions, most notably the merger wrangling between Sony and BMG lasting for 5 years overall.