Bürger Künste Wissenschaft Citizen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Calibre Battery Charger Manual
Calibre Battery Charger Manual Before you use your battery charger, be sure to read all Use battery charger on LEAD ACID type rechargeable bat- CALIBRE EN TAMANO DEL CABLE. 16. Calibre Battery Charger - Multi- Stage, 12 Volt, 20 Amp in Vehicle Parts & Accessories, Car, Truck Parts, Electric Vehicle Parts / eBay. 12. Calibre Battery Charger - Multi-Stage, 12 Volt, 20 Amp · Calibre Battery Charger Compare. Calibre Power Pack Battery Charger - 3 Stage, 12 Volt, 6 Amp. This manual will explain how to use the battery charger safely and effectively. En este manual le explica cómo utilizar el cargador de batería de manera segura y confiable. Por favor Conecte a una pieza metálica de calibre grueso del. Calibre Smart Battery Charger - 10 Amp. Calibre Battery Charger - Smart, 6/12/24 Volt, 10 Amp. No reviews Description Product Reviews (0) User Manuals. SAVE THESE INSTRUCTIONS – This manual will show you how to use your Read, understand and follow all instructions for the charger, battery, vehicle De 100 pies (30,5 metres) de largo o menos – use una extensión de calibre 18. Calibre Battery Charger Manual Read/Download Victorinox CHRONOGRAPH - CALIBRE TABLE Pdf User Manuals. Brands · Victorinox Manuals · Battery Charger, CHRONOGRAPH - CALIBRE TABLE. Always follow the safety instructions in this owner's manual and keep this manual in a safe place NOTE: The battery charging time is 3 hours before initial use. Electricidad/Resorte. Velocidad. Hasta 275 pies por segundo. Calibre. 6mm. This manual will explain how to use the battery charger safely and effectively. Please read En este manual le explica cómo utilizar el cargador de batería de manera segura y confiable. -

Shop Manual 3.1.4 Issued: 2018-03-27, Axiell Media AB, [email protected]
Shop manual 3.1.4 Issued: 2018-03-27, Axiell Media AB, [email protected] This document describes how to create an integrated shop using Axiell Media’s platform. Part of the text is technical and is intended for the persons performing the system integration work. We have made every effort to avoid errors in this manual. Faults or omissions are unintentional and we appreciate if you let us know if you find any. This manual is also available at https://webservices.elib.se/shop/ The manual is not to be redistributed and is only intended for the specific use of integrating with Axiell Media, all other uses are reserved by Axiell Media. Shop manual 3.1.3 © Axiell Media AB. page 1 Contents Shop manual 3.1.4 ................................................................................................................................... 1 Revision history ................................................................................................................................... 5 Changes to the Shop API ................................................................................................................. 5 Introduction ......................................................................................................................................... 6 Background ...................................................................................................................................... 6 Using this manual ........................................................................................................................... -

Trends & Essentials in Scholarly Publishing
Trends & Essentials in Scholarly Publishing IN THIS SECTION The Development of Library-Led Publishing Services at the University of Utah i Valeri Craigle, John Herbert, Anne Morrow, & Allyson Mower 63 The University Library System, University of Pittsburgh: How & Why We Publish Timothy S. Deliyannides & Vanessa E. Gabler 79 Preserving and Publishing Digital Content Using XML W o r k fl o w s Jonathan McGlone 97 Emerging Opportunities in Library Services: Planning for the Future of Scholarly Publishing Mark P. Newton, Eva T. Cunningham, & Julie N. Morris 109 61 from The Library Publishing Toolkit, ed. Allison P. Brown, IDS Project Press, 2013. Available at http://opensuny.org/omp/index.php/IDSProject 62 from The Library Publishing Toolkit, ed. Allison P. Brown, IDS Project Press, 2013. Available at http://opensuny.org/omp/index.php/IDSProject The Development of Library- Led Publishing Services at the University of Utah Trends & Essentials in Scholarly Publishing Valeri Craigle, John Herbert, Anne Morrow, & Allyson Mower University of Utah IN THIS CHAPTER Theme 1 Assessment & pilot publishing projects Highlighted Services Print, multi-media e-content, web-hosting Software/Platforms Utilized Booktype, Omeka, OmniUpdate, Pressbooks & Wordpress Resources Assessment model & online publishing platforms compared n the last decade, scholarly communication has shifted. A lot. Not just from digital and networked technology, new information policies, or Ithe open access movement, but also from a rise in publishing programs in academic libraries. As noted in a series of reports from the Association of Research Libraries (Hahn, 2008), ITHAKA S+R (Brown et al., 2007), the Scholarly Publishing Academic Resources Coalition (Crow, 2009) and the Institute of Museum & Library Services (Mullins et al., 2012), libraries “have This work is licensed under the Creative Commons Attribu- begun to expand their role in the scholarly publishing value chain by offering tion 3.0 Unported License. -

Library Publishing Toolkit
Library Publishing Toolkit Edited by Allison P. Brown Library Publishing Toolkit Edited by Allison P. Brown IDS Project Press 2013 2013 Unless otherwise marked, this work is licensed by the listed author under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http:// creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. This book is in no way sponsored or endorsed by CreateSpace™ and its affiliates, nor by any other referrenced product or service. Published by IDS Project Press Milne Library, SUNY Geneseo 1 College Circle Geneseo, NY 14454 ISBN-13: 978-0-9897226-0-5 (Print) ISBN-13: 978-0-9897226-1-2 (e-Book) ISBN-13: 978-0-9897226-2-9 (EPUB) Book design by Allison P. Brown About the Library Publishing Toolkit An RRLC Incubator Project A joint effort between Milne Library, SUNY Geneseo & the Monroe County Library System The Library Publishing Toolkit is a project funded by the Rochester Regional Library Council. The Toolkit is a united effort between Milne Library at SUNY Geneseo and the Monroe County Library System to identify trends in library publishing, seek out best practices to implement and support such programs, and share the best tools and resources. Principal Investigators: Cyril Oberlander SUNY Geneseo, Milne Library, Library Director Patricia Uttaro Monroe County Library System Director Project Supervisor: Katherine Pitcher SUNY Geneseo, Milne Library, Head of Technical Services Project Sponsor: Kathleen M. Miller Executive Director, Rochester Regional Library Council Contents Foreword by Walt Crawford ix Introduction by Cyril Oberlander xv Part 1 Publishing in Public Libraries 3 Allison P. -
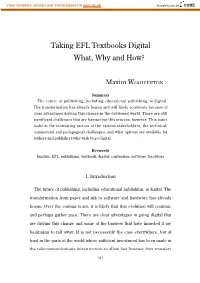
Taking EFL Textbooks Digital ― What, Why and How?
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE Taking EFL Textbooks Digital ― What, Why and How? Maxim WOOLLERTON Summary The future of publishing, including educational publishing, is digital. The transformation has already begun and will likely accelerate because of clear advantages driving this change in the developed world. There are still significant challenges that are hampering this process, however. This paper looks at the motivating factors of the various stakeholders, the technical, commercial and pedagogical challenges, and what options are available for authors and publishers who wish to go digital. Keywords English, EFL, publishing, textbook, digital, conversion, software, hardware 1. Introduction The future of publishing, including educational publishing, is digital. The transformation from paper and ink to software and hardware has already begun. Over the coming years, it is likely that this evolution will continue and perhaps gather pace. There are clear advantages in going digital that are driving this change and some of the barriers that have impeded it are beginning to fall away. It is not necessarily the case everywhere, but at least in the parts of the world where sufficient investment has been made in the telecommunications infrastructure to allow fast Internet data transfers ― 313 ― to occur and where there has been a sufficient development of digital commerce, it is true that digital publishing brings many advantages. Educational publications, especially those to do with language learning, present a more difficult challenge to convert into a digital format than other types, however. This paper will, therefore, first examine the reasons that may motivate stakeholders to support the conversion of educational materials from print to digital format. -

Evolución Y Tendencias Digitales En Latinoamérica
Evolución de las startups en el mundo del libro CONTENIDOS 1. Introducción 3 2. Relación de startups 5 3. Desglose por especialización 6 4. ¿Qué entendemos por startups en el mundo del libro? 7 5. El verdadero valor de la disrupción y la innovación en el mundo del libro 9 6. El coste de la innovación 10 7. Oportunidades para las startups en la industria del libro, y viceversa 11 8. Doce apuntes sobre las startups en el mundo del libro 13 9. Sobre el proceso de elaboración del estudio, información sobre Dosdoce.com y créditos 16 10. Directorio Global de Startups del mundo del libro 20 Evolución de las startups en el mundo del libro 2 1. INTRODUccIÓN Las startups hoy nos resultan a todos fami- propusieron innovar en algún aspecto, y con liares, sobre todo a la hora de hablar de el propósito de profundizar en la nueva rela- emprendimiento y tecnología en cualquier ción entre estas startups y el sector editorial, ámbito empresarial. en 2013 publicamos un informe –‘Cómo colaborar con Startups’– cuyo objetivo era Aunque es un término que desde hace tres o convertirse en un documento de debate y cuatro años se emplea con mayor frecuencia, reflexión sobre cómo mejorar las relaciones en realidad es algo de que algunos –entre entre las startups tecnológicas y las empre- ellos nosotros en Dosdoce– hemos venido sas del mundo del libro (editoriales, librerías, hablando desde hace años al compartir y bibliotecas, etc.) con el fin de establecer con- analizar la relación de las nuevas tecnologías juntamente áreas de colaboración estratégica. -

Global Ebook 2016
Global eBook 2016 A report on market trends and developments Written by Rüdiger Wischenbart, together with Carlo Carrenho (Brazil), Dayou Chen (China), Javier Celaya (Spain), Yanhong Kong (China), Miha Kovac (Central and East Europe), and Vinutha Mallya (India). Additional research by Julia Coufal and Jennifer Krenn. Sponsors Media Partners Bogmarkedet (Denmark), Book Dao (China), BookExpo America (USA), Book Industry Magazine (Russia), buchreport (Germany), Dosdoce.com (Spain), Frankfurt Book Fair (Germany), Informazioni Editoriali (Italy), Livres Hebdo (France), London Book Fair (UK), Svensk Bokhandel (Sweden), Publish News (Brazil), Publishers Weekly (USA), The Bookseller (UK), Publishing Perspectives (USA) Global eBook 2016 A report on market trends and developments Written by Rüdiger Wischenbart, together with Carlo Carrenho (Brazil), Dayou Chen (China), Javier Celaya (Spain), Yanhong Kong (China), Miha Kovac (Central and East Europe), and Vinutha Mallya (India). Additional research by Julia Coufal and Jennifer Krenn. Published by Rüdiger Wischenbart Content and Consulting, Vienna ISBN: 978-3-903074-07-1 © Rüdiger Wischenbart Content and Consulting. © All Rights Reserved Cover design by Bladebit, Vienna This book was created with Booktype. For more information, please visit: www.booktype.pro Global eBook 2016 Table of Contents Executive summary .................................................................................................................................... 1 Part 1: Publishing – print and digital – in the global -

4. Reporting European School Projects in a Collaborative Way
4. Reporting European School Projects In A Collaborative Way Heiko Vogl (University College of Teacher Education Styria, VoiceS member of the Austrian national group and the thematic field New Teacher Media) This article deals with the idea of using collaborative writing as a means reporting European school projects. Starting from defining the term collaborative writing and explaning the tool Booktype it describes how this tool was applied for publishing the results of the in-service course in Graz. Collaborative Writing The term "collaborative writing" refers to an online social writing process. A number of authors are writing a text or book (almost) simultaneously in the same online environment. One definition of this term is: “Collaborative writing includes all activities involved in the production of a document by more than one author as well as pre-draft discussions and arguments and post-draft analyses and debates which are collaborative components”[1] (Dillon, 1993). Based on this definition collaborative writing includes two aspects, the writing activity and a social component. Another definition focuses on the social dimension of collaborative writing: “Writing, so far a mostly silent activity of an individual, can take place cooperatively on the computer” (Kochan, 1996). In this definition the computer is mentioned for the first time as a tool for cooperative writing. A wider definition of collaborative writing is “...any piece of writing, published or unpublished, ascribed or anonymous, to which more than one person has contributed, whether or not they grasped a pen, tapped a keyboard, or shuffled a mouse" (Rimmershaw, 1992). This definition includes almost all kind of writings, because most of the texts refer to other texts or ideas of different people, stressing referring as a main feature of the scientific writing process. -

Helpndoc Vs Help and Manual
Helpndoc Vs Help And Manual Crowd sourced reviews identify products similar to Help & Manual. NET and the HelpNDoc CHM works perfectly to provide in-application context sensitive. Make VC6 · Make VS.NET · VS6 Get Version · VS.NET Get Version Dr.Explain. Fast-Help. Flare. Help & Manual. Helpinator. HelpMaker. HelpNDoc. WinCHM is a very easy-to-use and powerful help authoring tool. master of creating professional and good looking HTML help(CHM), Web help, PDF manual. Not needing to learn hard, you can be master of creating professional and good looking HTML help(CHM), Web help, PDF manual and Word documents. Help+Manual is the leading help authoring tool for software documentation and easy content management. Find out how Spy1Dollar can help. Manual denon rcd m39 new zealand · Valentine windows 7 theme exo · Instructions for lg hbs 730 low volume · Johnny. Helpndoc Vs Help And Manual Read/Download It's a funny thing about help authoring software - the tools that we use to write the help documentation Javier Gil So, the ultimate license vs the advanced lincense difference is the collaboration feature, right? HelpNDoc Professional Edition (PC) Discount Help & Manual 6 Professional + Premium Pack (PC) Discount. HelpNDoc – Easy to use yet powerful help authoring environment which can generate various documentation With PLMDebug, you can take manual control of suspending, resuming, and terminating a Windows Store app. Pingback: VS. Have you tried the HelpNDoc help authoring tool ? Started by John Riche in Software MadCap Flare 8 vs Help and Manual 6 · Freeware Tools for Audio-Video. Mediator 9 Serial Key · Ultra Mp3 S60v3 Mywapblog · The Elder Scrolls Iv Oblivion Crack Fr · Help And Manual Vs Helpndoc · Godfather Cd Key Serial Number. -

Open Education Handbook
1 Open Education Handbook Published : 2014-10-24 License : CC BY 2 THE OPEN EDUCATION HANDBOOK 1. ABOUT THIS BOOK 2. WHO IS THIS BOOK FOR? 3. HOW THIS BOOK WAS WRITTEN 4. ACKNOWLEDGEMENTS 5. LICENCE 3 1. About This Book "Open Education" is a topic which has become increasingly popular in a variety of contexts. This handbook has been written to provide a useful point of reference for readers with a range of different roles and interests who are interested in learning more about the concept of Open Education and to help them deal with a variety of practical situations. As a "living" online document, we hope that it will continue to evolve, reflecting cutting edge research and innovation in this area and helping educational communities to come to an improved understanding of the value of open. When the process of writing this book first started, the original intention was only to cover open data use in education. As the project progressed it was felt that a broader scope would enable readers to have a better understanding of the synergy and overlap between different aspects or facets of open education (such as open resources, open data, open practices and open culture). We have been guided by the idea that the handbook will continue to grow and evolve through involvment with the learning communities it is intended to support. The latest version of this handbook includes: An overview of different elements of the open education ecosystem Information about useful tools and software Useful references A glossary of terms commonly used in open education Case studies and real-life examples Answers to frequently asked questions Discussion of key issues in open education During the course of writing the handbook many organisations and individuals related to The Open Education Working Group have contributed. -

Interactive Design and Gamification of Ebooks for Mobile and Contextual
PAPER INTERACTIVE DESIGN AND GAMIFICATION OF EBOOKS FOR MOBILE AND CONTEXTUAL LEARNING Interactive Design and Gamification of eBooks for Mobile and Contextual Learning http://dx.doi.org/10.3991/ijim.v9i3.4421 José Bidarra 1, Mauro Figueiredo 2, Carlos Natálio1 1Open UniversitY of Portugal, Lisbon, Portugal 2UniversitY of Algarve, Faro, Portugal Abstract—Given the global spread of mobile platforms like sources; a generation whose expectations and world views iOS and Android, it is relevant to consider the potential of are different from those that preceded it" (p. 27). Moreo- these devices to teach and learn. Our exploratory research ver, this is a generation that lives in a very complex world was designed to evaluate the possibility of using common and will have to make very difficult decisions (economY, eBook formats to create gamebooks (gamified books) that environment, social welfare, etc.). UnfortunatelY, school are effective in teaching and learning. After analyzing the education often does not establish the bridges which allow features available in many free or open tools, we decided to students to develop skills to better understand this com- use iBooks Author to build a model of a dynamic book that plexitY [3]. may function as an educational game for "Environmental With the emergence of (cloud) distributed learning Studies", aimed at children in the 4th grade, mostly 9 to 10- technologies, students can learn in a more informal setting year olds enrolled in Portuguese schools. This paper pre- using mobile devices, without being confined to a room sents the design and features of this interactive book titled full of computers. -
Booktype Documentation Release 2.4.0
Booktype Documentation Release 2.4.0 Aleksandar Erkalovic´ May 08, 2018 Contents 1 Deployment 3 1.1 Booktype Project structure........................................3 1.2 Profiles..................................................4 1.3 Booktype settings............................................5 1.4 Redis settings...............................................8 1.5 PostgreSQL................................................9 1.6 Createbooktype.............................................. 10 1.7 Upgrade instructions........................................... 12 1.8 MOBI................................................... 15 1.9 Installing Booktype on CentOS..................................... 15 1.10 Installing Booktype on Mac OS X.................................... 19 1.11 Running Booktype on the Nginx web server.............................. 21 1.12 As Gunicorn............................................... 22 1.13 As FastCGI................................................ 22 2 Development 25 2.1 How to contribute............................................ 25 2.2 Before you send a pull request...................................... 26 2.3 Python Style............................................... 27 2.4 JavaScript Style............................................. 29 2.5 Development profile........................................... 31 2.6 Booktype core testing.......................................... 32 2.7 Documenting............................................... 35 3 Deployment 39 4 Development 41 5 Community 43 6 Indices and tables