Studie: Digitalisierung Und Nachhaltigkeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Determining the Feasibility of a Modular Smartphone: a Systems Analysis Areeb Shahjahan – U5559531, ENGN2226 – T13, 14 October 2015
Determining the Feasibility of a Modular Smartphone: A Systems Analysis Areeb Shahjahan – u5559531, ENGN2226 – T13, 14 October 2015 Abstract In a fast paced technology industry, companies are releasing smartphone models annually and consumers are inclined to change smartphones approximately every 2 years. A modular smartphone is a hardware customizable mobile phone made up of separate individual components. This research project aims to determine the feasibility of a modular smartphone using systems analysis methodologies. Problem scoping incorporated a survey-based qualitative analysis along with quantitative data triangulation. The specifics of the system were then examined through anthropometric and ergonomic considerations as well as material and energy factors. As a result, design recommendations included having three models sized 4”, 5”, and 5.5” (diagonal screen length) with suitable lock button positioning, and the option of a synthetic leather backing or metallic finish. Taking an environmental approach comes at a significant monetary cost; a comparative life- cycle cost analysis of a traditional smartphone and an environmental smartphone was used to deduce this. Extended analysis included optimizations in two specific scenarios: a boot-up time optimization and a NFC pay-wave feedback system. The holistic result of this investigation was that the modular smartphone is a feasible venture given that hardware and software developers dedicate separate divisions to this project and communicate comprehensively, along with a marketing strategy aimed at mainstream smartphone consumers. 1.0 Introduction The smartphone become increasingly evident in society due to its vast range of features reaching far beyond simple voice calling and texting – this includes multimedia (audio/video), internet browsing, instant messaging, widespread application databases and high resolution cameras (Suki, 2013). -

(Hardware and Software) 9Th Edition Pdf Download
A guide to it technical support (hardware and software) 9th edition pdf download Continue Play baseball on the dice and cards at the bottom of the 9th for the iPhone. At the bottom of the 9th is a classic infusion game that is played with cards and cubes, which is now available in your iPhone. This is a faithful adaptation that brings all the elements of the board game right on the device as you can compete with computer opponents, pass and game mode with friends, challenge a friend online, duke it out in the ranking of battles online and more. This is a 2 player strategic game where your choice of players can make a difference against visiting a team of heavy hitters. Both sides have different batters to choose from and have access to support symbols as well. Get on the home plate in this game. You can get this game for $4.99.Go play baseball on the countertop game in your iPhone at the bottom of the 9th. Discover Tom's Guide for more information about the iPhone and iPhone Games.Also check out the forums for the iPhone. Download Total Download: 0 in the game to save games past, MAME is the shield that protects them. Download Total Download: 11792 in the game Play Solitaire and its variants on Windows 8 with Microsoft Solitaire Collection. Download Total Download: 925 in the Game of Wage Wars with players around the world in powerful vehicles from World War II and beyond in World of Tanks. Download Total Download: 3163 in-game play games and connect to other players with UPlay. -

Google's Project
Volume 1 l Issue 7 l December 2014 and use only half of it for the screen, Google’s Project Ara: the rest could be the keyboard. If on a long trip, you could drop a lot of other Piece together your Android modules and replace them with battery http://archive.financialexpress.com/news/google-s-project-ara-piece-together-your-an- modules so that you don’t run out of droid/1303756/3 power. While it seems as simple as building blocks, Project Ara will actually be ushering in cutting edge technology into your hands. This is the first initiation of a network on device concept in the mobile form factor, explains Eremenko, adding that any modules can draw or supply power and also be a power storage device at the same time. While the modules will transmit data and power using inductive contactless coupling, they will have electropermanent magnets that connect them to the frame. Simply put, the design wont have any connectors and users will be able to hot swap any module. Eremenko thinks the biggest impact hat if you could decide the power decided to go ahead with Project Ara will come when people will be able to Wof the processor, resolution of because we felt that finally we were at manage power better by being able to the display and sensor of the camera a point where the overhead penalty of use multiple battery packs and also every time you picked up your making something modular could be when developers start bringing in smartphone to leave home? It might made small enough that it would be fitness modules. -
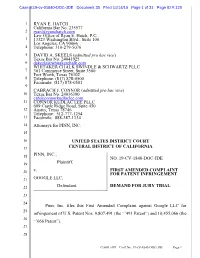
View Complaint
Case 8:19-cv-01840-DOC-JDE Document 30 Filed 11/14/19 Page 1 of 31 Page ID #:128 1 RYAN E. HATCH California Bar No. 235577 2 [email protected] Law Office of Ryan E. Hatch, P.C. 3 13323 Washington Blvd., Suite 100 Los Angeles, CA 90066 4 Telephone: 310-279-5076 5 DAVID A. SKEELS (admitted pro hac vice) Texas Bar No. 24041925 6 [email protected] WHITAKER CHALK SWINDLE & SCHWARTZ PLLC 7 301 Commerce Street, Suite 3500 Fort Worth, Texas 76102 8 Telephone: (817) 878-0500 Facsimile: (817) 878-0501 9 CABRACH J. CONNOR (admitted pro hac vice) 10 Texas Bar No. 24036390 [email protected] 11 CONNOR KUDLAC LEE PLLC 609 Castle Ridge Road, Suite 450 12 Austin, Texas 78746 Telephone: 512-777-1254 13 Facsimile: 888-387-1134 14 Attorneys for PINN, INC. 15 16 UNITED STATES DISTRICT COURT 17 CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 18 PINN, INC., NO. 19-CV-1840-DOC-JDE_______ Plaintiff, 19 v. FIRST AMENDED COMPLAINT 20 FOR PATENT INFRINGEMENT GOOGLE LLC, 21 Defendant. DEMAND FOR JURY TRIAL 22 23 24 Pinn, Inc. files this First Amended Complaint against Google LLC for 25 infringement of U.S. Patent Nos. 9,807,491 (the “’491 Patent”) and 10,455,066 (the 26 “’066 Patent”). 27 28 COMPLAINT – CASE NO. 19-CV-1840-DOC-JDE Page 1 Case 8:19-cv-01840-DOC-JDE Document 30 Filed 11/14/19 Page 2 of 31 Page ID #:129 1 PARTIES 2 1. Pinn, Inc. is a California Corporation with its headquarters and principal 3 place of business at 192 Technology Drive, Suite V, Irvine, California 92618. -

FPCUG Notes for May 2021 Editor: Frank Fota ([email protected])
FPCUG Notes for May 2021 Editor: Frank Fota ([email protected]) SCHEDULE OF EVENTS (7:00 PM - Falmouth Firehouse, Butler Road): The Board of Directors met via the Zoom video teleconference app on April 13th, 2021. In-person meetings/Workshops will soon resume; subject to State and CDC guidelines. -- Thurs, May 6: All About Your Computer (Robert Monroe) – Zoom Virtual Meeting. Send your computer questions in advance to Robert at [email protected]. A link for the Zoom Workshop will be sent by email to FPCUG members. -- Tues, May 11: FPCUG Board of Directors Meeting (Zoom Virtual Meeting). -- Thurs, May 13: General Meeting (Zoom Virtual Meeting). Judy Taylour, President, Editor, and Webmaster of the Santa Clarita Valley Computer Club; Member, APCUG Speakers Bureau, will present, “Ergonomics: You, Your Computer, Tablet, and Smartphone.” Sit straight! Shoulders rounded! Arms relaxed! Feet on the floor! Wrists/hands floating! Cumulative trauma! Repetitive stress syndrome! We have all been using technology for many years; are we still practicing good ergonomics? Or, are we stressing our bodies every day without realizing it by extending our wrists, slouching, sitting without foot support, and bending our head to look at poorly placed monitors? Along the way, we started using tablets and smartphones which have a different set of ergonomic issues. This presentation will take us down memory lane on computer ergonomics and give us ideas on the proper use of our tablets and smartphones. A bit more about Judy Taylour… Judy is a 33-year member of the Santa Clarita Valley Computer Club. She was co-facilitator for the Southern California Regional User Group Summit (SCRUGS), a group of computer clubs in Southern California that met together quarterly for over 20 years to share ideas and presenter information, solve problems, etc. -

Universal Translator with Scratch 3.0
Universal Translator with Scratch 3.0 Participants Perspective Today I learned how technology can be used to help communicate across language barriers by building a universal translator in Scratch 3.0. Learning Goal ● Develop a user friendly interface in Scratch 3.0 to allow for easy input and output of information. ● Use Scratch 3.0’s Google Translate module to translate between languages. Logistics ● Suggested length: 1-2 hours ● Age range: Grade 5 or Older ● Additional requirements: Basic programming skills in Scratch (2.0 or 3.0), including the use of variables and control loops. Part Section Title Group Size Materials Number Opening Say What? Whole group ● Whiteboard or chart paper with Hook markers ● Digital device with access to Google Translate ● Method of showing: ○ Google Translate, and ○ Video (YouTube) to class Part 1 Build a translator Partners ● Digital device with access to Scratch 3.0 and the internet ● Scrap paper and pencil (Optional) Part 2 Use a translator 2 sets of Partners ● Digital device with access to Scratch 3.0 and the Internet Part 3 Closing discussion Whole group ● Digital device to show a video (YouTube) Safety Considerations ● Laptops/Computers- Electrocution hazard from frayed or damaged cords and tripping over unsecured cords. These issues can be mitigated by securing all electrical cords, particularly extension cords, reaching over the floor (using tape) and immediately unplug them after use. Cords are plugged in/unplugged by adults, or by participants under adult supervision. ● Internet: Participants may come across materials that is not appropriate (including but not limited to violent or sexual images, racist/sexist commentary, and so on). -
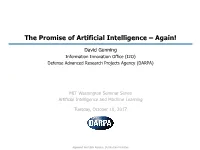
General AI Charts
The Promise of Artificial Intelligence – Again! David Gunning Information Innovation Office (I2O) Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) MIT Washington Seminar Series Artificial Intelligence and Machine Learning Tuesday, October 10, 2017 Approved for Public Release, Distribution Unlimited AI in the News Autonomous Vehicles Image Understanding Language Translation / / / ://www.cbsnews.com CBS Interactive CBS Inc. www.engadget.com :// ://www.roboticstrends.com 2017OathTech Network Aol Tech http Trends Robotics ©2017 Adapted/https https © ©2014 ©2014 >6000 miles without Facebook has 98% Google Pixel Buds real-time operator intervention accuracy translation Approved for Public Release, Distribution Unlimited 2 Commercial R&D ) ) DIUx Experimental ( Experimental - Source: DefenseInnovation Unit Startups Facebook Apple Google Amazon Approved for Public Release, Distribution Unlimited 3 Global Interest in AI Russia China China U.S. / / ©2017 Newsline / Newsline ©2017 TechnologyReview ://www.technologyreview.com ©2017 MIT MIT ©2017 https https://newsline.com “Artificial intelligence is the future, not Research papers published on deep learning only for Russia, but for all humankind. (2012-2016) Whoever becomes the leader in this sphere will become the ruler of the world.” Vladimir Putin – 4 SEP, 2017 Approved for Public Release, Distribution Unlimited 4 Three Waves of AI DESCRIBE PREDICT EXPLAIN Symbolic Reasoning Statistical Learning Contextual Adaptation Engineers create sets of Engineers create Engineers create logic rules to represent -

Electronic 3D Models Catalogue (On July 26, 2019)
Electronic 3D models Catalogue (on July 26, 2019) Acer 001 Acer Iconia Tab A510 002 Acer Liquid Z5 003 Acer Liquid S2 Red 004 Acer Liquid S2 Black 005 Acer Iconia Tab A3 White 006 Acer Iconia Tab A1-810 White 007 Acer Iconia W4 008 Acer Liquid E3 Black 009 Acer Liquid E3 Silver 010 Acer Iconia B1-720 Iron Gray 011 Acer Iconia B1-720 Red 012 Acer Iconia B1-720 White 013 Acer Liquid Z3 Rock Black 014 Acer Liquid Z3 Classic White 015 Acer Iconia One 7 B1-730 Black 016 Acer Iconia One 7 B1-730 Red 017 Acer Iconia One 7 B1-730 Yellow 018 Acer Iconia One 7 B1-730 Green 019 Acer Iconia One 7 B1-730 Pink 020 Acer Iconia One 7 B1-730 Orange 021 Acer Iconia One 7 B1-730 Purple 022 Acer Iconia One 7 B1-730 White 023 Acer Iconia One 7 B1-730 Blue 024 Acer Iconia One 7 B1-730 Cyan 025 Acer Aspire Switch 10 026 Acer Iconia Tab A1-810 Red 027 Acer Iconia Tab A1-810 Black 028 Acer Iconia A1-830 White 029 Acer Liquid Z4 White 030 Acer Liquid Z4 Black 031 Acer Liquid Z200 Essential White 032 Acer Liquid Z200 Titanium Black 033 Acer Liquid Z200 Fragrant Pink 034 Acer Liquid Z200 Sky Blue 035 Acer Liquid Z200 Sunshine Yellow 036 Acer Liquid Jade Black 037 Acer Liquid Jade Green 038 Acer Liquid Jade White 039 Acer Liquid Z500 Sandy Silver 040 Acer Liquid Z500 Aquamarine Green 041 Acer Liquid Z500 Titanium Black 042 Acer Iconia Tab 7 (A1-713) 043 Acer Iconia Tab 7 (A1-713HD) 044 Acer Liquid E700 Burgundy Red 045 Acer Liquid E700 Titan Black 046 Acer Iconia Tab 8 047 Acer Liquid X1 Graphite Black 048 Acer Liquid X1 Wine Red 049 Acer Iconia Tab 8 W 050 Acer -

Reducing Electronic Waste Through the Development of an Adaptable
INFOKARA RESEARCH ISSN NO: 1021-9056 Reducing Electronic Waste through the Development of an Adaptable Mobile Device Loveroop Singh #PEC university Vidya Path, Sector 12, Chandigarh, 160012 Loveroopsingh786”gmail.com Abstract— Electronic waste is a growing problem in the world. As technology is more rapidly developed and made accessible to the public, an increase in the disposal of old electronics becomes more imminent. Electronic waste is harmful to the environment and the amount that it attributes to the waste stream can be reduced. Electronic products such as mobile devices are ubiquitous and the rates with which they are acquired and replaced by the consumers continue to rise. The current mobile device market encourages the acquisition of new devices more often than the end-of-life of the entire product. To create a more sustainable technological future, there must be a reduction in mobile device contribution to electronic waste. The problem of electronic waste with specific focus on mobile devices is approached from a systems engineering perspective. We performed a requirements analysis of alternative architectures that could potentially encourage and inspire customers to keep mobile devices for longer durations. In particular, we explored the idea of Phonebloks or a modular device, identified the critical factors in the development phase as outlined by ISO 15288 and ISO 9001 standards, and implemented a survey to evaluate user interest. This research explores a proof-of-concept design for a mobile device that is durable and customizable. A modular device allows for the consumer to replace a piece of the phone rather than the entire phone when they need to update their device. -

Wish List 2018.Xlsx
Holiday Giving Wish List Diagnostic Center (girls) Resident Items Sizes Alexis Clothing: H&M shirts, Holister pants, Under Armour hoodies; Electronics: headphones, iPhone Shirt - L Age: 16 Pants - 16 Shoes - 10 General - L Anastasia Clothing: hoodies, jeans, t-shirts, long-sleeved shirts, Nikes, Jordan's, Converse,; Shirt - M Entertainment: earbuds, Mp3 player; Personal items: backpack; Gift Cards: Hot Topic Age: 15 Pants - M Shoes - 9-91/2 General - M Briana Clothing: jeans, onesie, Areopostale clothing; Electronics: remote control cars (2), Nintendo Shirt - S DS; Entertainment: football, yarn for crochet, gimp set; Personal Items: hair gel, earrings, Age: 13 Pants - S / 12 perfume, Bath and Body works lotion set, Jumbo braiding hair - color #2 (6 packs); Apple Shoes - 71/2 watch (38mm rose gold); Gift Cards: Amazon, Five Below General - S Kylie Clothing: cute shirts, black bomber jacket, sweat suits, True Religion - jackets, shirts, jeans, Shirt - X-Small Uggs (black with bows), Entertainment: movie - Love That Kills ; Personal Items: small black Age: 17 Pants - 1 or white purse, hoop earrings, bracelets; Gift Cards: Ulta, Foot Locker Shoes - 4-6 General -S Imani Clothing: underwear, windbreakers, pants, t-shirts, Helly Hansen sweat suit, Nike shoes, Shirt - M slides; Electronics: headphones, Mp3 player, aux. cord, portable DVD player; Entertainment: Age: 16 Pants - M movies, urban books; Personal Items: soap, bracelets, fanny packs, body rings, LV backpack, Shoes - 71/2 watch, Gucci belt; Gift Cards: Foreman Mills, Claire's, Forever -

NXT Technologies Qi Wireless Charger Compatibility
NXT Qi Wireless Charger Compatability List Brand Name Product Name Manufacturer Part Number 1MORE 1MORE True Wireless ANC In-Ear Headphones EHD9001TA ACV GmbH Plastic case Inbay 3 coil 240000-01-025 ACV GmbH Aluminium case Inbay 3 coil 240000-01-023 Amazon Fire HD 8 Plus (10th Gen) K72LL3 Anko Wireless Charging Bluetooth Headphone 42895848 Apple iPhone 8 A1863 Apple iPhone 8 Plus A1864 Apple iPhone X A1865 Apple iPhone XS A1920 Apple iPhone XS Max A2101 Apple iPhone XR A2105 Apple iPhone XS Max Smart Battery Case A2071 Apple iPhone XS Smart Battery Case A2070 Apple iPhone XR Smart Battery Case A2121 Apple Wireless Charging Case for AirPods A1938 Apple iPhone 11 A2221 Apple iPhone 11 Pro A2217 Apple iPhone 11 Pro Max A2161 Apple iPhone 11 Smart Battery Case A2183 Apple iPhone 11 Pro Smart Battery Case A2184 Apple iPhone 11 Pro Max Smart Battery Case A2180 Apple iPhone SE A2275 Aptiv APTIV-35086037 35086037 Aptiv APTIV-35062651 35062651 APTIV APTIV-35245867 35245867 APTIV APTIV-35348526 35348526 ASUS ROG Chakram P704 au/KDDI TORQUE G04 KYV46SLA/KYV46SRA/KYV46SKA AUKEY True Wireless Earbuds EP-T10, KSL TRU AVIOT Bluetooth earphone TE-D01d mk2 Bang & Olufsen Charging case E8 2.0 Charging case Bang & Olufsen Charging Case E8 3rd Gen Charging case Bang & Olufsen Charging Case E8 Sport Charging case Belkin Soundform Elite Smart Speaker logoHi-Fi Smart Speaker + Wireless Charger G1S0001 Bose QuietComfort Earbuds Case 429708 Bury Ladestaufach 01.2146.000.D Celfras Semiconductor Inc. Rx Demo Board CWR1010 ConvenientPower CP TX10 CP/27T/1/XX/10B -

Light Sensor Development for Ara Platform
Escola Tecnica` Superior d'Enginyeria de Telecomunicacio´ de Barcelona Master Thesis Light sensor development for Ara platform Author: Supervisor: Alexis DUQUE Pr. Josep Paradells Aspas Wireless Network Group Escola T`ecnicaSuperior d'Enginyeria de Telecomunicaci´ode Barcelona June 2015 Abstract INSA de Lyon - T´el´ecommunications, Services et Usages Escola T`ecnicaSuperior d'Enginyeria de Telecomunicaci´ode Barcelona Master's degree in Telecommunications Engineering Light sensor development for Ara platform by Alexis DUQUE During the last years, Visible Light Communication (VLC), a novel technology that enables standard Light-Emitting-Diodes (LEDs) to transmit data, is gaining significant attention. In the near future, this technology could enable devices containing LEDs { such as car lights, city lights, screens and home appliances { to carry information or data to the end-users, using their smartphone. However, VLC is currently limited by the end-point receiver, such as a the mobile camera, or a peripheral connected through the jack input and to unleash the full potential of VLC, more advanced receiver are required. On other, few year ago, Google ATAP - the Google innovation department - announced the Ara initiative. This consist on a modular phone where parts of the phone, like cameras, sensors or networks can be changed. So when a new feature appears or required by the user it is not needed to change the mobile phone, just to buy the modules with the functionality. This Master Thesis presents the design and development of a simple module that will support communication by light (VLC) using the Ara Module Developer Kit provided by Google. It consists on building a front-end circuit, connecting a photodiode that receives the level of light and use it as data carrier, in order to receive and display data inside a custom Android application on the Ara smartphone.