Bestimmungsprobleme Bei Festuca Norica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rila Monastery Nature Park Management Plan 2004-2013
The Minister of the Environment and Waters D. Arsenova Rila Monastery Nature Park Management Plan 2004-2013 DRAFT Adopted by Decision # ххх of the Council of Ministers dated хх.хх, 2004 Presented by ARD/BCEGP in fulfillment of Terms of Reference commissioned by the Ministry of the Environment and Waters, # хх-хх-хххх, March 2001 The drafting and publication of this Management Plan was made possible through the generous support of the Environment, Energy and Social Transition Department of the Europe and Eurasia Desk of the United States Agency for International Development, pursuant to Contract # LAG-I-00-99-00013-00. All opinions expressed herein are solely at the authors’ discretion and do not necessarily reflect the position of the United States Agency for International Development. February, 2004 Team of Authors The Core Planning Team which drafted the present Management Plan for Rila Monastery Nature Park comprises the following members: Dr. Petar Yankov D.Sc. (ecology/zoology), Dr. Dimitar Peev D.Sc. (ecology/botany), Eng. Ventsisval Velichkov (forest engineer), Mrs. Snezhana Kostadinova (sociologist), as well as the members of the Coordinating Team of the BCEG Project, as follows: Dr. Peter Hetz (team leader), Dimitrina Boteva, MSc. (biodiversity expert) and Gergana Pavlova (administrative support). The Extended Planning Team comprises the following members: Eng. Mihail Mihailov, Director of Rila Monastery Nature Park; Ms. Nikolina Georgieva, biodiversity expert with the Directorate Rila Monastery NP, Eng. Vassil Petrov, acting Director of Rila NP, His Eminence Gabriel, Metropolitan Bishop of Lovech, representative of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church; the Most Reverend Bishop John, Abbot of Rila Monastery, Eng. -
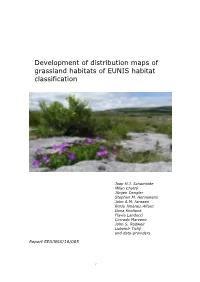
Development of Distribution Maps of Grassland Habitats of EUNIS Habitat Classification
Development of distribution maps of grassland habitats of EUNIS habitat classification Joop H.J. Schaminée Milan Chytrý Jürgen Dengler Stephan M. Hennekens John A.M. Janssen Borja Jiménez-Alfaro Ilona Knollová Flavia Landucci Corrado Marcenò John S. Rodwell Lubomír Tichý and data-providers Report EEA/NSS/16/005 1 Alterra, Institute within the legal entity Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek Professor Joop Schaminée Stephan Hennekens Partners Professor John Rodwell, Ecologist, Lancaster, UK Professor Milan Chytrý, Masaryk University, Brno, Czech Republic Doctor Ilona Knollová, Masaryk University, Brno, Czech Republic Doctor Lubomír Tichý, Masaryk University, Brno, Czech Republic Date: 07 December 2016 Alterra Postbus 47 6700 AA Wageningen (NL) Telephone: 0317 – 48 07 00 Fax: 0317 – 41 90 00 In 2003 Alterra has implemented a certified quality management system, according to the standard ISO 9001:2008. Since 2006 Alterra works with a certified environmental care system according to the standard ISO 14001:2004. © 2014 Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise - without the prior permission in writing of Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek. 2 TABLE OF CONTENTS 1 Introduction 2 Scope of the project 2.1 Background 2.2 Review of the EUNIS grassland habitat types 3 Indicator species of the revised EUNIS grassland habitat types 3.1 Background -

Flora of the Belassitsa Mountain
30 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (No 1) 2016, 30–39 Agricultural Academy FLORA OF THE BELASSITSA MOUNTAIN D. S. DIMITROV and V. M. VUTOV National Natural History Museum, Bulgarian Academy of Sciences, BG - 1000, Sofia, Bulgaria Abstract DIMITROV, D. S. and V. M. VUTOV, 2016. Flora of the Belassitsa Mountain. Bulg. J. Agric. Sci., 22: 30–39 As a result of the floristic investigations of Belassitsa Mt carried out between 2011 and 2012, 1515 species belonging to 517 genera and 106 plant families were recorded. The most numerous representatives were from the families Asteraceae (183), Poaceae (121), Fabaceae (113), Lamiaceae (83), Caryophyllaceae (80), Scrophulariaceae (79), Brassicaceae (77). There are 41 Balkan endemic species and 4 Bulgarian endemic species in the flora of investigated area. Key words: Belassitsa Mt, vascular plants, flora Introduction Ahtarov (1939) reported chorological and ecological Information on the plant and animal world of the Belas- data on the representative of Genus Poa L. in the Belassitsa sitsa Mountain were first found in the travel notes of Evliya Mountain. Çelebi (1972) from the mid-17th century, where he described According to Stojanov (1941), the Belassitsa Mountain the mountain plane, poplars, white oak, turkey oak, elm, falls into the floristic region of Northeastern Macedonia. beech and chestnut, which grow around the entire mountain. Phytogeographic data on the flora of the Belassitsa Moun- Stojanov (1921) reported 1347 species, varieties, and forms tain were found in the studies of Stefanov (1943). on the flora of Belassitsa. He studied the mountain vegetation Information on the beech forest in the Belassitsa Moun- and drew a floristic map of the following formations: chest- tain was found in the works of Marinov, Nedjalkov & Nau- nut forest, beech forest, deciduous shrubs and mixed forest, mov (1961). -

Abstracts Posters
25TH MEETING OF THE EUROPEAN VEGETATION SURVEY Roma 6-9 April 2016 Editors: Emiliano Agrillo, Fabio Attorre, Francesco Spada & Laura Casella Chairman of Organising Committee: Fabio Attorre, Department of Environmental Biology, Sapienza University of Roma, P.le A. Moro, 5 00185 Roma, Italy. Email: [email protected] EVS Meeting Secretary: Emiliano Agrillo, Department of Environmental Biology, Sapienza University of Roma. Orto Botanico, L.go Cristina di Svezia, 24 00165 Roma, Italy. Email – [email protected]. EVS Meeting support staff: • Luca Malatesta • Luisa Battista • Laura Casella • Marco Massimi • Marta Gaia Sperandii • Nicola Alessi • Michele De Sanctis CONTENTS SESSION 1 – WEDNESDAY, APRIL 6TH 11 GEOREFERENCED VEGETATION DATABASE – SAPIENZA: STATE OF THE ART, BASIC STATISTICS AND FUTURE PERSPECTIVES EMILIANO AGRILLO, MARCO MASSIMI, NICOLA ALESSI, FABIO ATTORRE, VITO CAMBRIA, MICHELE DE SANCTIS, FABIO FRANCESCONI & FRANCESCO SPADA 12 FLORISTIC DIVERSITY AND CONSERVATION RELEVANCE OF THE FESTUCO-BROMETEA CLASS IN SERBIA SVETLANA AĆIĆ, URBAN ŠILC, MILICA PETROVIĆ, ZORA DAJIĆ STEVANOVIĆ, GORDANA TOMOVIĆ 13 PATTERNS AND PROCESSES OF LAURUS NOBILIS L. REGENERATION IN THE ITALIAN FORESTS NICOLA ALESSI , CAMILLA WELLSTEIN, FRANCESCO SPADA, STEFAN ZERBE 14 INTERPRETATION OF ANNEX I MIRE HABITATS OF THE HABITATS DIRECTIVE IN LATVIA LIENE AUNIŅA 15 THE EFFECTS OF THE TATRA MARMOT (MARMOTA MARMOTA LATIROSTRIS) ON DIVERSITY OF ALPINE VEGETATION IN NATURA 2000 AREAS IN THE WESTERN CARPATHIANS ZUZANA BALLOVÁ, LADISLAV PEKÁRIK, JOZEF ŠIBÍK 16 ARE THERE ANY DIFFERENCES IN HERB SYNUSIA BETWEEN BLACK LOCUST FORESTS GROWING ON ECOTOPES OF NATURAL HARDWOOD FLOODPLAIN FORESTS? DENISA BAZALOVÁ, MÁRIA PETRÁŠOVÁ, IVAN JAROLÍMEK 17 CHANGES OF SHRUBBY CINQUEFOIL PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA (L.) O.SCHWARZ CHLOROPHYLL A FLUORESCENCE DURING THE GROWTH SEASON AIVA BOJARE, KRISTINE DOKANE, DACE MEGRE, PETERIS EVARTS-BUNDERS 18 MATRIOSKA HABITAT CONCEPT: WHEN A PRIORITY HABITAT BECOMES A VALUABLE FRAMEWORK FOR OTHER HABITATS GIANMARIA BONARI, ALICIA T.R. -

© Angelov G., Bednarska I., 2018 УДК 581.1+582.54 ISOENZYME
ISSN 0206-5657. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 79. С. 29–37 Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2018. Issue 79. P. 29–37 УДК 581.1+582.54 ISOENZYME VARIATION AND GENETIC AFFINITIES AMONG FIVE FESTUCA SPECIES OF SECTION AULAXYPER DUMORT. G. Angelov1*, I. Bednarska2 1Institute of Biodiversity and Ecosystem Research Bulgarian Academy of Sciences 23, Acad. G. Bonchev St., 1113 Sofia, Bulgaria *e-mail: [email protected] 2Institute of Ecology of the Carpathians, NAS of Ukraine 4, Kozelnytska St., Lviv 79026, Ukraine е-mail: [email protected] Despite a considerable number of taxonomical and biosystematic studies of genus Festuca L. in Europe, there are few papers discussing phylogeny and systematic of genus Festuca as well the evolution of its different groups. The most important among them are the studies of N. Tzvelev, who proposed three sections within type subgenus Festuca: Vari- ae Hack., Aulaxyper Dumort. and Festuca. There are many studies on species belonging to section Festuca, including chemosystematic ones, but the species of section Aulaxyper are rather neglected. For this reason we choose F. rubra L., F. nigrescens Lam., F. picturata Pils., F. amethystina L. and F. heterophylla Lam., which belong to section Aulaxyper. The aim of the study was to examine the isoenzyme variation and to evaluate the genetic affini- ties among the above-listed species of genus Festuca. Ten natural Bulgarian populations were examined. The isoforms of enzymes glu- tamate-oxaloacetate transaminase, malate dehydrogenase, glutamate dehydrogenase, iso- citrate dehydrogenase and 6-phosphogluconate dehydrogenase were resolved by polyacryl- amide gel electrophoresis. Based on mean allelic frequencies/locus/taxon, genetic identities (I) values for all pair-wise comparisons among the studied species were calculated. -

BIO2CARE WP3 Deliverable (Activity 3.1)
INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME GREECE – BULGARIA 2014 – 2020 Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability – BIO2CARE – (Reg. No: 1890) WP3 Deliverable 3.1 One (1) study collecting information and producing knowledge regarding anthropogenic activities and status of nature (incl. SWOT analysis) of the areas The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Deliverable 3.1 Project Acronym: BIO2CARE -1- INTERREG V-A CP Table of Contents Table of Contents .......................................................................................................................................... 2 Chapter 1: Introduction – Definition of study areas and their significance .................................................. 4 Chapter 2: Study Area 1- National Park of Eastern Macedonia and Thrace (GR) ....................................... 11 2.1 Status of Nature of Study Area 1 .......................................................................................................... 11 2.1.1 Geographical characteristics .............................................................................................................. 11 2.1.2 Flora .................................................................................................................................................. -

Cessation of Livestock Grazing and Windthrow Drive a Shift in Plant Species Composition in the Western Tatra Mts 177-196 Tuexenia 38: 177–196
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Tuexenia - Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft Jahr/Year: 2018 Band/Volume: NS_38 Autor(en)/Author(s): Czortek Patryk, Ratynska [RatyÅ„ska] Halina, Dyderski Marcin K., Jagodzinski [JagodziÅ„ski] Andrzej M., Orczewska Anna, Jaroszewicz Bogdan Artikel/Article: Cessation of livestock grazing and windthrow drive a shift in plant species composition in the Western Tatra Mts 177-196 Tuexenia 38: 177–196. Göttingen 2018. doi: 10.14471/2018.38.008, available online at www.zobodat.at Cessation of livestock grazing and windthrow drive a shift in plant species composition in the Western Tatra Mts Auflassung von Beweidung und Windwürfe führen zur Veränderung der Artenzusammensetzung der Vegetation in der westlichen Tatra Patryk Czortek1, *, Halina Ratyńska2, Marcin K. Dyderski3, 4, Andrzej M. Jagodziński3, 4, Anna Orczewska5 & Bogdan Jaroszewicz1 1Białowieża Geobotanical Station, Faculty of Biology, University of Warsaw, Sportowa 19, 17-230 Białowieża, Poland; 2Faculty of Natural Science, Kazimierz Wielki University, Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszcz, Poland; 3Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Parkowa 5, 62-035 Kórnik, Poland; 4Department of Game Management and Forest Protection, Faculty of Forestry, Poznań University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań, Poland; 5Department of Ecology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia, Bankowa 9, 40-007 Katowice, Poland *Corresponding author, e-mail: [email protected] Abstract Mountain vegetation is considered highly sensitive to changes in land use, especially grazing regime and forest management. The aim of this study was to assess shifts in plant species composition in the Western Tatra Mts over the past 92 years and to determine environmental drivers that have caused changes in species composition. -

Vegetacija Skalnih Razpok Silikatnega Skalovja
UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO Nina JUVAN VEGETACIJA SKALNIH RAZPOK SILIKATNEGA SKALOVJA DIPLOMSKO DELO Ljubljana, 2008 UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO Nina JUVAN VEGETACIJA SKALNIH RAZPOK SILIKATNEGA SKALOVJA DIPLOMSKO DELO univerzitetni študij VEGETATION OF SILICATE ROCKS WITH ROCK FISSURES GRADUATION THESIS University studies Ljubljana, 2008 II Juvan N. Vegetacija skalnih razpok silikatnega skalovja. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2008 Diplomsko delo je zaklju ček univerzitetnega študija biologije na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Opravljeno je bilo na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU. Komisija za študijske zadeve Oddelka za biologijo je za mentorja diplomskega dela imenovala doc. dr. Nejca Jogana, za somentorja pa doc. dr. Andraža Čarnija. Komisija za oceno in zagovor: Predsednica: doc. dr. Barbara Vilhar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Članica: prof. dr. Alenka Gaberš čik Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Član: doc. dr. Nejc Jogan Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo Član: doc. dr. Andraž Čarni ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija Datum zagovora: Pri čujo če diplomsko delo je rezultat lastnega raziskovalnega dela. Podpisana se strinjam z objavo svoje naloge v polnem tekstu na spletni strani Digitalne knjižnice Biotehniške fakultete. Izjavljam, da je naloga, ki sem jo oddala v elektronski obliki, identi čna tiskani verziji. Nina Juvan III Juvan N. Vegetacija skalnih razpok silikatnega skalovja. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2008 KLJU ČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA ŠD Dn DK 581.9i581.5(497.4)=163.6 KG vegetacija skalnih razpok silikatnega skalovja/Campanulo cochleariifoliae- Primuletum villosae ass. -

Changes in Snowbed Vegetation in the Western Carpathians Under Changing Climatic Conditions and Land Use in the Last Decades
Ekológia (Bratislava) Vol. 38, No. 4, p. 318–335, 2019 DOI:10.2478/eko-2019-0024 CHANGES IN SNOWBED VEGETATION IN THE WESTERN CARPATHIANS UNDER CHANGING CLIMATIC CONDITIONS AND LAND USE IN THE LAST DECADES ANDREJ PALAJ, JOZEF KOLLÁR Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences CPU in Nitra, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovak Republic; e-mail: [email protected] Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Štefánikova 3, P.O. Box 254, 814 99 Bratislava, Slovak Republic; e-mail: [email protected] Abstract Palaj A., Kollár J.: Changes in snowbed vegetation in the Western Carpathians under changing climatic conditions and land use in the last decades. Ekológia (Bratislava), Vol. 38, No. 4, p. 318–335, 2019. Snowbed vegetation is one of the most sensitive alpine vegetation type to the climate change, because shortened period of snow cover has essential impact on the snowbed environment. We focus on its changes in the Western Tatras, which is a part of the Western Carpathians (Slovakia). The assessment of changes in snowbed vegetation is based on the method of pair comparison. In 2016–2018, we resampled 21 historical phytocoenological relevés of Festucion picturatae and Sali- cion herbaceae alliances from 1974 and 1976. Historical data include 45 species, while recent data include 50 species. We observed a decrease in the frequency of species characteristic for snowbeds and, on the other hand, an increase in that for strong competitors, especially grasses and small shrubs from adjacent habitats. According to Ellenberg’s ecological indices, there is some increase in temperature and decrease in light ecological factors in snowbed habitats. -

Pros and Cons of Using a Standard Protocol to Test Germination of Alpine Species
Plant Ecol (2020) 221:1045–1067 https://doi.org/10.1007/s11258-020-01061-w (0123456789().,-volV)(0123456789().,-volV) Pros and cons of using a standard protocol to test germination of alpine species Vera Margreiter . Konrad Pagitz . Christian Berg . Patrick Schwager . Brigitta Erschbamer Received: 12 February 2020 / Accepted: 28 July 2020 / Published online: 3 August 2020 Ó The Author(s) 2020 Abstract Storing seeds in seed banks is an effective community, occurrence at elevation belts, bedrock way to preserve plant diversity and conserve species. types, as well as CSR strategies, and further, seed mass An essential step towards a valuable conservation is was examined. We could not find statistically signif- the validation of germination. This study presents a icant differences of FGP within these classes, but germination screening of seeds from 255 species of the 74.9% of all tested species germinated using the European Eastern Alps, which were to be stored at the standard protocol, and half of them had FGP Millennium Seed Bank (Kew, UK). The final germi- C 20.1–100%. A treatment with gibberellic acid nation percentage (FGP) was determined using a enhanced the germination in half of the species to standard protocol in the laboratory. Species were which this treatment was applied. Common families in classified according to species rarity, plant alpine regions, i.e. Asteraceae, Poaceae and Saxifra- gaceae were highlighted in terms of their germination behaviour. The results provide an evaluation of the Communicated by Thomas Abeli. application of standard protocols to a broad Alpine species pool on the one hand, and on the other hand, Electronic supplementary material The online version of provide ecological insights of the species tested. -

Nuclear DNA Amounts in Angiosperms: Targets, Trends and Tomorrow
Annals of Botany Page 1 of 124 doi:10.1093/aob/mcq258, available online at www.aob.oxfordjournals.org Nuclear DNA amounts in angiosperms: targets, trends and tomorrow M. D. Bennett* and I. J. Leitch Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB, UK * For correspondence. E-mail: [email protected] Received: 25 August 2010 Returned for revision: 18 October 2010 Accepted: 24 November 2010 CONTENTS INTRODUCTION 2 Extending the range of genome sizes encountered in angiosperms 3 The need for reference lists 4 TARGETS IN GENOME SIZE RESEARCH 4 Downloaded from Meeting targets for species representation 4 Progress towards targets for familial representation 5 Improved systematic representation for genera 6 Improved representation of other groups 6 TRENDS IN TECHNIQUES USED TO ESTIMATE GENOME SIZE 7 The rise in flow cytometry as the technique of choice for genome size estimations 7 http://aob.oxfordjournals.org/ Development of different isolation buffers for flow cytometry 7 The application of flow cytometry to plant systematics 8 Recent developments in the application of flow cytometry to genome size studies 8 (i) The use of seeds 8 (ii) Ease of access to methodological data 8 (iii) New equipment 8 Are there any new techniques for estimating genome size on the horizon? 9 (i) Can real time PCR be used for estimating plant genome sizes? 9 (ii) Will ‘complete’ genome sequencing give useable genome size estimates? 9 TOMORROW 13 at NIH Library on December 30, 2015 Uncovering and collating genome size data from diverse published sources 14 Screening ex situ and in situ collections as sources of target taxa 15 DEDICATION 15 LITERATURE CITED 16 APPENDIX 19 Notes to the Appendix 19 Original references for DNA values 121 † Background and Aims The amount of DNA in an unreplicated gametic chromosome complement is known as the C-value and is a key biodiversity character of fundamental significance with many practical and predictive uses. -

Syntaxonomy, Biodiversity, Protection and Management
Thaiszia - J. Bot., Košice, 23 (1): 67-112, 2013 http://www.bz.upjs.sk/thaiszia THAISZIAT H A I S Z I A JOURNAL OF BOTANY Mountain grasslands of high conservation value in the Eastern Carpathians: syntaxonomy, biodiversity, protection and management A paper in honour of 95 th birthday of Prof. Malynovski K. A. (1919–2005) – true pioneer in the study of grasslands of the Ukrainian Carpathians VLADIMIR V. KRICSFALUSY School of Environment and Sustainability, University of Saskatchewan, Room 330 Kirk Hall, 117 Science Place, Saskatoon SK, Canada S7N 5C8; [email protected] Kricsfalusy V.V. (2013): Mountain grasslands of high conservation value in the Eastern Carpathians: syntaxonomy, biodiversity, protection and management. – Thaiszia – J. Bot. 23 (1): 67–112. – ISSN 1210-0420. Abstract: Mountain grasslands in the Eastern Carpathians within Ukraine are of high scientific and nature conservation value as well as of cultural and historical importance. They are home to a rich biodiversity, including many rare, endemic and relic plant species and plant communities, as well as those that are found at the periphery of their ranges. This paper analyses data from mountain grasslands that contain significant concentrations of biodiversity in the region. We propose syntaxonomical revision of our previously-published classification of grassland communities, which contains some corrections and improvements. This study provides an assessment of 14 grassland communities, including their syntaxonomy, characterization, distribution, habitat, ecology, red-listed plants, dynamic trends, protection status, and conservation value. Phytogeographical analysis demonstrates that most plant associations have different levels of endemism, from local and regional to supra-regional. This paper describes the patterns of distribution and the environmental affinity of mountain grassland communities, as well as the distribution and abundance of red-listed plant species.