Fockea Edulis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CACTUS COURIER Newsletter of the Palomar Cactus and Succulent Society
BULLETIN NOVEMBER 2014 CACTUS COURIER Newsletter of the Palomar Cactus and Succulent Society Volume 60, Number 11 November 2014 The Meeting is the 4th Saturday NOVEMBER 22, 2014 Park Avenue Community Center 210 Park Ave Escondido, CA 92025 Noon!! Coffee!! Photo by Robert Pickett “Ethiopia – Plants, History, and Cultures” • • Gary James • • Gary James has been interested in succulent In recent years he has been traveling to succulent-rich plants for many years – both his grandmother and his parts of the world to observe plants in habitat. Seeing parents had large succulent gardens. Growing up in South them growing in their natural areas gives an observer a Pasadena allowed him to spend many days visiting the better idea of how to care for the plants in one’s Huntington Botanic Gardens – back when admission was collection. free! In 2000 he organized a tour of Ethiopia for a group of friends. They traveled all over the country and observed a number of wonderful plant habitats. Ethiopia is a fascinating country with a long history of having never been colonized by a European power. The country includes many interesting tribes in the Omo River Valley, intriguing monuments in the north, and unusual Christian churches in the Lalibela area. Theirs is a rich Moslem culture as well. The talk will be a general introduction to the variety of cultures, tribes, historic monuments, as well as a look at many of the unusual plants that are found throughout the country. vvvvvvvv Board Meeting • Plant Sales • Brag Plants • Exchange Table REFRESHMENTS Lorie Johansen Martha Hansen • • • YOUR NAME HERE! • • • Please think about bringing something to share – it makes the day more fun! And we have a reputation to uphold!! Plant of the Month • • Tylecodon • • Tylecodon is a genus of succulent plants in the family Crassulaceae. -

Plethora of Plants - Collections of the Botanical Garden, Faculty of Science, University of Zagreb (2): Glasshouse Succulents
NAT. CROAT. VOL. 27 No 2 407-420* ZAGREB December 31, 2018 professional paper/stručni članak – museum collections/muzejske zbirke DOI 10.20302/NC.2018.27.28 PLETHORA OF PLANTS - COLLECTIONS OF THE BOTANICAL GARDEN, FACULTY OF SCIENCE, UNIVERSITY OF ZAGREB (2): GLASSHOUSE SUCCULENTS Dubravka Sandev, Darko Mihelj & Sanja Kovačić Botanical Garden, Department of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb, Marulićev trg 9a, HR-10000 Zagreb, Croatia (e-mail: [email protected]) Sandev, D., Mihelj, D. & Kovačić, S.: Plethora of plants – collections of the Botanical Garden, Faculty of Science, University of Zagreb (2): Glasshouse succulents. Nat. Croat. Vol. 27, No. 2, 407- 420*, 2018, Zagreb. In this paper, the plant lists of glasshouse succulents grown in the Botanical Garden from 1895 to 2017 are studied. Synonymy, nomenclature and origin of plant material were sorted. The lists of species grown in the last 122 years are constructed in such a way as to show that throughout that period at least 1423 taxa of succulent plants from 254 genera and 17 families inhabited the Garden’s cold glass- house collection. Key words: Zagreb Botanical Garden, Faculty of Science, historic plant collections, succulent col- lection Sandev, D., Mihelj, D. & Kovačić, S.: Obilje bilja – zbirke Botaničkoga vrta Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2): Stakleničke mesnatice. Nat. Croat. Vol. 27, No. 2, 407-420*, 2018, Zagreb. U ovom članku sastavljeni su popisi stakleničkih mesnatica uzgajanih u Botaničkom vrtu zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta između 1895. i 2017. Uređena je sinonimka i no- menklatura te istraženo podrijetlo biljnog materijala. Rezultati pokazuju kako je tijekom 122 godine kroz zbirku mesnatica hladnog staklenika prošlo najmanje 1423 svojti iz 254 rodova i 17 porodica. -
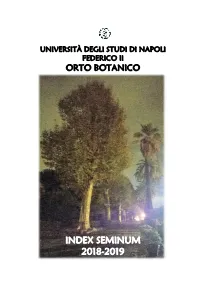
Index Seminum 2018-2019
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ORTO BOTANICO INDEX SEMINUM 2018-2019 In copertina / Cover “La Terrazza Carolina del Real Orto Botanico” Dedicata alla Regina Maria Carolina Bonaparte da Gioacchino Murat, Re di Napoli dal 1808 al 1815 (Photo S. Gaudino, 2018) 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ORTO BOTANICO INDEX SEMINUM 2018 - 2019 SPORAE ET SEMINA QUAE HORTUS BOTANICUS NEAPOLITANUS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT 3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ORTO BOTANICO ebgconsortiumindexseminum2018-2019 IPEN member ➢ CarpoSpermaTeca / Index-Seminum E- mail: [email protected] - Tel. +39/81/2533922 Via Foria, 223 - 80139 NAPOLI - ITALY http://www.ortobotanico.unina.it/OBN4/6_index/index.htm 4 Sommario / Contents Prefazione / Foreword 7 Dati geografici e climatici / Geographical and climatic data 9 Note / Notices 11 Mappa dell’Orto Botanico di Napoli / Botanical Garden map 13 Legenda dei codici e delle abbreviazioni / Key to signs and abbreviations 14 Index Seminum / Seed list: Felci / Ferns 15 Gimnosperme / Gymnosperms 18 Angiosperme / Angiosperms 21 Desiderata e condizioni di spedizione / Agreement and desiderata 55 Bibliografia e Ringraziamenti / Bibliography and Acknowledgements 57 5 INDEX SEMINUM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II ORTO BOTANICO Prof. PAOLO CAPUTO Horti Praefectus Dr. MANUELA DE MATTEIS TORTORA Seminum curator STEFANO GAUDINO Seminum collector 6 Prefazione / Foreword L'ORTO BOTANICO dell'Università ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere, -

Some Other Succulents Hanburg 24095
Chapter 5 (with corrections & edits: rev. 17 April 2004) This prepublication preview was excerpted from Sceletium sp. nova Sacred Cacti Third Edition (2005?) Copyright 2004 Mydriatic Productions Delosperma ecklonis Delosperma britteniae ? Trout’s Notes on Delosperma sp. Coegakop Some Other Succulents Hanburg 24095 featuring: Notes on the AIZOACEAE; with particular reference to the genus Delosperma by Trout & friends Monadenium lugardae Delosperma britteniae ? Coegakop A Bettter Days Publication Sacred Cacti 3rd Ed. (rev. 2004: rev. 17Apr04) Chapter 5 Table of Contents Trout’s Notes on Notes on the AIZOACEAE: 3 Some Other Succulents Descriptions of Delospermas mentioned in positive assays 7 Cultivation of the Delosperma species This is a prepublication release containing material excerpted from the forthcoming 10 Delosperma species in which we have Sacred Cacti. Botany, Chemistry, Cultivation & detected the tentative presence of Utilization (Including notes on some other DMT and/or 5-MeO-DMT succulents) 12 Third Edition. Revised & Illustrated Other members of the Aizoaceae To-Be-Published ca. 2005 14 Summary of other Aizoceous tlc alkaloid screening Copyright ©2004 & 2001 Mydriatic Productions; 14 ©1999 Better Days Publishing, Austin, Texas. Some Other Succulents Held to be Sa- ©1997, 1998 by Trout’s Notes cred, Medicinal or Useful Sacred Cacti was first published in 1997 by Narayan 15 Publications, Sedona, Arizona. Miscellaneous Notes on other members All rights reserved. of the Aizoaceae Produced by Mydriatic Productions; 18 a division of Better Days Publishing Miscellaneous Notes on some additional Photographs are by K.Trout unless indicated otherwise. Aizoceous Chemistry Photograph copyrights reside with the photographer(s) and 19 all images herein are used with their permission. -

Natural and Artificial Hybrids in Mesembryanthemaceae
356 S.-Afr.Tydskr. Plantk. , 1990, 56(3): 356-362 Natural and artificial hybrids in Mesembryanthemaceae S. Hammer* and Sigrid Liede Mesa Garden, P.O. Box 72, Belen, NM 87002, United States of America Accepted 5 March 1990 Aspects of natural and artificial hybridization in Mesembryanthemaceae are discussed. Morphological and experimental evidence is used to trace the parent species of some natural hybrids. Natural hybridization is interpreted in evolutionary terms. The possibility that garden hybrids might invade the cultivated gene pool, thus endangering the continuity of some threatened species, is pointed out. Aspekte van natuurlike en kunsmatige hibridisering in Mesembryanthemaceae word bespreek. Morfologiese en eksperimentele bewyse is gebruik om die oorspronklike ouer-spesies van 'n aantal natuurlike hibriede op te spoor. Natuurlike hibridesering word in terme van evolusie ge·fnterpreteer. Die gevaar vir die voortbestaan van bedreigde spesies deur die indringing van tuinhibriede by 'n gekweekte genebank, is bespreek. Keywords: Hybridization, Mesembryanthemaceae *To whom correspondence should be addressed Introduction indicated in parentheses, with the date and location (MG Only a few instances of natural or artificial hybridization = Mesa Garden, KG = Karoo Garden). have been recorded in the Mesembryanthemaceae. Despite the intense field research into the family during Natural intergeneric hybrids the last century, very few natural hybrids have hitherto The best-known instance of natural hybridization in been investigated. Similarly, few artificial hybrids have Mesembryanthemaceae occurs between Gibbaeum been recorded though the family has been widely culti album N.E. Br. and Muiria hortenseae N.E . Br. The vated in European greenhouses for the last two natural hybrid, Muirio-Gibbaeum muirioides Rowley centuries. -

Spring 2018 Plant List – 05/27/18 Miles' to Go - P.O
SPRING 2018 PLANT LIST – 05/27/18 MILES' TO GO - P.O. BOX 6 - CORTARO, AZ 85652 - 520-682-7272 - FAX 520-682-0480 EMAIL [email protected] - WEB SITE www.miles2go.com INFORMATION POLICY: We do not share or sell our mailing or emailing information with anyone. ORDERING INFORMATION Shipping Charges: Please use chart below to calculate shipping charges for your order. For orders under $25 - add $15.00 for shipping by Priority Mail For orders from $25 to $49.99 - add $10.00 for shipping by Priority Mail For orders $50 and over - free shipping by Priority Mail Express Mail will be billed for the exact amount, contact us if you are paying by check or money order. Catalog Number: Please include the catalog number which appears with each plant entry in order to speed up the processing of your order. Email Orders: At the current time we do not have a secured server and do not recommend emailing credit card numbers. If we have your credit card number on file, email us your order and include just the last 4 digits and exp. date of your credit card as verification. You may email your order and we will hold it for you until we receive payment information (via phone, fax or mail) . Fax Orders: You may fax your order to 520-682-0480 at any time. Foreign Orders: We cannot ship outside the United States and her territories. Minimum order: We have no minimum order but there is a shipping charge for some orders (See Shipping Charges.) Payment: We accept checks, money orders, Discover, Mastercard, Visa, and American Express. -

A Taxonomic Study Of.Succulents, Exclusive of Cacti, Occuring Native Or Cultivated
A taxonomic study of succulents, exclusive of cacti, occuring native or cultivated in southwestern gardens Item Type text; Thesis-Reproduction (electronic) Authors Murray, Mary Aileen, 1914- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 06/10/2021 09:16:00 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/551794 A TAXONOMIC STUDY OF.SUCCULENTS, EXCLUSIVE OF CACTI, OCCURING NATIVE OR CULTIVATED ' IN SOUTHWESTERN GARDENS : - b y t , r . - - Mary .Aileen Murray A Thesis submitted to the faculty of the Department .of .Botany in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master-of Science-- in the Graduate College University of Arizona 1938. Approved: Major Professor ! ?" Date. ' - .L l i t k A K ' i <£?979/ / 9 3 d’ Y/l Contents. Introduction........... .1. Family studies. Commelinaceae.................................... 3. Liliaceae........... ... ........... .7. Amayllidaceae................................•..29. Al’zoaceae.................37. Portulacaceae...................................50. Crassulaceae................................. .53. Euphorbiaceae ....... ...78. Asclepidaceae................88. Fouquieriaceae.................................94. Compositae........ ...........................95. Summary..................................... -
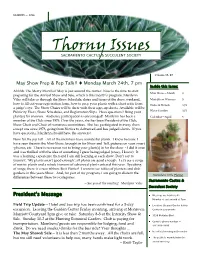
Thorny Issues DATES & DETAILS —
MARCH — 2014 ThornySACRAMENTO CACTUS & SUCCULENT Issues SOCIETY Volume 55, #3 May Show Prep & Pep Talk!! Monday March 24th, 7 pm Inside this issue: Ahhhh. The Merry Month of May is just around the corner. Now is the time to start Mini Show—March 2 preparing for the Annual Show and Sale, which is this month’s program. Marilynn Vilas will take us through the Show Schedule, dates and times of the show weekend, Mini-Show Winners 5 how to fill out your registration form, how to prep your plants with a short critic from Dates & Details 3/5 a judge’s eye. The Show Chairs will be there with their sign-up sheets. Available will be Publicity Fliers, Show Schedules, and Registration Slips. Have questions? Bring your Wave Garden 3/5 plant(s) for answers. Audience participation is encouraged! Marilynn has been a Calendar—April 6 member of the Club since 1978. Over the years, she has been President of the Club, Show Chair and Chair of numerous committees. She has participated in every show except one since 1978, going from Novice to Advanced and has judged shows. If you have questions, Marilynn should have the answers! Now for the pep talk—All of the members have wonderful plants. I know because I have seen them in the Mini-Show, brought in for Show and Tell, pictures on your smart -phones, etc. There is no reason not to bring your plant(s) in for the show – I did it once and was thrilled with the idea of something I grew being judged (crazy, I know). -

Summer 2018 Plant List – 08/20/18 Miles' to Go - P.O
SUMMER 2018 PLANT LIST – 08/20/18 MILES' TO GO - P.O. BOX 6 - CORTARO, AZ 85652 - 520-682-7272 - FAX 520-682-0480 EMAIL [email protected] - WEB SITE www.miles2go.com INFORMATION POLICY: We do not share or sell our mailing or emailing information with anyone. ORDERING INFORMATION Shipping Charges: Please use chart below to calculate shipping charges for your order. For orders under $25 - add $15.00 for shipping by Priority Mail For orders from $25 to $49.99 - add $10.00 for shipping by Priority Mail For orders $50 and over - free shipping by Priority Mail Express Mail will be billed for the exact amount, contact us if you are paying by check or money order. Catalog Number: Please include the catalog number which appears with each plant entry in order to speed up the processing of your order. Email Orders: At the current time we do not have a secured server and do not recommend emailing credit card numbers. If we have your credit card number on file, email us your order and include just the last 4 digits and exp. date of your credit card as verification. You may email your order and we will hold it for you until we receive payment information (via phone, fax or mail) . Fax Orders: You may fax your order to 520-682-0480 at any time. Foreign Orders: We cannot ship outside the United States and her territories. Minimum order: We have no minimum order but there is a shipping charge for some orders (See Shipping Charges.) Payment: We accept checks, money orders, Discover, Mastercard, Visa, and American Express. -

Greg Daniels Mesemb Plant List March 2015 [email protected] 07 3376 3404
Greg Daniels Mesemb Plant List March 2015 [email protected] 07 3376 3404 Genus/species Collector No Locality Price No. available Acrodon bellidiflorus Rooivlei 5 3 Aloinopsis loganii Matjiesfontein, N 6 1 Aloinopsis schooneesii 5 1 Antimima argentea Namus Kloof 5 1 Antimima limbata Langebaan 5 5 Antimima solida SB1515 Grootgraafwater 5 19 Antimima sp. Brandkop 5 1 Antimima sp. SB1942 Quaggaskop 5 4 Antimima turneriana 5 2 Argyroderma congregatum HH5032 Vredendal, near 5 4 Argyroderma congregatum SB614 Vredendal, near 5 9 Argyroderma delaetii PV255 Nuwerus, 40 km W of 5 3 Argyroderma delaetii 'aureum' Langdam, Bitterfontein 5 13 Argyroderma fissum Klawer 5 3 Argyroderma fissum Klawer, 3 km S of 5 3 Argyroderma fissum 'brevipes' Vredendal 5 3 Argyroderma fissum 'litorale' SB1542 Strandfontein, E of 5 11 Argyroderma framesii ssp. hallii 'cerise fl' Holrivier TL 5 14 Argyroderma patens Kliprand Road 5 1 Argyroderma patens 'lemon to amber fl' Soutrivier Bridge, 8 miles NE of 5 2 Argyroderma pearsonii var. luckhoffii ‘yellow fl' 5 2 Argyroderma pearsonii 'purple fl' 5 6 Argyroderma testiculare 5 2 Astridia longifolia 'bright red fl' SB758 Remhoogte 5 1 Astridia sp. 5 34 Astridia velutina RJC163/97 Hellskloof Gate and Sendlingsdrift, between 5 2 Bergeranthus concavus 6 3 Bergeranthus multiceps 'addoensis' Sondagsrivierpoort 5 3 Bergeranthus multiceps 'artus' 5 10 Bergeranthus scapiger 5 3 Braunsia apiculata Klein Cederberg 5 9 Cephalophyllum alstonii Ceres Karoo 5 22 Cephalophyllum curtophyllum 5 4 Cephalophyllum ebracteatum Lüderitz 5 5 Cephalophyllum loreum SB619 Gifberg 5 4 Cephalophyllum pillansii 5 1 Cephalophyllum pulchrum 5 10 Cephalophyllum rigidum 'aureorubrum' #same? 5 2 Cephalophyllum sp. -
December 2019
CACTUS COURIER Newsletter of the Palomar Cactus and Succulent Society The North San Diego County Cactus and Succulent Society Volume 65, Number 12 December 2019 NEXT MEETING HOLIDAY PARTY! Gift Plants for You! Saturday, December 21st Park Ave. Community Center 210 Park Ave., Escondido NO Brag plants, Exchange Table or Benefit Drawing 11:00am – 3:00pm In This Issue Holiday Party Information p. 1-2 Notices p. 2 Party Potluck List of Dishes p. 3 Show Winners’ Photo p. 4 2019 Brag Point Totals Lists p. 4 November Brag Plant Winners p. 5 Garden Brag Photos p. 6 Coffee in the Garden 1/19/20 p. 7 October Show Winners’ List p. 8-12 San Diego CSS Show/Sale Flyer p. 13 HOLIDAY PARTY INFO! Misc. Club Info, and Misc. Photos p. 13 WANT A GUARANTEED SEAT & GIFT PLANT? PLEASE SIGN UP! Party Food List – p. 3 Ø To make sure a seat is waiting for you, please sign-up by contacting Julie Slater at [email protected] if you haven’t already signed up. www.palomarcactus.org Ø Also contact Julie to bring a dish to the potluck. We’re on Facebook! We’re on Instagram as Ø Come socialize and enjoy some appetizers from 11-12 Palomar.cactus.succulent.org Lunch will start being served at approximately noon. Questions - email: [email protected] IF YOU DON’T SIGN UP, WE CANNOT GUARANTEE YOU A MEMBER GIFT PLANT! IT’S TIME TO RENEW YOUR MEMBERSHIP! à As mentioned last month, we are now accepting Membership renewals. You may pay with cash, check or a credit card. -
Red Listed Medicinal Plants of South Africa: Status, Trends, and Assessment Challenges
South African Journal of Botany 86 (2013) 23–35 Contents lists available at SciVerse ScienceDirect South African Journal of Botany journal homepage: www.elsevier.com/locate/sajb Red Listed medicinal plants of South Africa: Status, trends, and assessment challenges V.L. Williams a,⁎, J.E. Victor b, N.R. Crouch c,d a School of Animal Plant and Environmental Sciences, University of the Witwatersrand, Private Bag 3, Wits 2050, South Africa b National Herbarium, SANBI, Private Bag X101, Pretoria 0001, South Africa c Ethnobotany Unit, SANBI, PO Box 52099, Berea Road, 4007, South Africa d School of Chemistry and Physics, University of KwaZulu-Natal, 4041 Durban, South Africa article info abstract Article history: In 2009, South Africa completed the IUCN Red List assessments of 20,456 indigenous vascular plant taxa. During Received 8 March 2012 that process, medicinal plant species (especially those sold in informal muthi markets) were identified so that Received in revised form 22 September 2012 potential extinction risks posed to these species could be assessed. The present study examines and analyses Accepted 24 January 2013 the recently documented threat statuses of South African ethnomedicinal taxa, including the number of species Available online 28 February 2013 used, revealing family richness and the degree of endemism, and calculates the Red List Index (RLI) of species Edited by B-E Van Wyk survival to measure the relative degree of threat to medicinal species. Approximately 2062 indigenous plant spe- cies (10% of the total flora) have been recorded as being used for traditional medicine in South Africa, of which it Keywords: has been determined that 82 species (0.4% of the total national flora) are threatened with extinction at a national Extinction level in the short and medium terms and a further 100 species are of conservation concern (including two species GSPC already extinct in the wild).