Jahresbericht 2011
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Histidine Biosynthetic Genes in the Superphylum Bacteroidota-Rhodothermota-Balneolota-Chlorobiota: Insights Into the Evolution of Gene Structure and Organization
microorganisms Article The Histidine Biosynthetic Genes in the Superphylum Bacteroidota-Rhodothermota-Balneolota-Chlorobiota: Insights into the Evolution of Gene Structure and Organization Sara Del Duca , Christopher Riccardi , Alberto Vassallo , Giulia Fontana, Lara Mitia Castronovo, Sofia Chioccioli and Renato Fani * Department of Biology, University of Florence, Via Madonna del Piano 6, Sesto Fiorentino, 50019 Florence, Italy; sara.delduca@unifi.it (S.D.D.); christopher.riccardi@unifi.it (C.R.); alberto.vassallo@unifi.it (A.V.); [email protected]fi.it (G.F.); [email protected] (L.M.C.); sofia.chioccioli@unifi.it (S.C.) * Correspondence: renato.fani@unifi.it; Tel.: +39-055-4574742 Abstract: One of the most studied metabolic routes is the biosynthesis of histidine, especially in enterobacteria where a single compact operon composed of eight adjacent genes encodes the complete set of biosynthetic enzymes. It is still not clear how his genes were organized in the genome of the last universal common ancestor community. The aim of this work was to analyze the structure, organization, phylogenetic distribution, and degree of horizontal gene transfer (HGT) of his genes in the Bacteroidota-Rhodothermota-Balneolota-Chlorobiota superphylum, a group of phylogenetically close bacteria with different surviving strategies. The analysis of the large variety of his gene structures and organizations revealed different scenarios with genes organized in more Citation: Del Duca, S.; Riccardi, C.; or less compact—heterogeneous or homogeneous—operons, in suboperons, or in regulons. The Vassallo, A.; Fontana, G.; Castronovo, organization of his genes in the extant members of the superphylum suggests that in the common L.M.; Chioccioli, S.; Fani, R. -

Open Leamy Phd Thesis Final.Pdf
The Pennsylvania State University The Graduate School Department of Chemistry INVESTIGATING RNA FOLDING AND ADAPTATION IN CELLULAR CONDITIONS A Dissertation in Chemistry by Kathleen A. Leamy © 2018 Kathleen Leamy Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy August 2018 The dissertation of Kathleen A. Leamy was reviewed and approved* by the following: Philip C. Bevilacqua Distinguished Professor of Chemistry and Biochemistry and Molecular Biology Dissertation Advisor Chair of Committee Joseph A. Cotruvo Assistant Professor of Chemistry Louis Martarano Career Development Professor Frank L. Dorman Associate Professor Biochemistry and Molecular Biology Xin Zhang Assistant Professor of Chemistry Assistant Professor of Biochemistry and Molecular Biology Paul Berg Early Career Professorship in the Eberly College of Science Thomas E. Mallouk Head of the Chemistry Department Evan Pugh Professor of Chemistry, Biochemistry and Molecular Biology, Physics, and Engineering Science and Mechanics *Signatures are on file in the Graduate School ii Abstract RNA is an essential biomolecule that controls many processes in cells by folding into complex three-dimensional structures. Regulation can happen at the transcriptional or translational levels by RNA self-cleavage, ligand binding, or unfolding, to name a few. The folding and structures of these so called ‘functional RNAs’ that adopt tertiary structures has been studied for several decades. These studies have revealed that functional RNAs fold in a hierarchical manner where secondary structures form before tertiary structure, RNA folds over broad energetic landscapes, and RNAs become trapped in stable misfolded, non-functional structures that can last for hours. The majority of these studies have been performed on just a few RNA sequences and in classic solution conditions of 1 M Na+. -

Downloaded (July 2018) and Aligned Using Msaprobs V0.9.7 (16)
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/524215; this version posted January 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. Positively twisted: The complex evolutionary history of Reverse Gyrase suggests a non- hyperthermophilic Last Universal Common Ancestor Ryan Catchpole1,2 and Patrick Forterre1,2 1Institut Pasteur, Unité de Biologie Moléculaire du Gène chez les Extrêmophiles (BMGE), Département de Microbiologie F-75015 Paris, France 2Institute for Integrative Biology of the Cell (I2BC), CEA, CNRS, Univ. Paris-Sud, Univ. Paris-Saclay, 91198, Gif-sur-Yvette Cedex, France 1 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/524215; this version posted January 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license. Abstract Reverse gyrase (RG) is the only protein found ubiquitously in hyperthermophilic organisms, but absent from mesophiles. As such, its simple presence or absence allows us to deduce information about the optimal growth temperature of long-extinct organisms, even as far as the last universal common ancestor of extant life (LUCA). The growth environment and gene content of the LUCA has long been a source of debate in which RG often features. In an attempt to settle this debate, we carried out an exhaustive search for RG proteins, generating the largest RG dataset to date. -

Análisis Evolutivo De La Interacción Proteína-ADN
Tesis Doctoral Análisis evolutivo de la interacción proteína-ADN Aptekmann, Ariel Alejandro 2018-03-23 Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente. This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding citation acknowledging the source. Cita tipo APA: Aptekmann, Ariel Alejandro. (2018-03-23). Análisis evolutivo de la interacción proteína-ADN. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Cita tipo Chicago: Aptekmann, Ariel Alejandro. "Análisis evolutivo de la interacción proteína-ADN". Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2018-03-23. Dirección: Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Contacto: [email protected] Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293 Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Qu´ımica Biologica´ An´alisis evolutivo de la interacci´on prote´ına-ADN Tesis presentada para optar al t´ıtulode Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el ´areaQu´ımica Biol´ogica Lic. Ariel Alejandro Aptekmann Director: Dr. Alejandro Daniel Nadra Consejero de estudios: Dr. Adri´anTurjanski Lugar de trabajo: IQUIBICEN-UBA-CONICET Buenos Aires, 2017 An´alisis evolutivo de la interacci´on prote´ına-ADN En la entidad funcional \interfaz prote´ına-ADN”,prote´ınay ADN se condicionan mutuamente en un proceso coevolutivo. -

Correlating Enzyme Annotations with a Large Set of Microbial Growth Temperatures Reveals Metabolic Adaptations to Growth at Diverse Temperatures
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/271569; this version posted February 25, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY 4.0 International license. Correlating enzyme annotations with a large set of microbial growth temperatures reveals metabolic adaptations to growth at diverse temperatures Authors/Affiliations Martin KM Engqvist1 1) Department of Biology and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Gothenburg, Sweden. Corresponding author Martin KM Engqvist, [email protected] Abstract Interpreting genomic data to identify temperature adaptations is challenging due to limited accessibility of growth temperature data. In this work I mine public culture collection websites to obtain growth temperature data for 21,498 organisms. Leveraging this unique dataset I identify 319 enzyme activities that either increase or decrease in abundance with temperature. This is a striking result showing that up to 9% of enzyme activities may represent metabolic changes important for adapting to growth at differing temperatures in microbes. Eight metabolic pathways were statistically enriched for these enzyme activities, further highlighting specific areas of metabolism that may be particularly important for such adaptations. Furthermore, I establish a correlation between 33 domains of unknown function (DUFs) with growth temperature in microbes, four of which (DUF438, DUF1524, DUF1957 and DUF3458_C) were significant in both archaea and bacteria. These DUFs may represent novel, as yet undiscovered, functions relating to temperature adaptation. bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/271569; this version posted February 25, 2018. -
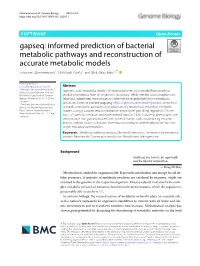
Download from Uniprot, EC Numbers and Database Cross-References Are Prioritised Over Enzyme Names Because the Matching Is Often Ambiguous
Zimmermann et al. Genome Biology (2021) 22:81 https://doi.org/10.1186/s13059-021-02295-1 SOFTWARE Open Access gapseq: informed prediction of bacterial metabolic pathways and reconstruction of accurate metabolic models Johannes Zimmermann1, Christoph Kaleta1 and Silvio Waschina1,2* *Correspondence: [email protected] Abstract 1 Christian-Albrechts-University Kiel, Genome-scale metabolic models of microorganisms are powerful frameworks to Institute of Experimental Medicine, Research Group Medical Systems predict phenotypes from an organism’s genotype. While manual reconstructions are Biology, Michaelis-Str. 5, 24105 Kiel, laborious, automated reconstructions often fail to recapitulate known metabolic Germany processes. Here we present gapseq (https://github.com/jotech/gapseq), a new tool 2Christian-Albrechts-University Kiel, Institute of Human Nutrition and to predict metabolic pathways and automatically reconstruct microbial metabolic Food Science, Nutriinformatics, models using a curated reaction database and a novel gap-filling algorithm. On the Heinrich-Hecht-Platz 10, 24118 Kiel, basis of scientific literature and experimental data for 14,931 bacterial phenotypes, we Germany demonstrate that gapseq outperforms state-of-the-art tools in predicting enzyme activity, carbon source utilisation, fermentation products, and metabolic interactions within microbial communities. Keywords: Metabolic pathway analysis, Metabolic networks, Genome-scale metabolic models, Benchmark, Community simulation, Microbiome, Metagenome Background Anything you have to do repeatedly may be ripe for automation. — Doug McIlroy Metabolism is central for organismal life. It provides metabolites and energy for all cel- lular processes. A majority of metabolic reactions are catalysed by enzymes, which are encoded in the genome of the respective organism. Those catalysed reactions form a com- plex metabolic network of numerous biochemical transformations, which the organism is presumably able to perform [1]. -

Consensus Sequence Design As a General Strategy to Create Hyperstable, Biologically Active Proteins
Consensus sequence design as a general strategy to create hyperstable, biologically active proteins Matt Sternkea, Katherine W. Trippa, and Doug Barricka,1 aThe T.C. Jenkins Department of Biophysics, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218 Edited by Brian W. Matthews, University of Oregon, Eugene, OR, and approved April 26, 2019 (received for review October 6, 2018) Consensus sequence design offers a promising strategy for de- tion in its biological context and ultimately contribute to or- signing proteins of high stability while retaining biological activity ganismal fitness.* By averaging over many sequences that share since it draws upon an evolutionary history in which residues similar structure and function, the consensus design approach important for both stability and function are likely to be con- has the potential to produce proteins with high levels of ther- served. Although there have been several reports of successful modynamic stability and biological activity, since both attributes consensus design of individual targets, it is unclear from these are likely to lead to residue conservation. anecdotal studies how often this approach succeeds and how There are two experimental approaches that have been used often it fails. Here, we attempt to assess generality by designing to examine the effectiveness of consensus information in protein “ ” consensus sequences for a set of six protein families with a range design: point-substitution and wholesale substitution. In the of chain lengths, structures, and activities. We characterize the first approach, single residues in a well-behaved protein that resulting consensus proteins for stability, structure, and biological differ from the consensus are substituted with the consensus – activities in an unbiased way. -

Current Status and Potential Applications of Underexplored Prokaryotes
microorganisms Review Current Status and Potential Applications of Underexplored Prokaryotes 1, , 1 2,3 1 Kian Mau Goh * y , Saleha Shahar , Kok-Gan Chan , Chun Shiong Chong , Syazwani Itri Amran 1, Mohd Helmi Sani 1,Iffah Izzati Zakaria 4 and 4, , Ummirul Mukminin Kahar * y 1 Faculty of Science, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai 81310, Johor, Malaysia; [email protected] (S.S.); [email protected] (C.S.C.); [email protected] (S.I.A.); [email protected] (M.H.S.) 2 Division of Genetics and Molecular Biology, Institute of Biological Science, Faculty of Science, University of Malaya, Kuala Lumpur 50603, Malaysia; [email protected] 3 International Genome Centre, Jiangsu University, ZhenJiang 212013, China 4 Malaysia Genome Institute, National Institutes of Biotechnology Malaysia, Jalan Bangi, Kajang 43000, Selangor, Malaysia; iff[email protected] * Correspondence: [email protected] (K.M.G.); [email protected] (U.M.K.) These authors contributed equally to this work. y Received: 13 August 2019; Accepted: 8 October 2019; Published: 18 October 2019 Abstract: Thousands of prokaryotic genera have been published, but methodological bias in the study of prokaryotes is noted. Prokaryotes that are relatively easy to isolate have been well-studied from multiple aspects. Massive quantities of experimental findings and knowledge generated from the well-known prokaryotic strains are inundating scientific publications. However, researchers may neglect or pay little attention to the uncommon prokaryotes and hard-to-cultivate microorganisms. In this review, we provide a systematic update on the discovery of underexplored culturable and unculturable prokaryotes and discuss the insights accumulated from various research efforts. Examining these neglected prokaryotes may elucidate their novelties and functions and pave the way for their industrial applications.