Europarecht Europarecht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Saisie-Contrefaçon
Sabine Agé ÖV-Expertengespräch IP-Rechtsdurchsetzung in Europa Vienna ● 16 January 2017 Bringing evidence of infringement in France after the Enforcement directive: the saisie- contrefaçon and other available tools ÖV-Expertengespräch “IP-Rechtsdurchsetzung in Europa: Gut, besser … und morgen?” Vienna ● 16 January 2017 Sabine AGÉ Avocat Paris Lyon Evidence gathering in France after the IP Enforcement Dir. Overview Provisions of the IP Enforcement Directive (IPED) and of the French Intellectual Property Code (IPC) Overview of the means of evidence used in France Saisie-contrefaçon Protection of confidential information Use of the information gathered during the saisie- contrefaçon Right of information and rendering of accounts 2 Bringing evidence of infringement in France after the Enforcement directive: the saisie-contrefaçon and other available tools 1 Sabine Agé ÖV-Expertengespräch IP-Rechtsdurchsetzung in Europa Vienna ● 16 January 2017 Evidence gathering in France after the IP Enforcement Dir. IPED: a minimum Art. 2 : Scope “Without prejudice to the means which are or may be provided for in Community or national legislation, in so far as those means may be more favourable for rightholders, the measures, procedures and remedies provided for by this Directive shall apply, in accordance with Article 3, to any infringement of intellectual property rights as provided for by Community law and/or by the national law of the Member State concerned.” 3 Evidence gathering in France after the IP Enforcement Dir. IPED: fairness and proportionality Art. 3 : General obligation “1. Member States shall provide for the measures, procedures and remedies necessary to ensure the enforcement of the intellectual property rights covered by this Directive. -
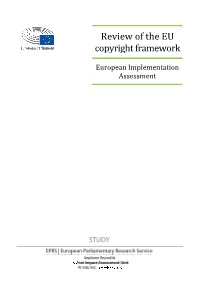
Review of the EU Copyright Framework
Review of the EU copyright framework European Implementation Assessment Review of the EU copyright framework: The implementation, application and effects of the "InfoSoc" Directive (2001/29/EC) and of its related instruments European Implementation Assessment Study In October 2014, the Committee on Legal Affairs (JURI) requested from the European Parliament Research Service (EPRS) an Ex Post Impact Assessment on Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (InfoSoc). This EPRS publication was originally commissioned in the context of JURI's own- initiative implementation report, which was adopted in Plenary in July 2015, Rapporteur Julia Reda MEP. However, it is also relevant to the work of JURI Committees' Working Group on Intellectual Property Rights and Copyright (CWG), chaired by Jean Marie Cavada MEP. Furthermore, this request was made in the wider context of the Commission's review of the EU legislative framework on copyright, and the ensuing legislative proposals, which have been a long time in the planning and which are now expected for the 4th quarter of 2015. The objective of these proposals is to modernise the EU copyright framework, and in particular the InfoSoc Directive, in light of the digital transformation. Accordingly, in response to the JURI request, the Ex-Post Impact Assessment Unit of the European Parliament Research Service decided to produce a "European Implementation Assessment on the review of the EU copyright framework". Implementation reports of EP committees are now routinely accompanied by European Implementation Assessments, drawn up by the Ex-Post Impact Assessment Unit of the Directorate for Impact Assessment and European Added Value, within the European Parliament's Directorate-General for Parliamentary Research Services. -
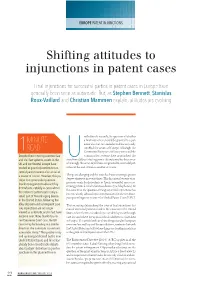
Shifting Attitudes to Injunctions in Patent Cases
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| EUROPE PATENT INJUNCTIONS ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Shifting attitudes to injunctions in patent cases Final injunctions for successful parties in patent cases in Europe have generally been seen as automatic. But, as Stephen Bennett , Stanislas Roux-Vaillard and Christian Mammen explain, attitudes are evolving ntil relatively recently, the question of whether a final injunction should be granted to a pat - MINUTE entee who has succeeded at trial has not really READ troubled the courts of Europe. Although the 1 Continental European civil law systems and the Despite their differing common law common law systems have approached the and civil law systems, courts in the Uissue from different starting points, the outcome has been over - UK and continental Europe have whelmingly the same: injunctions are granted to successful pat - tended to grant injunctions to suc - entees at the end of trial as a matter of course. cessful patent owners after a trial as Things are changing and the issue has been receiving a greater a matter of course. However, this po - degree of interest in recent times. This has arisen because of ar - sition has come under pressure guments made by defendants in (predominantly) cases con - thanks to arguments advanced by cerning patents for multi-function devices (mobile -

The Risks of Patent Litigation Within the EU Enforcement Framework – How to Address Abusive Practices
CRIDES Working Paper Series no. 2/2020 The Risks of Patent Litigation Within the EU Enforcement Framework – How to Address Abusive Practices by Alain Strowel and Amandine Léonard February 2020 Cite as: Alain Strowel and Amandine Léonard, The Risks of Patent Litigation Within the EU Enforcement Framework – How to Address Abusive Practices, CRIDES Working Paper Series no.2/2020 The CRIDES, Centre de recherche interdisciplinaire Droit Entreprise et Société, aims at investigating, on the one hand, the role of law in the enterprise and, on the other hand, the function of the enterprise within society. The centre, based at the Faculty of Law – UCLouvain, is formed by four research groups: the research group in economic law, the research group in intellectual property law, the research group in social law (Atelier SociAL), and the research group in tax law. www.uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/crides This paper © Alain Strowel and Amandine Léonard 2020 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ THE RISKS OF PATENT LITIGATION WITHIN THE EU ENFORCEMENT FRAMEWORK HOW TO ADDRESS ABUSIVE PRACTICES Alain Strowel and Amandine Léonard The Risks of Patent Litigation Within the EU Enforcement Framework The Risks of Patent Litigation Within the EU Enforcement Framework – How to Address Abusive Practices By Alain Strowel and Amandine Léonard* Keywords: Patent litigation, Flexibility and Injunctive Relief, Proportionality, Abuse of Rights, Patent Assertion Entities, Patent Trolls, Article 3(2) Enforcement Directive, Directive (EU) 2004/48 Abstract The debate over the degree of flexibility at the disposal of national courts in Europe to grant, deny, or tailor, injunctive relief in patent litigation seems to be a never-ending story. -
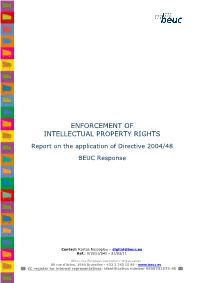
Enforcement of Intellectual Property Rights
ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Report on the application of Directive 2004/48 BEUC Response Contact: Kostas Rossoglou – [email protected] Ref.: X/2011/041 - 31/03/11 BEUC, the European Consumers’ Organisation 80 rue d’Arlon, 1040 Bruxelles - +32 2 743 15 90 - www.beuc.eu EC register for interest representatives: identification number 9505781573-45 Summary The European Consumers’ Organisation (BEUC) welcomes the opportunity to submit its views on the implementation of the IPR Enforcement Directive 2004/48 and its ongoing review. BEUC is concerned with the approach followed by the European Commission (DG Markt) vis-à-vis Intellectual Property Rights and the proposals outlined in the report regarding the need to revise the current rules. BEUC is strongly opposed to a possible revision that would aim at eroding consumers’ fundamental rights and at establishing disproportionate enforcement mechanisms for a number of reasons. In particular: • The Directive has been implemented by Member States only recently and therefore the feedback on its effectiveness remains limited; • The European Commission has yet to carry out the assessment of the impact of the Directive on innovation and the development of the information society, as required by Article 18 of the Directive 2004/48; • The decision to revise the Directive has been based on the feedback received by right holders’ representatives within the framework of a stakeholder dialogue established by DG Markt without the participation of civil society, academics and data protection authorities; -

En En National Parliament Reasoned Opinion On
European Parliament 2014-2019 Committee on Legal Affairs 19.5.2016 NATIONAL PARLIAMENT REASONED OPINION ON SUBSIDIARITY Subject: Reasoned opinion of the Estonian Parliament on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Under Article 6 of the Protocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality, national parliaments may, within eight weeks of the date of transmission of a draft legislative act, send the Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission a reasoned opinion stating why they consider that the draft in question does not comply with the principle of subsidiarity. The Estonian Parliament has sent the attached reasoned opinion on the aforementioned proposal for a directive. Under Parliament’s Rules of Procedure the Committee on Legal Affairs is responsible for compliance with the subsidiarity principle. NP\1095285EN.doc PE582.429v01-00 EN United in diversity EN ANNEX Decision of the Estonian Parliament Reasoned opinion for the presidents of the European Parliament, the European Commission, and the Council of the European Union on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers -

Directive 96/9/Ec
DIRECTIVE 96/9/EC (Database Directive) of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases [Introductory remarks] 1. General. The Database Directive has created a two-tier protection regime for electronic and non-electronic databases. Member States are to pro- tect databases by copyright as intellectual creations (Chapter 2), and provide for a sui generis right (database right) to protect the contents of a database in which the producer has substantially invested (Chapter 3). Both rights may apply cumulatively if the prerequisites for both regimes are fulfilled. The introduction of sui generis protection was considered necessary after supreme courts in the Netherlands and the US had held that copyright does not protect databases reflecting merely economic investment or intellectual effort (see Feist (US) and Van Dale (Netherlands)). Prior to implementation, intellectual property protection for non-original compilations existed in just a few Member States (the United Kingdom, Denmark, Sweden and the Nether- lands). Many Member States provided only for unfair competition remedies, to be applied in special circumstances, or no remedies at all. However, the absence of a harmonized legal framework for unfair competition in Europe necessitated the introduction of a sui generis right to complement copyright protection for databases (recital 6). 2. Harmonization. The Directive is based on arts. 47(2), 55 and 95 of the EC Treaty, and is aimed at harmonizing the legal protection of databases across the European Community. The copyright chapter of the Directive harmonizes the originality standard for databases, which prior to the implementation dif- fered greatly between Member States, especially between countries of the authors’ right tradition where a measure of creativity, personal character or personal imprint was required, and the two Member States (Ireland and the UK) of the British copyright tradition where mere skill and labour sufficed. -

The E-Commerce Directive As the Cornerstone of the Internal Market
STUDY Requested by the IMCO committee The e-commerce Directive as the cornerstone of the Internal Market Assessment and options for reform Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies Authors: Alexandre de STREEL, Martin HUSOVEC PE 648.797 - May 2020 EN DO NOT DELETE PAGE BREAK The e-commerce Directive as the cornerstone of the Internal Market Assessment and options for reform Abstract The e-commerce Directive was adopted in 2000 and has played a key role in the development of online platforms in Europe. The study assesses the effects of the Directive as a cornerstone of the Digital Single Market. On that basis, it proposes some reforms for the future Digital Services Act. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO). This document was requested by the European Parliament's committee on Internal Market and Consumer Protection AUTHORS Alexandre de STREEL, University of Namur and Centre on Regulation in Europe (CERRE) Martin HUSOVEC, London School of Economics and Political Science (LSE) ADMINISTRATORS RESPONSIBLE Mariusz MACIEJEWSKI Christina RATCLIFF EDITORIAL ASSISTANT Irene VERNACOTOLA LINGUISTIC VERSIONS Original: EN ABOUT THE EDITOR Policy departments provide in-house and external expertise to support EP committees and other parliamentary bodies in shaping legislation and exercising democratic scrutiny over EU internal policies. -

Towards an Updated EU Enforcement Directive? Selected Topics and Problems
Towards an updated EU Enforcement Directive? Selected topics and problems Contents I. Introduction II. Problem issues and open questions A. scope of protection B. infringements on the Internet, intermediaries and issues pending C. Collection of evidence and cross-border collection of evidence on the Internet D. Infringements committed on a commercial scale III. Conclusions I. Introduction Intellectual property infringements have taken considerable dimensions during the last years and have become a real threat both for right holders and consumers. A variety of international and European Union instruments have dealt with this issue but in a rather sporadic and incomplete manner in the sense that they are usually rather vague and general in nature, they leave considerable discretion to states, each one of them deals with different intellectual property rights and most of them were drafted when digital infringements were still at a premature stage.1 The EU Enforcement Directive2 was the first European Union instrument which dealt with the issue of IP enforcement in a more structured and organized manner providing Member States with a TRIPs Plus Element. Lately many initiatives have taken place in the area of IP enforcement. 3 However, the EU Enforcement Directive continues to be the most significant legal instrument in the area. 1 For the situation today see for example <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/OECD- FullReport.pdf>; <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Building%20a%20Digital %20Economy%20-%20TERA(1).pdf>. 2 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, OJ L157/16, 30.04.2004. -

The Law Enforcement Directive's Consent and Categorization
THE LAW ENFORCEMENT DIRECTIVE: CONCEPTUAL CHALLENGES OF EU DIRECTIVE 2016/680 Abstract Passed in synchronicity with the General Data Protection Regulation (GDPR), the Law Enforcement Directive (LED – EU Directive 2016/680) has been heralded for its role in building “an area of freedom, security and justice with a high level of data protection, in accordance with the EU Charter of Fundamental Rights”. Data processed for ‘law enforcement purposes’ by ‘competent authorities’ must comply with principles of necessity, proportionality & legality, while ensuring appropriate safeguards in place for data subjects. Despite an increase in scope, applicability, and rights and freedoms of individuals, there is ambiguity as to how the LED should work in practice. This is due to several conceptual issues that the LED raises. This paper discusses three of these issues. The first concerns the role of consent in the LED. Although the LED uses consent as a central concept, this is fundamentally at odds with the processing of personal data in a law enforcement context. The second issue is that the LED requires competent authorities to categorize data relating to witnesses, suspects, and victims. This is problematic, because a participant’s role in a criminal event is both fluid and dynamic and the roles of data subjects typically change over time or sometimes even overlap. The third issue is that the LED requires competent authorities to document whether data collected is a ‘fact’ or an ‘opinion’. The problem here is that ‘factual’ accounts of witnesses and others are always inherently subjective. The LED´s requirement on competent authorities to categorize facts from opinions and for controllers to make a clear distinction between offenders, suspects, witnesses, and victims puts recognized data protection principles of lawfulness, fairness, transparency in the crosshairs. -
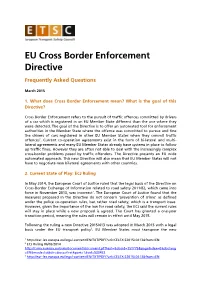
EU Cross Border Enforcement Directive Frequently Asked Questions
EU Cross Border Enforcement Directive Frequently Asked Questions March 2015 1. What does Cross Border Enforcement mean? What is the goal of this Directive? Cross Border Enforcement refers to the pursuit of traffic offences committed by drivers of a car which is registered in an EU Member State different than the one where they were detected. The goal of the Directive is to offer an automated tool for enforcement authorities in the Member State where the offence was committed to pursue and fine the drivers of cars registered in other EU Member States when they commit traffic offences1. Current co-operation agreements exist in the form of bi-lateral and multi- lateral agreements and many EU Member States already have systems in place to follow up traffic fines. However they are often not able to deal with the increasingly complex cross-border problems posed by traffic offenders. The Directive presents an EU wide automated approach. This new Directive will also mean that EU Member States will not have to negotiate new bilateral agreements with other countries. 2. Current State of Play: ECJ Ruling In May 2014, the European Court of Justice ruled that the legal basis of the Directive on Cross-Border Exchange of Information related to road safety 2011/82, which came into force in November 2013, was incorrect2. The European Court of Justice found that the measures proposed in the Directive do not concern ‘prevention of crime' as defined under the police co-operation rules, but rather road safety, which is a transport issue. However, given the importance of the law for road safety, the ECJ said the current rules will stay in place while a new proposal is agreed. -
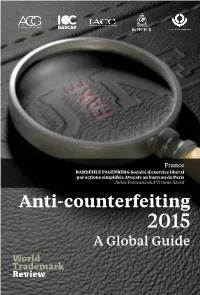
Anti-Counterfeiting 2015 a Global Guide Advert
France BARDEHLE PAGENBERG Société d’exercice libéral par actions simplifiée Avocats au barreau de Paris Julien Fréneaux and Viviane Azard Anti-counterfeiting 2015 A Global Guide Advert ... IP only. Legal Services Patent | Trademark | Design | Copyright Litigation | Prosecution | Advice Searches | Valuations | Portfolio Management License Agreements | Unfair Competition Law Technical Areas Electronics | Mechanics | Automotive | Energy Information Technology | Software | Computer Technology Chemistry | Life Sciences | Pharma | Medical Devices BARDEHLE PAGENBERG Société en participation d‘avocats au barreau de Paris 10 Boulevard Haussmann 75009 Paris France T +33.1.53 05 15 00 F +33.1.53 05 15 05 [email protected] Munich | Dusseldorf | Paris | Barcelona | Milan www.bardehle.com ... IP only. France BARDEHLE PAGENBERG Legal Services Patent | Trademark | Design | Copyright Litigation | Prosecution | Advice Searches | Valuations | Portfolio Management License Agreements | Unfair Competition Law Technical Areas Electronics | Mechanics | Automotive | Energy Information Technology | Software | Computer Technology Chemistry | Life Sciences | Pharma | Medical Devices Authors Julien Fréneaux and Viviane Azard Legal framework 315, which entered into force on March 13 As France is an EU member state, 2014 and strengthened the fight against Community trademarks and designs, which counterfeiting. The new law, which are valid in the European Union as a whole, amended the IP Code and the Customs are also valid in France. France also belongs Code, improves the compensation of to all major international agreements in rights holders for infringement and the IP field, such as the Paris Convention, strengthens the right of information as the Berne Convention and the Agreement well as infringement seizure procedures. on Trade-Related Aspects of IP Rights, and It also brings the IP Code and the Customs all substantive and procedural agreements Code into line with the new EU Customs dealing with patent, trademark and Regulation (608/2013).