Jahresbericht 2006
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

University of Birmingham the Political Economy of Fisheries Co-Management
University of Birmingham The political economy of fisheries co-management Nunan, Fiona DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2020.102101 License: Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND) Document Version Peer reviewed version Citation for published version (Harvard): Nunan, F 2020, 'The political economy of fisheries co-management: challenging the potential for success on Lake Victoria', Global Environmental Change, vol. 63, 102101. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102101 Link to publication on Research at Birmingham portal General rights Unless a licence is specified above, all rights (including copyright and moral rights) in this document are retained by the authors and/or the copyright holders. The express permission of the copyright holder must be obtained for any use of this material other than for purposes permitted by law. •Users may freely distribute the URL that is used to identify this publication. •Users may download and/or print one copy of the publication from the University of Birmingham research portal for the purpose of private study or non-commercial research. •User may use extracts from the document in line with the concept of ‘fair dealing’ under the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (?) •Users may not further distribute the material nor use it for the purposes of commercial gain. Where a licence is displayed above, please note the terms and conditions of the licence govern your use of this document. When citing, please reference the published version. Take down policy While the University of Birmingham exercises care and attention in making items available there are rare occasions when an item has been uploaded in error or has been deemed to be commercially or otherwise sensitive. -

Janmyr Civil Militias in Uganda NJHR Aug 2014.Pdf (150.8Kb)
Nordic Journal of Human Rights, 2014 Vol. 32, No. 3, 199–219, http://dx.doi.org/10.1080/18918131.2014.937203 Recruiting Internally Displaced Persons into Civil Militias: The Case of Northern Uganda Maja Janmyr* Researcher, Faculty of Law, University of Bergen, Norway This article explores the state-sanctioned recruitment of internally displaced persons (IDPs) into civil militias in northern Uganda between 1996 and 2006. Drawing upon international and Ugandan domestic law, as well as empirical research in Uganda, it provides an illustrative case study of the circumstances in which IDPs were mobilised into an array of civil militias. By applying a framework elaborated by the UN Commission on Human Rights, it discusses, and subsequently determines, the lawfulness of this mobilisation. When doing so, the article highlights how, in Uganda, civil militias were dealt with completely outside of domestic law, despite repeated calls from Ugandan MPs to establish their lawfulness. It finds that government authorities long denied any liability for the conduct of the militias, and argues that the uncertain position of the civil militias created plenty of room for unmonitored conduct and substantial human rights abuse. Keywords: Military recruitment; forced recruitment; civil militia; civil defence forces; auxiliary forces; internally displaced persons; Uganda 1. Introduction Military recruitment in the context of displacement has taken place on almost every continent and constitutes one of the most problematic security issues within refugee and internally displaced persons (IDP) camps.1 Refugees and IDPs have long been recruited by both state and non-state actors, forced or otherwise. At the same time, from the perspective of international law, one form of recruitment – recruitment into civil militias – is particularly understudied. -

An Independent Review of the Performance of Special Interest Groups in Parliament
DEEPENING DEMOCRACY AND ENHANCING SUSTAINABLE LIVELIHOODS IN UGANDA DEEPENING DEMOCRACY AND ENHANCING SUSTAINABLE LIVELIHOODS IN UGANDA An Independent Review of the Performance of Special Interest Groups in Parliament Arthur Bainomugisha Elijah D. Mushemeza ACODE Policy Research Series, No. 13, 2006 i DEEPENING DEMOCRACY AND ENHANCING SUSTAINABLE LIVELIHOODS IN UGANDA DEEPENING DEMOCRACY AND ENHANCING SUSTAINABLE LIVELIHOODS IN UGANDA An Independent Review of the Performance of Special Interest Groups in Parliament Arthur Bainomugisha Elijah D. Mushemeza ACODE Policy Research Series, No. 13, 2006 ii DEEPENING DEMOCRACY AND ENHANCING SUSTAINABLE LIVELIHOODS IN UGANDA TABLE OF CONTENTS LIST OF ACRONYMS................................................................ iii ACKNOWLEDGEMENTS............................................................ iv EXECUTIVE SUMMARY.............................................................. v 1.0. INTRODUCTION............................................................. 1 2.0. BACKGROUND: CONSTITUTIONAL AND POLITICAL HISTORY OF UGANDA.......................................................... 2 3.0. RESEARCH METHODOLOGY................................................... 3 4.0. LEGISLATIVE REPRESENTATION AND ENVIRONMENTAL GOVERNANCE.................................................................... 3 5.0. UNDERSTANDING THE CONCEPTS OF AFFIRMATIVE ACTION AND REPRESENTATION.................................................. 5 5.1. Representative Democracy in a Historical Perspective............................................................. -
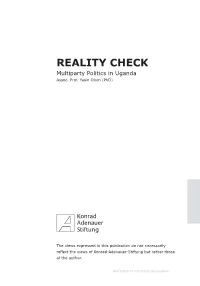
REALITY CHECK Multiparty Politics in Uganda Assoc
REALITY CHECK Multiparty Politics in Uganda Assoc. Prof. Yasin Olum (PhD) The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of Konrad-Adenauer-Stiftung but rather those of the author. MULTIPARTY POLITICS IN UGANDA i REALITY CHECK Multiparty Politics in Uganda Konrad-Adenauer-Stiftung 51A, Prince Charles Drive, Kololo P. O. Box 647, Kampala Tel. +256 414 25 46 11 www.kas.de ISBN: 978 - 9970 - 153 - 09 - 1 Author Assoc. Prof. Yasin Olum (PhD) © Konrad-Adenauer-Stiftung 2011 All rights reserved. No part of this publication may be produced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without prior written permission of Konrad-Adenauer-Stiftung ii MULTIPARTY POLITICS IN UGANDA Table of Contents Foreword ..................................................................................................... 1 List of Tables ................................................................................................. 3 Acronyms/Abbreviations ................................................................................. 4 Introduction .................................................................................................. 7 PART 1: THE MULTIPARTY ENVIRONMENT: HISTORICAL BACKGROUND, LEGAL FRAMEWORK AND INSTITUTIONS ........................... 11 Chapter One: ‘Democratic’ Transition in Africa and the Case of Uganda ........................... 12 Introduction ................................................................................................... 12 Defining Democracy -

List of Abbreviations
HRNJ - Uganda Human Rights Network for Journalists-Uganda (HRNJ-Uganda) Press Freedom Index Report April 2011 2 HRNJ - Uganda Contents Preface ....................................................................................................................... 5 Part I: Background .............................................................................................. 7 Introduction .......................................................................................................... 7 Elections and Media .............................................................................................. 7 Research Objective ............................................................................................... 8 Methodology ......................................................................................................... 8 Quality check ......................................................................................................... 8 Limitations ............................................................................................................. 9 Part II: Media freedom during national elections in Uganda ................................ 11 Media as a campaign tool ................................................................................... 11 Role of regulatory bodies ................................................................................... 12 Media self censorship ......................................................................................... 14 Censorship of social media -

Participant Biographies
Participant Biographies African Regional Conference on the Right of Access to Information Accra, Ghana February 7-9, 2010 Samuel O. Ablakwa Gbenga Adefaye Estelle Akofio-Sowah Currently the Country Lead of Google Ghana, Estelle is a highly motivated individual, committed to the social and economic development of Ghana. Previously the Managing Director of BusyInternet, Africa's hugely successful internet startup, highlights of her leadership there include launching an ISP which went on to be awarded ISP of the year 2008, winning a World Bank Incubator SME program grant and successfully raising the finances required to open two additional cafe outlets serving an average of 1000 clients per day. In 2008, Estelle was awarded Top African ICT Business Woman by the ForgeAhead African ICT Achievers Award Program in South Africa. A 2008 Class Fellow of the West African Leadership initiative (Aspen, Colorado), Estelle has a degree in Economics and Development Studies from the University of Sussex. Other work experience includes being the Conference and Banqueting Manager at La-Palm Royal Beach Hotel (Ghana’s only 5-star hotel) and Project Manager of the National Poverty Reduction Program at ProNet (local NGO partner to WaterAid UK). From her twelve years work experience in Ghana, Estelle has a broad understanding of local conditions, politics, social dynamics and the ICT community. Anthony Akoto Ampaw Joseph Allan Elizabeth Alpha-Lavalie Elizabeth Alpha - Lavalie is a professional Banker turned politician. She was elected to parliament in 1996 and served as Chairperson of the Finance committee and the committee of Health and Social services. She was elected Deputy Speaker of the Sierra Leone Parliament in 2001 and served as Chairperson of the Public Accounts Committee. -

UGANDA COUNTRY of ORIGIN INFORMATION (COI) REPORT COI Service
UGANDA COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION (COI) REPORT COI Service Date 20 April 2011 UGANDA DATE Contents Preface Latest News EVENTS IN UGANDA FROM 3 FEBRUARY TO 20 APRIL 2011 Useful news sources for further information REPORTS ON UGANDA PUBLISHED OR ACCESSED BETWEEN 3 FEBRUARY AND 20 APRIL 2011 Paragraphs Background Information 1. GEOGRAPHY ............................................................................................................ 1.01 Map ........................................................................................................................ 1.06 2. ECONOMY ................................................................................................................ 2.01 3. HISTORY .................................................................................................................. 3.01 Political developments: 1962 – early 2011 ......................................................... 3.01 Conflict with Lord’s Resistance Army (LRA): 1986 to 2010.............................. 3.07 Amnesty for rebels (Including LRA combatants) .............................................. 3.09 4. RECENT DEVELOPMENTS ........................................................................................... 4.01 Kampala bombings July 2010 ............................................................................. 4.01 5. CONSTITUTION.......................................................................................................... 5.01 6. POLITICAL SYSTEM .................................................................................................. -

The Parliament of Uganda
Parliamentary Budget Office September 2015 THE PARLIAMENT OF UGANDA SUMMARY OF THE RECOMMENDATIONS OF THE PARLIAMENTARY SECTORAL COMMITTEES ON THE FY 2015/16 BUDGET Compiled by the Parliamentary Budget Office (PBO) September 2015 1 Parliamentary Budget Office September 2015 TABLE OF CONTENTS LIST OF ACRONYMS ---------------------------------------------------------------------------- 5 FOREWORD ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 CHAPTER ONE ------------------------------------------------------------------------------------ 9 AGRICULTURE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 VOTE 010: MINISTRY OF AGRICULTURE, ANIMAL INDUSTRY AND FISHERIES -------------- 9 VOTE 152 NATIONAL AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES (NAADS) ----------------------- 12 VOTE 125 NATIONAL ANIMAL GENETIC RESOURCE CENTRE& DATA BANK (NAGRC & DB) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 VOTE 122 DAIRY DEVELOPMENT AUTHORITY (DDA) -------------------------------------------- 13 VOTE 160: UGANDA COFFEE DEVELOPMENT AUTHORITY (UCDA) -------------------------- 14 VOTE 155: COTTON DEVELOPMENT ORGANIZATION (CDO) ----------------------------------- 14 CHAPTER TWO ---------------------------------------------------------------------------------- 15 HEALTH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 VOTE 014: MINISTRY -

Annual Report 2008-2009
Annual Report 2008-2009 Ministry of External Affairs Cover Photo: Model of Jawahar Lal Nehru Bhawan, the Headquarters of the Ministry of External Affairs, under construction on Janpath, New Delhi Published by: Policy Planning and Research Division, Ministry of External Affairs, New Delhi This Annual Report can also be accessed at website: www.mea.gov.in Designed and printed by: Cyberart Informations Pvt. Ltd. 1517 Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi 110019 Website: www.cyberart.co.in Telefax: 0120-4231617 Contents Introduction and Synopsis i-xvi 1 India’s Neighbours 1 2 South East Asia and the Pacific 17 3 East Asia 30 4 Eurasia 34 5 The Gulf, West Asia and North Africa 41 6 Africa (South of Sahara) 54 7 Europe 79 8 The Americas 93 9 United Nations and International Organizations 108 10 Multilateral Economic Relations 125 11 Technical & Economic Cooperation and Development Partnership 132 12 Investment and Technology Promotion 135 13 Policy Planning and Research 136 14 Protocol 139 15 Consular, Passport and Visa Services 145 16 Administration and Establishment 149 17 Coordination 153 18 External Publicity 155 19 Public Diplomacy Division 157 20 Foreign Service Institute 161 21 Indian Council for Cultural Relations 163 22 Indian Council of World Affairs 168 23 Research and Information System for Developing Countries 170 24 Library 175 Appendices Appendix I: Cadre strength at Headquarters and Missions abroad during 2008-09 (including Posts budgeted by Ministry of Commerce and those ex-cadred etc.) 179 Appendix II: Data on recruitment -

Land Politics and Conflict in Uganda: a Case Study of Kibaale District, 1996 to the Present Day
7 Land Politics and Conflict in Uganda: A Case Study of Kibaale District, 1996 to the Present Day John Baligira Introduction This chapter examines how the interplay between politics and the competing claims for land rights has contributed to conflict in Kibaale district since 1996. It considers the case of Kibaale district as unique. First, as a result of the 1900 Buganda Agreement, 954 square miles of land (mailo land in Luganda language) which constituted 58 per cent of the total land in Buyaga and Bugangaizi counties of present Kibaale district was allocated by the British colonialists to chiefs and notables from Buganda. It is unique because there is no other district in Uganda, where most of the land is statutorily owned by people from outside that district. Second, people from elsewhere migrated massively to Kibaale district to the extent that they constitute about 50 per cent of the total population. No other district in Uganda has so far hosted new settlers constituting such a high percentage of its population. The chapter argues that the massive immigration and acquisition of land, the existence of competing land rights regimes, and the politicization of claims for land rights have contributed to conflict in Kibaale district (see map 1). 7- Land Politics.indd 157 28/06/2017 22:54:21 158 Peace, Security and Post-Conflict Reconstruction in the Great Lakes Region of Africa Map 7.1: Location of Kibaale district in Uganda Source: Makerere University Cartography Office, Geography Department, 2010 The ownership of mailo land in Buyaga and Bugangaizi counties by mostly Baganda was vehemently opposed by the Banyoro who considered themselves the original land owners. -

Lake Victoria Fisheries Organization and Fao Regional Stakeholders’ Workshop on Fishing Effort and Capacity on Lake Victoria
FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 818 FIEP/R818 (En) ISSN 2070-6987 Report of the LAKE VICTORIA FISHERIES ORGANIZATION AND FAO REGIONAL STAKEHOLDERS’ WORKSHOP ON FISHING EFFORT AND CAPACITY ON LAKE VICTORIA Mukono, Republic of Uganda, 8 November 2006 Copies of FAO publications can be requested from: Sales and Marketing Group Communication Division FAO Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italy E-mail: [email protected] Fax: +39 06 57053360 Web site: http://www.fao.org FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 818 FIEP/R818 (En) Report of the LAKE VICTORIA FISHERIES ORGANIZATION AND FAO REGIONAL STAKEHOLDERS’ WORKSHOP ON FISHING EFFORT AND CAPACITY ON LAKE VICTORIA Mukono, Republic of Uganda, 8 November 2006 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2008 The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. ISSN 978-92-5-106084-1 All rights reserved. -

Making a Difference Beyond Numbers
Making A Difference 9 789 970 2 9 010123 9630 ISBN: 9970-29-013-0 Beyond Numbers: Towards women's substantive engagement in political leadership in Uganda i Research Team Prof. Josephine Ahikire; Lead Researcher Dr. Peace Musiimenta Mr. Amon Ashaba Mwiine Ms Ruth Ojiambo Ochieng Ms Juliet Were Oguttu Ms Helen Kezie-Nwoha Ms Suzan Nkinzi Mr. Bedha Balikudembe Kirevu Mr. Archie Luyimbazi Ms Harriet Nabukeera Musoke Ms Prossy Nakaye Ms Gloria Oguttu Adeti Editors Mr. Bedha Balikudembe Kirevu Ms Ruth Ojiambo Ochieng Ms Juliet Were Oguttu Ms Helen Kezie-Nwoha Correspondence: Please address all correspondence to: The Executive Director Isis-Women’s International Cross Cultural Exchange (Isis-WICCE) Plot 7 Martyrs Rd. Ntinda P.O.Box 4934 Kampala – Uganda Tel: 256-414-543953 Fax: 256-414-543954 Email: [email protected] Website: http://www.isis.or.ug ISBN: 9970-29-013-0 All Rights Reserved. Requests for permission to reproduce or translate this publication for education and non commercial purposes should be addressed to Isis-WICCE. Design and Layout: WEVUGIRA James Ssemanobe ii TABLE OF CONTENTS List of tables iv Acronyms v Acknowledgement vi Foreword viii Executive Summary x 1.0 Introduction 1 1.1 Background to the Study 1 1.2 Focus of the Study 3 1.3 Study Objectives 4 1.4 Methodology 5 1.5 Women Political Leaders Making a Difference: A Conceptual Mapping 6 2.0 The Numbers: An Overview 7 2.1 Parliament and District Local Councils 7 2.2 Women Political Leaders in Other Government Institutions 11 3.0 Women Political Leaders beyond Physical Presence