Eduard Schwartz Und Die Kirchengeschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Eduard Schwartz' Wissenschaftliches Lebenswerk. Vorgelegt
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Abteilung Jahrgang 1942, Heft 4 Eduard Schwartz’ wissenschaftliches Lebenswerk Von Albert Rehm Vorgelegt am 14. März 1942 München 1942 Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften In Kommission bei der C. H. Beck’schen Verlagsbuchhandlung C. H. Beck’sche Buchdruckerei in Nördlingen INHALT Seite Vorbem erkung..................................................................... 5 I. Das äußere L e b e n ................................................... 7 II. Mythographie. Apologeten. Griechische Historio graphie, V o r t r ä g e .................................................... 16 III. Viertes Evangelium. Athanasios. Eusebios . 29 IV. Acta conciliorum. Kanones. Mönchtum. Thuky- dides. H om er................................................................ 41 V. Das Werk und der M ensch.......................................62 Schriftenverzeichnis.....................................................67 VORBEMERKUNG Zwei Gesichtspunkte sind es vor allem, die mich bestimmt haben, diese über den Umfang der üblichen akademischen Nachrufe weit hinausgehende Dar stellung niederzuschreiben. Einmal hat, so viele warmherzige und inhaltreiche Nachrufe1 auch nach Schwartz’ Tode erschienen sind, noch niemand es unter nommen, sein Lebenswerk im vollen Umfang einigermaßen gleichmäßig zu würdigen. Begreiflich, da es in zu vielerlei Disziplinen einschlägt, als daß ein Mann dazu imstande wäre. Auch ich bin natürlich nicht in dieser Lage, ja von meinen Arbeitsgebieten -

Preliminary Studies on the Scholia to Euripides
Preliminary Studies on the Scholia to Euripides CALIFORNIA CLASSICAL STUDIES NUMBER 6 Editorial Board Chair: Donald Mastronarde Editorial Board: Alessandro Barchiesi, Todd Hickey, Emily Mackil, Richard Martin, Robert Morstein-Marx, J. Theodore Peña, Kim Shelton California Classical Studies publishes peer-reviewed long-form scholarship with online open access and print-on-demand availability. The primary aim of the series is to disseminate basic research (editing and analysis of primary materials both textual and physical), data-heavy re- search, and highly specialized research of the kind that is either hard to place with the leading publishers in Classics or extremely expensive for libraries and individuals when produced by a leading academic publisher. In addition to promoting archaeological publications, papyrologi- cal and epigraphic studies, technical textual studies, and the like, the series will also produce selected titles of a more general profile. The startup phase of this project (2013–2017) is supported by a grant from the Andrew W. Mellon Foundation. Also in the series: Number 1: Leslie Kurke, The Traffic in Praise: Pindar and the Poetics of Social Economy, 2013 Number 2: Edward Courtney, A Commentary on the Satires of Juvenal, 2013 Number 3: Mark Griffith, Greek Satyr Play: Five Studies, 2015 Number 4: Mirjam Kotwick, Alexander of Aphrodisias and the Text of Aristotle’s Metaphys- ics, 2016 Number 5: Joey Williams, The Archaeology of Roman Surveillance in the Central Alentejo, Portugal, 2017 PRELIMINARY STUDIES ON THE SCHOLIA TO EURIPIDES Donald J. Mastronarde CALIFORNIA CLASSICAL STUDIES Berkeley, California © 2017 by Donald J. Mastronarde. California Classical Studies c/o Department of Classics University of California Berkeley, California 94720–2520 USA http://calclassicalstudies.org email: [email protected] ISBN 9781939926104 Library of Congress Control Number: 2017916025 CONTENTS Preface vii Acknowledgments xi Abbreviations xiii Sigla for Manuscripts of Euripides xvii List of Plates xxix 1. -

Reading Thucydides in the Early Twentieth Century
Histos () CXXXVI–CLVII REVIEW–DISCUSSION READING THUCYDIDES IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY Benjamin Earley, The Thucydidean Turn: (Re)Interpreting Thucydides’ Political Thought Before, During and After the Great War. London: Bloomsbury Academic, . Pp. Hardback, £.. ISBN ----. he Thucydidean Turn starts with the Thucydides trap—Graham Allison’s recent attempt to conceptualise the relations between China and the T US through Thucydides’ analysis of how the fear engendered in Sparta by Athenian growth ‘made war inevitable’. Earley (henceforth E.) then turns back from the ‘trap’—which he claims has ‘given greater public prominence to Thucydides than the Greek historian has ever enjoyed in the past’ ()—to analyse an earlier period of scholarly interest in Thucydides. In the rest of the book, he explores readings of Thucydides’ political thought in Great Britain in the first half of the twentieth century—Britain being, he suggests, the country where the influence exerted by contemporary events (the Boer War, the First World War) on Thucydidean scholarship was greatest. E.’s overarching argument is that these readings form a neglected background to the disciplinary formation of International Relations in the United States in the second half of the century. This argument is supported by successive chapters devoted to five figures, two of them (F. M. Cornford, G. F. Abbott) authors of monographs on Thucydides, the other three (Alfred Zimmern, Arnold Toynbee, Enoch Powell) famous above all for their (in one case notorious) contributions beyond the discipline of Classics; in addition, each chapter is enriched by a cast of supporting scholars (for instance, T. R. Glover and Charles Cochrane) from E.’s main time period as well as by prospective overviews of how themes have been developed in more recent scholarship in both Classics and Political Science. -

The Berlin Graeca: a Further Note Calder, William M Greek, Roman and Byzantine Studies; Winter 1979; 20, 4; Periodicals Archive Online Pg
The Berlin Graeca: a Further Note Calder, William M Greek, Roman and Byzantine Studies; Winter 1979; 20, 4; Periodicals Archive Online pg. 393 The Berlin Graeca: a further Note William M. Calder III RIEDRICH SOLMSEN in GRBS20 (1979) 89-122 provides a welcome Fdescription of Wilamowitz's Graeca, a group of young scholars who, every second Saturday in term, read a selected Greek author under his guidance at Eichenallee 12 in Charlottenburg. The group is important for two reasons. For about a decade it served to train younger scholars of ability to textual criticism of the highest order. This point is beautifully emphasized by Solmsen. Further it was a source for a number of publications of Wilamowitz's old age. Hesiodos Erga (1928) is merely the best known. 1 The American parallel would be W. A. Oldfather's Illinois Greek Club, the club that resulted in the publication of the Loeb Aeneas Tacticus.2 Solmsen is one of the four survivors of the Graeca, with Harald Fuchs, Werner Peek and Luise Reinhard. His extensive, authoritative account will be the Hauptquelle for how the group worked. This note is meant in no way to denigrate a remarkable feat of memory that goes back over fifty years. Solmsen candidly admits (89 n.l): "my memory is bound to have erred in a number of instances." Thus Wilamowitz was taken to Germany by the Italians not in a "submarine" (97) but in a "gunboat" 3-1 assume a small cruiser. The story (92-93 n.S) that Theodor Mommsen, when offered the title Exzellenz, hastily wrote "an article scathingly critical of some official policies" and sent it "to a progressive news- 1 I wrote at GRBS 16 (1975) 453: "Schadewaldt had suggested in 1927, while still Dozent at Berlin, that he and Wilamowitz read the Erga together." My source was Erga, 1: "Da schlug mein Kollege Schadewaldt vor, wir sollten die Erga gemeinschaftlich lesen." r thought gemeinschaftlich meant a private reading by the two. -

Ulrich Von Wilamowitz-Moellendorff: "Sospitator Euripidis" , Greek, Roman and Byzantine Studies, 27:4 (1986:Winter) P.409
CALDER, WILLIAM M., III, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: "Sospitator Euripidis" , Greek, Roman and Byzantine Studies, 27:4 (1986:Winter) p.409 Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: Sospitator Euripidis William M Calder III BEGIN with a word on achievement. Wilamowitz wrote on Euripi I des first in 1867,1 last in 1931.2 For 64 years he was concerned with Euripides. Athenian tragedy always remained a center of his interest. Within this center he wrote least on Sophocles,3 more on Aeschylus,4 but most on Euripides. The Hiller/Klaffenbach bibliog raphy lists 45 items on Euripides, against 19 on Aeschylus and 18 on Sophocles.5 Four great books, whose influence on subsequent schol arship in tragedy has been incalculable, are concerned wholly with Euripides: the Habilitationsschrift, Analecta Euripidea (1875); the two volume Herakles, first published in 1889; the commentary, text, and translation of Hippo!ytus (1891); and the edition of Ion (1926). Mar cello Gigante has written that neither Wilamowitz nor Nietzsche pub lished a magnum opus.6 Wilamowitz intended Herakles to be that, and completed it in his fortieth year-his acme in the ancient sense7 - with a dedication to Schulpforte, meaning it to be the fulfillment of a vow taken as a schoolboy to become a scholar worthy of his alma mater.8 His history of the text, from autograph to latest edition,9 1 U. von Wilamowitz-Moellendorff, In wieweit bejriedigen die SchlUsse der erhaltenen griechischen Trauerspiele? Ein iisthetischer Versuch, ed. W. M. Calder III (Leiden 1974 [hereafter Trauerspiele]) 95-148. 2 Der Glaube der Hellenen (Berlin 1932) II 597f s.n. -
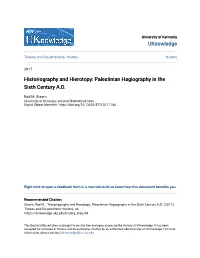
Palestinian Hagiography in the Sixth Century AD
University of Kentucky UKnowledge Theses and Dissertations--History History 2017 Historiography and Hierotopy: Palestinian Hagiography in the Sixth Century A.D. Rod M. Stearn University of Kentucky, [email protected] Digital Object Identifier: https://doi.org/10.13023/ETD.2017.168 Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Stearn, Rod M., "Historiography and Hierotopy: Palestinian Hagiography in the Sixth Century A.D." (2017). Theses and Dissertations--History. 44. https://uknowledge.uky.edu/history_etds/44 This Doctoral Dissertation is brought to you for free and open access by the History at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations--History by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. STUDENT AGREEMENT: I represent that my thesis or dissertation and abstract are my original work. Proper attribution has been given to all outside sources. I understand that I am solely responsible for obtaining any needed copyright permissions. I have obtained needed written permission statement(s) from the owner(s) of each third-party copyrighted matter to be included in my work, allowing electronic distribution (if such use is not permitted by the fair use doctrine) which will be submitted to UKnowledge as Additional File. I hereby grant to The University of Kentucky and its agents the irrevocable, non-exclusive, and royalty-free license to archive and make accessible my work in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known. I agree that the document mentioned above may be made available immediately for worldwide access unless an embargo applies. -

The Riddle of Wilamowitz's Phaidrabild
The Riddle of Wilamowitz's "Phaidrabild" Calder, William M Greek, Roman and Byzantine Studies; Fall 1979; 20, 3; Periodicals Archive Online pg. 219 W. B. STANFORD septuagenario The Riddle of Wilamowitz's Phaidrabild William M. Calder III N 1867 at the age of eighteen, Wilamowitz already held views on I Hippolytus. 1 The play even then was a favorite. It reveals "was der Dichter, wenn er sich zusammennahm, leisten konnte, in der That ein treffiiches Werk!" 2 The youth sees Hippolytus as the best example for Longinus' praise of Euripides' depiction of love (Subl. 15.3), the sensual love of the southern woman, passion mixed of sorrow and joy (Hipp. 348). Odi et amo, but not the adolescent senti mentality of Romeo and Juliet. 3 The great expository scene between the Nurse and Phaedra (Hipp. 176-524) far excels its counterpart in Medea. 4 The brilliant thought and natural exposition of the scene are compared with the dialogue of Hippolytus and the aged servant (Hipp. 88ff) that so well points the grounds for Aphrodite's wrath. He refuses to condemn Hippolytus' attack on women (Hipp. 616ff): "seine lange Diatribe gegen die Weiber, wohl das tollste, was selbst Euripides gegen sie losgelassen hat." 5 Hippolytus is a misogynist to begin with and has just encountered their worst possible side. And what follows is so dreadful. That Phaedra is provoked reasonably motivates her revenge. Theseus' exasperation is perfectly natural. The scene between father and son has an extraordinary effect upon the audience, who know the innocence of Hippolytus but admit that from his point of view Theseus is right. -

Illinois Classical Studies
ILLINOIS CLASSICAL STUDIES VOLUME X.l SPRING 1985 J. K. Newman, Editor ISSN 0363-1923 LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN NOTICE: According to Sec 19 (a) of the University Statutes, all books and other library materials acquired in any man- ner by the University belong to the University Library. When this item is no longer needed by the department, it should be returned to the Acquisition Department, University Library. DEPARTMENT OF THE CLASSICS 1 ^1 tio ILLINOIS CLASSICAL STUDIES VOLUME X.l Spring 1 985 J. K. Newman, Editor Patet omnibus Veritas; nondum est occupata; multum ex ilia etiam futuris relictum est. Sen. Epp. 33. 1 SCHOLARS PRESS ISSN 0363-1923 ILLINOIS CLASSICAL STUDIES VOLUME X.l ©1985 The Board of Trustees University of Illinois Copies of the journal may be ordered from: Scholars Press Customer Services P.O. Box 4869 Hampden Station Baltimore, MD 21211 Printed in the U.S.A. ADVISORY EDITORIAL COMMITTEE David F. Bright Howard Jacobson Harold C. GotofF Miroslav Marcovich Responsible Editor: J. K. Newman The Editor welcomes contributions, which should not normally exceed twenty double-spaced typed pages, on any topic relevant to the elucidation of classical antiquity, its transmission or influence. Con- sistent with the maintenance of scholarly rigor, contributions are especially appropriate which deal with major questions of interpre- tation, or which are likely to interest a wider academic audience. Care should be taken in presentation to avoid technical jargon, and the trans-rational use of acronyms. Homines cum hominibus loquimur. Contributions should be addressed to: The Editor, Illinois Classical Studies, Department of the Classics, 4072 Foreign Languages Building, 707 South Mathews Avenue, Urbana, Illinois 61801 Each contributor receives twenty-five offprints. -

Classical Scholarship in Berlin Between the Wars , Greek, Roman and Byzantine Studies, 30:1 (1989) P.117
SOLMSEN, FRIEDRICH, Classical Scholarship in Berlin Between the Wars , Greek, Roman and Byzantine Studies, 30:1 (1989) p.117 Classical Scholarship in Berlin Between the Wars t Friedrich Solmsen VER SINCE publishing "Wilamowitz in his Last Ten Years," 1 E I have been urged by colleagues and friends on both sides of the Atlantic to produce an account of developments in German classical scholarship between the two wars. What my late friend Hermann Strasburger deplored as widespread ignor ance of this period and a minimal sense of continuity with it due of course to the intervening twelve years of darkness and destruction-is proved by the abundance in recent articles of false and half-true statements, suggestions of questionable mo tives, and other distortions of what took place in that period. The reconstruction I offer here is based almost entirely on my own recollections of those years in Berlin. It cannot and should not be regarded as representative of Germany as a whole; simi lar reports from other centers, especially Munich and Leipzig, probably also Gottingen and Kiel, would complement the pic ture in essential ways. I In the years immediately after 1918, teachers of the classics were confronted with a new attitude on the part of the public. Among the many traditions affected by the catastrophe of the old political order was the primacy of the Humanistic Gymnasi um, which normally included in its curriculum six weekly hours of Greek for the last six years before the final exam. The 1 GRRS 20 (1979) 89-122. While I have made it a point to avoid repetitions, the present essay is inadequate in form as well as in content; its only justifica tion is that some developments recorded in it ought not to be forgotten or dis torted. -

Theological and Political Aspects of the Council of Chalcedon
Theological and Political Aspects of the Council of Chalcedon Wolf Liebeschuetz Introduction The Council of Chalcedon (AD 451) was certainly an event of very great historical importance.1 Its decisions and their enforcement by the Roman imperial government created lasting divisions in the Christian Church. It hastened the development of Christian Churches whose services used Syriac and Coptic instead of Greek.2 The implementation of the decisions of Chalcedon turned large numbers of the inhabitants of its eastern provinces against the imperial government, and thus assisted, and perhaps even made possible, first the Persian,3 and then the Arab conquest, and the subsequent Islamization of the oriental provinces of the Roman Empire.4 While the debates of the assembled bishops were entirely about theological and ecclesiastical issues, the underlying secular issues, which were to have such far-reaching political consequences, had had no place whatsoever in those debates. Chalcedon: The Definition of the Faith Christianity differed from other religions in the Roman Empire in many respects, but above all in the fact it laid down rules not only for ritual observance and moral conduct, but also required correct belief. Membership of the Church involved (and involves) acceptance of the Church‟s doctrines. Christianity demands from its followers not only attendance at Christian worship, and adherence to a strict code of morality, but also 1 First of all I want to thank the reviewer of Scripta Classica Israelica for a number of corrections and other helpful suggestions for improvement of this paper. The basic text: Acta Conciliorum Oecumenicorum, ed. Eduard Schwartz, vols. -

Homer and Rhapsodic Competition in Performance1
Oral Tradition, 16/1 (2001): 129-167 Homer and Rhapsodic Competition in Performance1 Derek Collins Introduction One legacy of Homeric studies since the pathbreaking work of Milman Parry, Albert Lord, Gregory Nagy, and John Miles Foley has been an emphasis on the earliest stages of composition and performance. These scholars have shown in detail how poet-singers compose while they perform, and perform while they compose epic poetry. However, we have yet to apply the valuable insights gained from their research to later stages of a poetic tradition, particularly after the poetic “texts” have become stable and written down, while live performances of these “texts” continue. The time has now come to attempt such an application, but with important qualifications. This is because a performance tradition that takes place against a body of fixed texts is governed by different rules, as it were, than one that is as yet in a more fluid stage. For one, audience expectation will be different, and greater allusive precision may be achieved by live performers who modify and improvise textual elements to surprise, shock, or delight their audiences. It is important to stress at the outset that a fixed text need not be an impediment, and indeed it may be an impetus, to the contingent and improvisational demands of live poetic performance. Scholars are only beginning to apply these insights to the long tradition of rhapsodic performances of Homeric poetry.2 Although rhapsodes have received increasing attention in recent scholarship,3 there has 1 Earlier versions of this paper were given at the annual meeting of the American Philological Association (December 1998), and before audiences at the Universities of Michigan, Iowa, and Missouri.