Piratensender Powerplay S
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hans Knot International Radio Report July/August 2017
Hans Knot International Radio Report July/August 2017 Welcome to another issue of the International Radio Report and like every summer it will be one for the month of July and August. Thanks for the many response on last issue as well as memories and photos have been sent in for this and further issues. Enjoy the report! Sadly we have to start with bad news. May the 30th the following sad news came in from Mark Sloane (Pat Hammerton) ‘Sorry to report Hans my dear chum David Gilbee, Dave Mackay, died this weekend. He and I met on Radio 390 and worked together on 355. He was also my brother in law, marrying my sister Lis.’ Dave MacKay Radio 355 Photo: collection Pirate Hall of Fame I’m very sorry to hear this sad news Pat. Of course you know him far much better than I do. I met him on a handful of occasions and was in contact with him by e-mail through the years. Of course he was on special Radio Reunions a few times in England where we met during the last 20 years. But our very first meeting was one, were we sometimes talked about. It was a very special day just after the official opening of Melody Radio in London. I was there for a special for our magazine and he told me all about the station, the style of presentation but above all how much of the music was transferred to a machine which was just put into the market. It was Dave who brought me to the idea to do the same with my vinyl collection. -

Radio Freedom
[front cover] ANARCHY 93 two shillings thirty cents radio freedom [inside front cover] Contents of No. 93 November 196 The case for listener-supported radio Theodore Roszak [321] Radio freedom: an anarchist approach Godfrey Featherstone [329] Pirate political radio Norman Fulford [339] The rise and fall of pirate radio Robert Barltrop [341] Brief summer of free media in France J.M.W. [348] Cover by Ivor Claydon Subscribe to “Anarchy”: Single copies 2s. (30c.). Annual subscription (12 issues) 26s. ($3.50). By airmail 47s. ($7.00). Joint annual subscription, with FREEDOM, the anarchist weekly (which readers of ANARCHY will find indispensable) 50s. ($7.50). Cheques, P.O.s and Money Orders should be made out to FREEDOM PRESS, 84a Whitechapel High Street, London, E1, England. Other issues of “Anarchy”: Please note: Issues 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 20, 26, 34, 36, 37, 38, 39, 66, 70, 71 are out of print. Vol. 1. 1961: 1. Sex-and-Violence; 2. Workers’ control; 3. What does anarchism mean today?; 4. Deinstitutionalisation; 5. Spain; 6. Cinema; 7. Adventure playground; 8. Anthropology; 9. Prison; 10. Industrial decentralisation. Vol. 2. 1962: 11. Paul Goodman, A. S. Neill; 12. Who are the anarchists?; 13. Direct action; 14. Disobedience; 15. David Wills; 16. Ethics of anarchism; 17. Lumpenproletariat; 18. Comprehensive schools; 19. Theatre; 20. Non- violence; 21. Secondary modern; 22. Marx and Bakunin. Vol. 3. 1963: 23. Squatters; 24. Community of scholars; 25. Cybernetics; 26. Thoreau; 27. Youth; 28. Future of anarchism; 29. Spies for peace; 30. Community workshop; 31. Self-organising systems: 32. -

Freewave #490
NOSTALGIE FREEWAVE nostalgie 2017 (05) — Nummer 490 — Jaargang 40 www.freewave-media-magazine.nl COLOFON Exploitatie: Stichting Media Communicatie Hoofdredacteur: Hans Knot Lay-out: Jan van Heeren Vaste medewerkers: Paul de Haan, André van Os, Lieuwe van der Velde, Martin van der Ven Verantwoordelijke uitgever: Stichting Media Communicatie, Jan-Fré Vos, Kornoeljestraat 4a, 9741 JB Groningen E-mail: [email protected] www.mediacommunicatie.nl Correspondentieadres: Hans Knot, Populierenlaan 8, 9741 HE Groningen E-mail: [email protected] www.hansknot.com - www.soundscapes.info De medewerkers van Lidmaatschap: Een abonnement op Freewave Media Magazine (digi- Freewave Nostalgie wensen u taal) kost tegenwoordig HELEMAAL NIETS! Uiteraard staat het u vrij een donatie naar SMC te een fijne jaarwisseling sturen. (Zie hieronder.) en een goed 2018 . U kunt het pdf-bestand downloaden op: www.freewave-media-magazine.nl André, Dieter, Hans, Jan, Jan-Fré, Transacties en donaties: Jean-Luc, Lieuwe, Martin en Paul. ING-rekening: NL85 INGB 0004 0657 00 t.n.v. Mediacommunicatie, Groningen (BIC: INGBNL2A) -betaling ook mogelijk Adverteren in Freewave Nostalgie is mo- gelijk. E-mail: [email protected] Inhoud FOTO’S Acht vrouwen en een radiozendschip 3 Indien niet anders vermeld zijn alle foto’s uit het Even stilstaan bij maart 1971 10 Freewave en Offshore Echo’s archief. De inspiratie van en voor WKRP in Cincinnati 15 ISSN NR. 1381-8562 Creatief luisteren naar de radio in de auto 19 CAI in Groningen 21 Winkelcentrum Paddepoel 46 jaar 23 NRU: donkere wolken verwacht 32 Uit het leven van Jos van Vliet 34 COVER: Het Prinsenhof in Groningen, Actie voor radio’s 45 jaar geleden 38 thuisbasis van de RONO (1966) Barry Sadler, de gevallen Green Beret 42 Drie in één, ofwel aan 3 herinneringen .. -

Hans Knot International Radio Report September 2014
Hans Knot International Radio Report September 2014 Welcome to another edition of the report. And again it’s a long edition with thanks to all contributors. This issue we start with Caroline in the past. As told before this year, 2014, is the year we celebrate the fact that Radio Caroline was raised 50 years ago as the first British Offshore Radio station. Therefor I try to relive the memories with some of the many chapters I’ve either written or edited through the years for several magazines and books on this subject. Next to Radio Caroline there have been a lot of radio stations, transmitting from the international waters. Of course we all know the big ones like Radio Caroline, Radio London, Radio Veronica and Radio Northsea International – to mention a few of them. Next to the big ones, where all the ‘stars’ could be heard on our transistor radios, there were many more radio stations which didn’t get the attention as the big brothers. In my view that’s really a pity as they were – in their own category – also good stations. From the sixties I do remember a few examples of minor radio stations which really felt good in my listening ears. First Radio 355, a very good middle of the road music station, which was only a couple of months on the air in 1967. Then there was Radio 390, which was a very easy listening station. The station did close down in 1967 and now – 47 years later – it’s still great fun to listen to the most relaxing sound Offshore Radio ever had. -

Hans Knot International Radio Report February 2018
Before starting with the report, I have to tell that I had serious problems with my main computer which was blocked totally. An ITC expert explained after a few days that nothing could be rescued and so I bought a new one. All the e mail addresses used on the old computer were gone too. Lucky, I stored through the past 20 years a lot of e mail addresses on my work office computer. As the system was not compatible, with the outlook-system I use at home, they had to be transferred by hand. This is not ready yet but work is progressing. If you get this e mail by mistake please mention it to me so I will get your name off the e mail list for the report. Hans Knot International Radio Report February 2018 Welcome to a new International Radio Report, the first on in 2018. Thanks for all the Christmas and New Years wishes which came from all over the world and of course our wishes go to all the readers. Well a lot of e mails, memories and more is following in the report. First sad news. Peter Brian, aka Peter van Dam who worked for Radio 199, Radio Caroline, Radio Atlantis, Radio Mi Amigo and numerous other stations between 1972 and 2017 died on Saturday January 6th at the age of 65. He was the number one deejay from Belgium for many decades. Jean Luc Bostyn has written an obituary, which you can find with the next link. Peter van Dam 1973 photo: Menno Dekker https://translate.google.nl/translate?sl=nl&tl=en&js=y&prev=_t&hl=n l&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fradiovisie.eu%2Fhet-manneke- popt-niet-meer%2F&edit-text=&act=url Martin van der Ven has added a special page to our photo archive, which you can find here: https://www.flickr.com/photos/offshoreradio/albums/72157662456 566717 Look who we have here? Ulf Posé who worked as Hannibal on the German Service on RNI in 1970. -
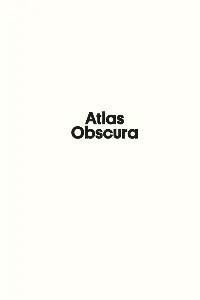
Joshua Foer, Dylan Thuras & Ella Morton
Atlas 00 NL.indd 1 06-04-17 15:00 Atlas 00 NL.indd 2 06-04-17 15:00 1000 PLEKKEN OM TE ONTDEKKEN JOSHUA FOER, DYLAN THURAS & ELLA MORTON Atlas 00 NL.indd 3 06-04-17 15:00 Een belangrijk bericht voor lezers Hoewel de uitgever en schrijvers al het mogelijke hebben gedaan ten aanzien van de accuraatheid en tijdigheid van de informatie in dit boek, raden we de lezers sterk aan om de details te checken voor ze reisplannen maken. Informatie over de locatie en route kan veranderen; GPS-coördinaten zijn benaderingen en moeten ook als zodanig worden beschouwd. Als u ontdekt dat informatie verouderd of niet correct is, laat ons dat dan weten via [email protected]. Atlas Obscura is geschreven voor het avontuur; lezers reizen op eigen risico en beho- ren alle lokale wetten te gehoorzamen. Sommige plekken die in dit boek zijn beschreven, zijn niet open voor publiek en kunnen alleen worden bezocht met de toepasselijke vergun- ningen. Noch de schrijvers, noch de uitgever zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies, verwondingen of schade die volgens de reiziger volgt uit informatie of suggesties in dit boek. Copyright ©2016 Atlas Obscura, Inc. Kaarten: Scott MacNeill Illustraties: Sophie Nicolay Gepubliceerd zoals overeengekomen met Workman Publishing Company, Inc., New York. Eerst uitgegeven in de Verenigde Staten als ATLAS OBSCURA: An Explorer's Guide to the World's Hidden Wonders. Art direction en design: Janet Vicario Foto-onderzoek: Bobby Walsh en Melissa Lucier Bijkomende illustraties: Jen Keenan ©2017 Nederlandse uitgave: Uitgeverij TERRA Terra maakt deel uit van TerraLannoo bv Postbus 97 3990 DB Houten, Nederland [email protected] www.terralannoo.nl Boekverzorging: LINE UP boek en media bv Vertaling: Jolanda Abbes, Linda Beukers, Lilian Eefting, Else van Keulen, Astrid Werumeus Buning Opmaak binnenwerk: Niels Kristensen Omslag: Sander Pinkse Boekproduktie B.V.