Swr2-Musikstunde-20130916.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mozart Magic Philharmoniker
THE T A R S Mass, in C minor, K 427 (Grosse Messe) Barbara Hendricks, Janet Perry, sopranos; Peter Schreier, tenor; Benjamin Luxon, bass; David Bell, organ; Wiener Singverein; Herbert von Karajan, conductor; Berliner Mozart magic Philharmoniker. Mass, in C major, K 317 (Kronungsmesse) (Coronation) Edith Mathis, soprano; Norma Procter, contralto...[et al.]; Rafael Kubelik, Bernhard Klee, conductors; Symphonie-Orchester des on CD Bayerischen Rundfunks. Vocal: Opera Così fan tutte. Complete Montserrat Caballé, Ileana Cotrubas, so- DALENA LE ROUX pranos; Janet Baker, mezzo-soprano; Nicolai Librarian, Central Reference Vocal: Vespers Vesparae solennes de confessore, K 339 Gedda, tenor; Wladimiro Ganzarolli, baritone; Kiri te Kanawa, soprano; Elizabeth Bainbridge, Richard van Allan, bass; Sir Colin Davis, con- or a composer whose life was as contralto; Ryland Davies, tenor; Gwynne ductor; Chorus and Orchestra of the Royal pathetically brief as Mozart’s, it is Howell, bass; Sir Colin Davis, conductor; Opera House, Covent Garden. astonishing what a colossal legacy F London Symphony Orchestra and Chorus. Idomeneo, K 366. Complete of musical art he has produced in a fever Anthony Rolfe Johnson, tenor; Anne of unremitting work. So much music was Sofie von Otter, contralto; Sylvia McNair, crowded into his young life that, dead at just Vocal: Masses/requiem Requiem mass, K 626 soprano...[et al.]; Monteverdi Choir; John less than thirty-six, he has bequeathed an Barbara Bonney, soprano; Anne Sofie von Eliot Gardiner, conductor; English Baroque eternal legacy, the full wealth of which the Otter, contralto; Hans Peter Blochwitz, tenor; soloists. world has yet to assess. Willard White, bass; Monteverdi Choir; John Le nozze di Figaro (The marriage of Figaro). -
ARSC Journal
A Discography of the Choral Symphony by J. F. Weber In previous issues of this Journal (XV:2-3; XVI:l-2), an effort was made to compile parts of a composer discography in depth rather than breadth. This one started in a similar vein with the realization that SO CDs of the Beethoven Ninth Symphony had been released (the total is now over 701). This should have been no surprise, for writers have stated that the playing time of the CD was designed to accommodate this work. After eighteen months' effort, a reasonably complete discography of the work has emerged. The wonder is that it took so long to collect a body of information (especially the full names of the vocalists) that had already been published in various places at various times. The Japanese discographers had made a good start, and some of their data would have been difficult to find otherwise, but quite a few corrections and additions have been made and some recording dates have been obtained that seem to have remained 1.Dlpublished so far. The first point to notice is that six versions of the Ninth didn't appear on the expected single CD. Bl:lhm (118) and Solti (96) exceeded the 75 minutes generally assumed (until recently) to be the maximum CD playing time, but Walter (37), Kegel (126), Mehta (127), and Thomas (130) were not so burdened and have been reissued on single CDs since the first CD release. On the other hand, the rather short Leibowitz (76), Toscanini (11), and Busch (25) versions have recently been issued with fillers. -

The Magic Flute
WOLFGANG AMADEUS MOZART the magic flute conductor Libretto by Emanuel Schikaneder Harry Bicket Saturday, December 29, 2018 production 1:00–2:45 PM Julie Taymor set designer George Tsypin costume designer Julie Taymor lighting designer The abridged production of Donald Holder The Magic Flute was made possible by a puppet designers Julie Taymor gift from The Andrew W. Mellon Foundation Michael Curry and Bill Rollnick and Nancy Ellison Rollnick choreographer Mark Dendy The original production of Die Zauberflöte was made possible by a revival stage director David Kneuss gift from Mr. and Mrs. Henry R. Kravis english adaptation J. D. McClatchy Additional funding was received from John Van Meter, The Annenberg Foundation, Karen and Kevin Kennedy, Bill Rollnick and Nancy Ellison Rollnick, Mr. and Mrs. William R. general manager Miller, Agnes Varis and Karl Leichtman, and Peter Gelb Mr. and Mrs. Ezra K. Zilkha jeanette lerman-neubauer music director Yannick Nézet-Séguin 2018–19 SEASON The Magic Flute is The 447th Metropolitan Opera performance of performed without intermission. WOLFGANG AMADEUS MOZART’S This performance is being broadcast the magic flute live over The Toll Brothers– Metropolitan Opera conductor International Radio Harry Bicket Network, sponsored by Toll Brothers, in order of vocal appearance America’s luxury ® tamino second spirit homebuilder , with Ben Bliss* Eliot Flowers generous long- first l ady third spirit term support from Gabriella Reyes** N. Casey Schopflocher the Annenberg Foundation and second l ady spe aker GRoW @ Annenberg, Emily D’Angelo** Alfred Walker* The Neubauer Family third l ady sar astro Foundation, the Maria Zifchak Morris Robinson* Vincent A. -

Eberhard Waechter“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Eberhard Waechter“ Verfasserin Mayr Nicoletta angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl: A 317 Studienrichtung: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof.Dr. Hilde Haider-Pregler Dank Ich danke vor allem meiner Betreuerin Frau Professor Haider, dass Sie mir mein Thema bewilligt hat und mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich danke der Familie Waechter und Frau Anneliese Sch. für die Bereitstellung des Materials. Ich danke meiner Schwester Romy und meiner „Seelenverwandten“ Sheila und all meinen Freunden für ihre emotionale Unterstützung und die zahlreichen motivierenden Gespräche. Ich danke meinem Bruder Florian für die Hilfe im Bereich der Computertechnik. Ein großer Dank gilt meiner Tante Edith, einfach dafür, dass es dich gibt. Außerdem danke ich meinen Großeltern, dass sie meine Liebe zur Musik und zur Oper stets enthusiastisch aufgenommen haben und mit mir Jahr für Jahr die Operettenfestspiele in Bad Ischl besucht haben. Ich widme meine Diplomarbeit meinen lieben Eltern. Sie haben mich in den letzten Jahren immer wieder finanziell unterstützt und mir daher eine schöne Studienzeit ermöglicht haben. Außerdem haben sie meine Liebe und Leidenschaft für die Oper stets unterstützt, mich mit Büchern, Videos und CD-Aufnahmen belohnt. Ich danke euch für eure Geduld und euer Verständnis für eure oft komplizierte und theaterbessene Tochter. Ich bin glücklich und froh, so tolle Eltern zu haben. Inhalt 1 Einleitung .......................................................................................... -
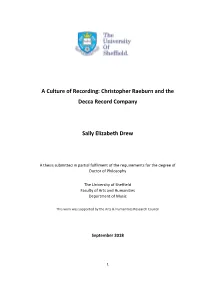
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company Sally Elizabeth Drew A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Sheffield Faculty of Arts and Humanities Department of Music This work was supported by the Arts & Humanities Research Council September 2018 1 2 Abstract This thesis examines the working culture of the Decca Record Company, and how group interaction and individual agency have made an impact on the production of music recordings. Founded in London in 1929, Decca built a global reputation as a pioneer of sound recording with access to the world’s leading musicians. With its roots in manufacturing and experimental wartime engineering, the company developed a peerless classical music catalogue that showcased technological innovation alongside artistic accomplishment. This investigation focuses specifically on the contribution of the recording producer at Decca in creating this legacy, as can be illustrated by the career of Christopher Raeburn, the company’s most prolific producer and specialist in opera and vocal repertoire. It is the first study to examine Raeburn’s archive, and is supported with unpublished memoirs, private papers and recorded interviews with colleagues, collaborators and artists. Using these sources, the thesis considers the history and functions of the staff producer within Decca’s wider operational structure in parallel with the personal aspirations of the individual in exerting control, choice and authority on the process and product of recording. Having been recruited to Decca by John Culshaw in 1957, Raeburn’s fifty-year career spanned seminal moments of the company’s artistic and commercial lifecycle: from assisting in exploiting the dramatic potential of stereo technology in Culshaw’s Ring during the 1960s to his serving as audio producer for the 1990 The Three Tenors Concert international phenomenon. -

KING FM SEATTLE OPERA CHANNEL Featured Full-Length Operas
KING FM SEATTLE OPERA CHANNEL Featured Full-Length Operas GEORGES BIZET EMI 63633 Carmen Maria Stuarda Paris Opera National Theatre Orchestra; René Bologna Community Theater Orchestra and Duclos Chorus; Jean Pesneaud Childrens Chorus Chorus Georges Prêtre, conductor Richard Bonynge, conductor Maria Callas as Carmen (soprano) Joan Sutherland as Maria Stuarda (soprano) Nicolai Gedda as Don José (tenor) Luciano Pavarotti as Roberto the Earl of Andréa Guiot as Micaëla (soprano) Leicester (tenor) Robert Massard as Escamillo (baritone) Roger Soyer as Giorgio Tolbot (bass) James Morris as Guglielmo Cecil (baritone) EMI 54368 Margreta Elkins as Anna Kennedy (mezzo- GAETANO DONIZETTI soprano) Huguette Tourangeau as Queen Elizabeth Anna Bolena (soprano) London Symphony Orchestra; John Alldis Choir Julius Rudel, conductor DECCA 425 410 Beverly Sills as Anne Boleyn (soprano) Roberto Devereux Paul Plishka as Henry VIII (bass) Royal Philharmonic Orchestra and Ambrosian Shirley Verrett as Jane Seymour (mezzo- Opera Chorus soprano) Charles Mackerras, conductor Robert Lloyd as Lord Rochefort (bass) Beverly Sills as Queen Elizabeth (soprano) Stuart Burrows as Lord Percy (tenor) Robert Ilosfalvy as roberto Devereux, the Earl of Patricia Kern as Smeaton (contralto) Essex (tenor) Robert Tear as Harvey (tenor) Peter Glossop as the Duke of Nottingham BRILLIANT 93924 (baritone) Beverly Wolff as Sara, the Duchess of Lucia di Lammermoor Nottingham (mezzo-soprano) RIAS Symphony Orchestra and Chorus of La Scala Theater Milan DEUTSCHE GRAMMOPHON 465 964 Herbert von -

Constructing the Archive: an Annotated Catalogue of the Deon Van Der Walt
(De)constructing the archive: An annotated catalogue of the Deon van der Walt Collection in the NMMU Library Frederick Jacobus Buys January 2014 Submitted in partial fulfilment for the degree of Master of Music (Performing Arts) at the Nelson Mandela Metropolitan University Supervisor: Prof Zelda Potgieter TABLE OF CONTENTS Page DECLARATION i ABSTRACT ii OPSOMMING iii KEY WORDS iv ACKNOWLEDGEMENTS v CHAPTER 1 – INTRODUCTION TO THIS STUDY 1 1. Aim of the research 1 2. Context & Rationale 2 3. Outlay of Chapters 4 CHAPTER 2 - (DE)CONSTRUCTING THE ARCHIVE: A BRIEF LITERATURE REVIEW 5 CHAPTER 3 - DEON VAN DER WALT: A LIFE CUT SHORT 9 CHAPTER 4 - THE DEON VAN DER WALT COLLECTION: AN ANNOTATED CATALOGUE 12 CHAPTER 5 - CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 18 1. The current state of the Deon van der Walt Collection 18 2. Suggestions and recommendations for the future of the Deon van der Walt Collection 21 SOURCES 24 APPENDIX A PERFORMANCE AND RECORDING LIST 29 APPEDIX B ANNOTED CATALOGUE OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION 41 APPENDIX C NELSON MANDELA METROPOLITAN UNIVERSTITY LIBRARY AND INFORMATION SERVICES (NMMU LIS) - CIRCULATION OF THE DEON VAN DER WALT (DVW) COLLECTION (DONATION) 280 APPENDIX D PAPER DELIVERED BY ZELDA POTGIETER AT THE OFFICIAL OPENING OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION, SOUTH CAMPUS LIBRARY, NMMU, ON 20 SEPTEMBER 2007 282 i DECLARATION I, Frederick Jacobus Buys (student no. 211267325), hereby declare that this treatise, in partial fulfilment for the degree M.Mus (Performing Arts), is my own work and that it has not previously been submitted for assessment or completion of any postgraduate qualification to another University or for another qualification. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 89, 1969-1970
Carnegie Ha %mfwE&5£'3t'lHr* . <S) •COLUMBIA.' WmARCASREG PRINTED IN U S .A. Columbia Records announces a distinguished recording event. Columbia celebrates the Beethoven Bicentennial with a special salute to the great master from Leonard Bernstein and the New York Philharmonic. "Leonard Bernstein brings to his readings of Beethoven an overwhelming dramatic dynamism and surge of human feeling. One is swept into the world of Beethoven's own creative furies." —Stereo Review On Columbia Records Outside the United States and Canada, Columbia Records bear the CBS Records label THE CARNEGIE HALL CORPORATION Isaac Stern, President Frederick W. Richmond, Chairman of the Board Robert W. Dowling, Chairman, Executive Committee John Barry Ryan III, Executive Vice President Hon. Eugene M. Becker, Harry Van Arsdale, Gerald F. Warburg, Vice Presidents Lucien Wulsin, Treasurer Raymond S. R ubi now, Secre tary Nordlinger, Riegelman, Benetar and Charney, Counsel Board of Trustees Leonard Altman Hon. MacNeil Mitchell Hon. George W. Ball Mrs. George W. Naumburg Hon. Eugene M. Becker Frederick W. Richmond T. Roland Berner Col. Harold Riegelman Julius Bloom Raymond S. Rubinow James S. Deely John Barry Ryan III Jack deSimone Hon. Constantine Sidamon-Eristoff Robert W. Dowliny Aye Simon Hon. Abe Fortas Isaac Stern Hon. Roy M. Goodman Harry Van Arsdale Mrs. Dorothy Hirshon Gerald F. Warburg Mrs. Jacob M. Kaplan Mrs. Philip Wise Hon. John V. Lindsay Lucien Wulsin Joseph B. Martinson Honorary Trustees Marian Anderson Mrs. Albert D. Lasker Robert S. Benjamin Norman K. Winston Dr. Ralph J. Bunche David L. Yunich Mrs. Marshall Field Julius Bloom, Executive Director Ronald J. -

111053-54 Bk Bhmissa
111337-38 bk Cornelius EU 13/7/08 22:48 Page 12 Fatime must go to Zobeide, the Caliph’s wife, to ask for his wife’s funeral. Fatime explains to him what has for funeral money for her dead husband. She bids her happened, while out aloud they pretend to quarrel over dead husband farewell and sets off for the palace. the locked cupboard. They continue, with Abu Hassan 7 Abu Hassan sings of what he would do with money, playing the jealous husband, while Omar, in the CORNELIUS: The Barber of Baghdad entertaining, enjoying himself and lavishing money cupboard, is fearful of discovery. Fatime sees a palace too on his wife. servant approaching, and Abu Hassan tells her to lie 8 The door opens, and there stands Omar, the down, feet towards Mecca, allowing the messenger to WEBER: Abu Hassan Caliph’s money-lender, followed by other creditors, return to the palace with news of Fatime’s death, thus seeking money from Abu Hassan, whose debts have letting the Caliph win his bet with Zobeide. fallen due. Omar is unwilling to wait any longer, but # Rôles are reversed with the approach of a second Abu Hassan begs him to be patient, telling him that messenger, Zobeide’s servant and the narrator in the SCHW Fatime has gone to take money from Zobeide and whole piece, who finds Fatime mourning her husband; TH AR explaining how she admires Omar’s generosity and she shows the woman her husband’s body and is BE Z A K goodness. Omar is ready to help Fatime and deal with comforted to be told that she is young and pretty and S O Abu Hassan’s creditors, who leave with him. -

Opera Recordings: a Very Personal Guide by Ralph Moore
“Untouchable” and ”Most Recommendable” Opera Recordings: a very personal guide by Ralph Moore My handful of regular readers might have noticed some glaring omissions in the list of thirty-seven major operas whose discographies I have surveyed over the last couple of years - operas whose quality and popularity are such that one might reasonably have expected me to have included them in my labours. There are, after all, probably around fifty truly first-rate operas which have been most often performed and recorded and I have by no means covered them all. I received requests to survey some of the following but on consideration, I realised that there were good reasons for my reluctance to do so. The most obvious omissions are these twelve operas: Verdi’s La traviata and Il trovatore; Wagner’s Lohengrin and Tannhäuser; Mozart’s Don Giovanni; Puccini’s La bohème, Tosca, Madama Butterfly and Turandot; Rossini’s Il barbiere di Siviglia; Donizetti’s Lucia di Lammermoor and Beethoven’s Fidelio. My reason for not having reviewed them collectively is that either the opera in question has received one or two recordings of such definitive quality that consideration of the others is otiose or there are so many good recordings of it in the catalogue that making a helpful or meaningful recommendation becomes difficult. I have therefore decided to circumvent the problem by making some brief, annotated recommendations and guidance for those major operas hitherto neglected. Obviously, my selections are highly subjective and controversial, and other collectors will be dismayed that I have ostensibly rejected their own candidates for recordings of classic status or nominated one they loathe but at the same time I think I may fairly claim that these are, in general, recordings which have stood the test of time. -

Strauss' Capriccio
Richard Strauss’ Capriccio - A survey of the discography by Ralph Moore Strauss’ swansong opera Capriccio is not especially well represented in the catalogue; of the 22 complete recordings listed in the CLOR catalogue, only around a dozen have ever been available on CD and the rest were on video. Of those CD issues, several are no longer available and only three are studio recordings; two are radio broadcasts and the remainder are live or live composite stage performances. I consider here ten recordings, including all three of those studio accounts. The libretto was based on an original concept by Stefan Zweig, who had fled to the USA after the rise of the Nazis and committed suicide earlier in the year of the opera’s premiere, 1942. It was further developed by his successor as Strauss’ librettist, Josef Gregor, then Strauss himself took it over before passing it to his conductor friend Clemens Krauss – incidentally, possessor of one of the most blatant comb-overs in history - who completed it with continued input from the composer. The text is witty and more enjoyable if the libretto is to hand or you speak German. Like Strauss’ domestic comedy Intermezzo, Capriccio is wordy and conversational, but its intellectual and philosophical content is certainly higher and couched in some of the most sublime music Strauss ever penned. As a result, it is more popular and frequently performed than other of his late works. It is a vehicle for a supreme singer-actress with a creamy voice and a gift for enlivening text; noted performers who made recordings include Krauss’ second wife, Viorica Ursuleac, Lisa Della Casa, Elisabeth Schwarzkopf, Gundula Janowitz, Kiri Te Kanawa and, more recently, Renée Fleming. -

Decca Discography
DECCA DISCOGRAPHY >>V VIENNA, Austria, Germany, Hungary, etc. The Vienna Philharmonic was the jewel in Decca’s crown, particularly from 1956 when the engineers adopted the Sofiensaal as their favoured studio. The contract with the orchestra was secured partly by cultivating various chamber ensembles drawn from its membership. Vienna was favoured for symphonic cycles, particularly in the mid-1960s, and for German opera and operetta, including Strausses of all varieties and Solti’s “Ring” (1958-65), as well as Mackerras’s Janá ček (1976-82). Karajan recorded intermittently for Decca with the VPO from 1959-78. But apart from the New Year concerts, resumed in 2008, recording with the VPO ceased in 1998. Outside the capital there were various sessions in Salzburg from 1984-99. Germany was largely left to Decca’s partner Telefunken, though it was so overshadowed by Deutsche Grammophon and EMI Electrola that few of its products were marketed in the UK, with even those soon relegated to a cheap label. It later signed Harnoncourt and eventually became part of the competition, joining Warner Classics in 1990. Decca did venture to Bayreuth in 1951, ’53 and ’55 but wrecking tactics by Walter Legge blocked the release of several recordings for half a century. The Stuttgart Chamber Orchestra’s sessions moved from Geneva to its home town in 1963 and continued there until 1985. The exiled Philharmonia Hungarica recorded in West Germany from 1969-75. There were a few engagements with the Bavarian Radio in Munich from 1977- 82, but the first substantial contract with a German symphony orchestra did not come until 1982.