Die Geschwister Scholl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Explo R Ation S in a R C Hitecture
E TABLE OF CONTENTS ExploRatIONS XPLO In ARCHITECTURE 4 ColopHON +4 RESEARCH ENVIRONMENTS* 6 ACKNOWLEDGMENTS 8 INTRODUCTION Reto Geiser C A METHODOLOGY 12 PERFORMATIVE MODERNITIES: REM KOOLHAAS’S DIDACTICS B NETWORKS DELIRIOUS NEW YORK AS INDUCTIVE RESEARCH C DIDACTICS 122 NOTES ON THE ANALYSIS OF FORM: Deane Simpson R D TECHNOLOGY 14 STOP MAKING SENSE Angelus Eisinger CHRISTOPHER ALEXANDER AND THE LANGUAGE OF PATTERNS Andri Gerber 26 ALTERNATIVE EDUCATIONAL PROGRAMS IN AT ARCHITECTURE: THE INSTITUTE FOR 124 UNDERSTANDING BY DESIGN: THE SYNTHETIC ARCHITECTURE AND URBAN STUDIES Kim Förster APPROACH TO INTELLIGENCE Daniel Bisig, Rolf Pfeifer 134 THE CITY AS ARCHITECTURE: ALDO ROSSI’S I DIDACTIC LEGACY Filip Geerts +4 RESEARCH ENVIRONMENTS* ON STUDIO CASE STUDIES 136 EXPLORING UNCOMMON TERRITORIES: A A SYNTHETIC APPROACH TO TEACHING 54 LAPA Laboratoire de la production d’architecture [EPFL] PLATZHALTER METHODOLOGY ARCHITECTURE Dieter Dietz PLATZHALTER 141 ALICE 98 MAS UD Master of Advanced Studies in Urban Design [ETHZ] S 34 A DISCOURS ON METHOD (FOR THE PROPER Atelier de la conception de l’espace EPFL 141 ALICE Atelier de la conception de l’espace [EPFL] CONDUCT OF REASON AND THE SEARCH FOR 158 STRUCTURE AND CONTENT FOR THE HUMAN 182 DFAB Architecture and Digital Fabrication [ETHZ] EFFIcacIty IN DESIGN) Sanford Kwinter ENVIRONMENT: HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG I 48 THE INVENTION OF THE URBAN RESEARCH STUDIO: ULM, 1953–1968 Tilo Richter A N ROBERT VENTURI, DENISE SCOTT BROWN, AND STEVEN IZENOUR’S LEARNING FROM LAS VEGAS, 1972 Martino Stierli -

The White Rose's Resistance to Nazism
Western Oregon University Digital Commons@WOU Student Theses, Papers and Projects (History) Department of History 2017 The White Rose’s Resistance to Nazism: The Influence of Friedrich Nietzsche Katilyn R. Kirkman Western Oregon University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.wou.edu/his Part of the European History Commons Recommended Citation Kirkman, Katilyn R., "The White Rose’s Resistance to Nazism: The nflueI nce of Friedrich Nietzsche" (2017). Student Theses, Papers and Projects (History). 65. https://digitalcommons.wou.edu/his/65 This Paper is brought to you for free and open access by the Department of History at Digital Commons@WOU. It has been accepted for inclusion in Student Theses, Papers and Projects (History) by an authorized administrator of Digital Commons@WOU. For more information, please contact [email protected]. The White Rose’s Resistance to Nazism: The Influence of Friedrich Nietzsche Katilyn Kirkman History 499, Senior Seminar Primary Reader: Professor David Doellinger Secondary Reader: Professor Patricia Goldsworthy-Bishop Spring 2017 The White Rose was a non-violent resistance organization that was run by students and a professor from Ludwig Maximilian University of Munich (LMU) that was active from 1942- 1943. The organization anonymously distributed anti-Nazi leaflets and tagged public places with anti-Nazi graffiti in response to Hitler’s anti-Semitic actions. The two main members were Hans and Sophie Scholl because Hans founded the organization and Sophie ran the operations of the organization, quickly becoming one of the leaders of the organization. By reading and discussing the works of Friedrich Nietzsche, members of the White Rose, particularly Hans and Sophie Scholl, solidifying their commitment to opposing Nazism, including their belief that Germans could no longer ignore the crimes of the Nazi State. -

Lycurgus in Leaflets and Lectures: the Weiße Rose and Classics at Munich University, 1941–45
Lycurgus in Leaflets and Lectures: The Weiße Rose and Classics at Munich University, 1941–45 NIKLAS HOLZBERG The main building of the university at which I used to teach is situated in the heart of Munich, and the square on which it stands—Geschwister-Scholl-Platz—is named after the two best-known members of the Weiße Rose, or “White Rose,” a small group of men and women united in their re- sistance to Hitler.1 On February 18, 1943, at about 11 am, Sophie Scholl and her brother Hans, both students at the university, were observed by the janitor in the central hall as they sent fluttering down from the upper floor the rest of the leaflets they had just set out on the steps of the main stair- case and on the windowsills. The man detained them and took them to the rector, who then arranged for them to be handed over to the Gestapo as swiftly as possible. Taken to the Gestapo’s Munich headquarters, they underwent several sessions of intensive questioning and—together with another member of their group, Christoph Probst, who was arrested on February 19—they were formally charged on February 21 with having committed “treasonable acts likely to ad- vance the enemy cause” and with conspiring to commit “high treason and demoralization of the troops.”2 On the morning of the following day, the Volksgerichtshof, its pre- siding judge Roland Freisler having journeyed from Berlin to Munich for the occasion, sentenced them to death. That same afternoon at 5pm—only four days after the first ar- rests—they were guillotined. -

Archiv - Findmittel Online
- Archiv - Findmittel online Bestand: ED 474 Aicher-Scholl, Inge © Institut für Zeitgeschichte - Archiv - http://www.ifz-muenchen.de/archiv/ed_0474.pdf Bestand Nachlaß Inge Aicher-Scholl Signatur ED 474 Zum Bestand Institut für Zeitgeschichte München - Berlin - Archiv - Nachlaß Inge Aicher-Scholl (IfZ-Signatur ED 474) Vorläufiges Findbuch (Stand: Oktober 2005) Der Nachlaß der Pädagogin und Publizistin Inge Aicher-Scholl (1917-1998) beinhaltet umfangreiche Unterlagen und Dokumente aus dem familiären Umfeld, so insbesondere umfangreiche Korrespondenzen der Geschwister Scholl, zum Widerstandskreis "Weiße Rose", zu dessen Rezeptionsgeschichte nach 1945 und zur Friedens- und Umweltbewegung der Bundesrepublik Deutschland einschließlich einer umfangreichen Bibliothek. In Verbindung mit der Sammlung Hellmuth Auerbach und der Sammlung Ricarda Huch liegt damit im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte der eigentlich zentrale und sicherlich umfangreichste Bestand zur Geschichte der "Weißen Rose" vor. Erschließung, Verzeichnung und Sicherheitsverfilmung des Bestandes waren mit einem erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. Mit Ausnahme der noch zu beendenden Einarbeitung der umfangreichen Bilddokumente ist dieser Bestand damit benutzbar und mittels des hier vorliegenden, vorläufigen Findbuches zu erschließen. Inhaltsverzeichnis: 1. Alben, Ausweise, Zeugnisse 1.1. Aufzeichnungen und Skizzen von Inge Scholl, Sophie Scholl, Werner Scholl (Band 1) 1.2. Skizzen, Aquarelle, Manuskripte, Reiseaufzeichnungen von Inge Scholl, Hans Scholl und Otl Aicher (Band 2) 1.3. Zeugnisse, Ausweise, Behördenbescheinigungen etc. für Hans Scholl, Inge Scholl, Sophie Scholl, Werner Scholl und Otl Aicher (Band 3) 2. Korrespondenz Magdalene und Robert Scholl 2.1. Briefe der Eltern Müller an ihre Tochter Magdalene, verh. Scholl (Band Institut für4) Zeitgeschichte München - Berlin © Institut für Zeitgeschichte - Archiv - Seite 1 Seite 2 von 813 © Institut für Zeitgeschichte - Archiv - http://www.ifz-muenchen.de/archiv/ed_0474.pdf Bestand Nachlaß Inge Aicher-Scholl Signatur ED 474 2.2. -
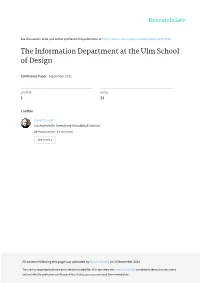
The Information Department at the Ulm School of Design
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/269574636 The Information Department at the Ulm School of Design Conference Paper · September 2012 CITATION READS 1 31 1 author: David Oswald Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd 20 PUBLICATIONS 17 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by David Oswald on 15 December 2014. The user has requested enhancement of the downloaded file. All in-text references underlined in blue are added to the original document and are linked to publications on ResearchGate, letting you access and read them immediately. The Information Department at the Ulm School of Design OSWALD, David; Prof. | HTW Berlin University of Applied Science, Germany HfG Ulm, information department, design education, language, communication Ulm is known for its educational model, particularly for product design and visual communication. Yet the school's smallest department — Information — has hardly been discussed. It can be considered a leftover of an initially planned political school. However, it represents the will to integrate all aspects of modern life into one school. Bill tried to push the department into advertisement, but it was Bense who directed it towards information theory. 1. Introduction The Ulm School of Design (Hochschule für Gestaltung, HfG) has been widely acknowledged for its pioneering model of design education, and has influenced design departments in many parts of the world. Today, the HfG's most renowned departments are product design, and visual communication — generally the predominant disciplines of design and also big departments in Ulm. It seems only natural that until today, the smallest department of the HfG is hardly perceived at all, and has only been covered marginally in literature: the Information Department. -

“White Rose” (January 1943) by Offering Active Political
Volume 7. Nazi Germany, 1933-1945 The Fifth Broadsheet of the “White Rose” (January 1943) By offering active political resistance to the Nazi regime, the Munich student group known as the “White Rose” earned a special place in the history of Germany’s youth opposition. No doubt the best-known members of the group were siblings Hans (1918-1943) and Sophie Scholl (1921- 1943), both of whom had supported the Nazi regime early on but eventually came to oppose it. Information about the government’s crimes – the euthanasia program and conditions on the Eastern Front, for example – hastened their move toward resistance. In addition to the Scholls, the core group consisted of Hans's friends and fellow students Alexander Schmorell (1917- 1943), Christoph Probst (1919-1943), and Willi Graf (1918-1943). Professor Kurt Huber (1893- 1943) joined the “White Rose” later on. In 1942 and 1943, group members distributed six broadsheets in which they appealed to the public’s sense of moral duty, called for active resistance to the Nazi dictatorship, and demanded an end to the war. Whereas their first four broadsheets only circulated within a small group of mostly Munich-based academics, the fifth one (see below) was distributed in thousands of copies and found its way into several cities in southern Germany. Written by Hans Scholl, Schmorell, and Probst, and addressed to all Germans, it warns that complicity in Nazi crimes could only be avoided by active resistance. When Sophie Scholl went to distribute the group’s sixth and final broadsheet at Ludwig Maximilians University on February 18, 1943, she was spotted by the school’s janitor, who informed the authorities. -

Readers Theater. the White Rose
www.wsherc.org Lesson 10: Readers Theater. The White Rose. by Josephine Cripps, Teacher, Summit K-12 School, Seattle 2008 The White Rose: A True Story of Freedom in Nazi Germany By Josephine Cripps CAST Sophie Scholl Gestapo Agent #1 Inge Scholl Gestapo Agent #2 Elisabeth Scholl Alex Schmorell Hans Scholl Christoph Probst Werner Scholl Willi Graff Robert Scholl/Father Jakob Schmid Maria Scholl/Mother Gestapo Agent Robert Mohr Narrators (13 total) Gestapo Agent Mullen Frau Kruger Gestapo Agent #3 Luise Nathan Judge Reisler 2 THE WHITE ROSE: A TRUE STORY OF FREEDOM IN NAZI GERMANY PART ONE SOPHIE SCHOLL (age 12), INGE SCHOLL (age 15), ELISABETH SCHOLL (age 9), HANS SCHOLL (age 16), WERNER SCHOLL (age 7), FATHER, MOTHER, and NARRATOR 1 enter as Curtain rises. NARRATOR 1: The year is 1934. The place, Ulm, Germany. Ulm is a bustling town on the Danube River. Sophie Scholl lives there, in a fine old house with her parents and her four brothers and sisters—Hans, Inge, Elisabeth, and Werner. They step forward as their names are called. SOPHIE My life is mostly school. But every afternoon, as soon as the bell rings, I hop on my bike and ride through the narrow streets down to the Danube. It’s beautiful in the spring. Irises line the river bank, and I cycle so fast along the mossy path, I feel absolutely free! On weekends, when I really am free, I bicycle with my brother Hans up into the mountains. HANS We pack cheese sandwiches, and for two whole days we hike through the alpine forest. -

The White Rose Resistance Movement and the Analysis of Their
The White Rose Resistance Movement & The Analysis of Their Six Leaflets By Jessica Lewis I have neither given or received nor have I tolerated others use of unauthorized aid. Lewis 1 Abstract The story of the White Rose resistance movement is not generally known in the narrative of Nazi Germany, it falls within the many other resistance movements that appeared to be more effective than the White Rose. Yet, many scholars overlook that the leaflets the White Rose wrote played a role in the resistance to the Nazi government. My paper addresses the White Rose resistance movement during the Third Reich and how their resistance was exemplified in their leaflets through their discussion about belief in God and hope for a better Germany. In my paper I will do a literary analysis of the six White Rose leaflets to highlight Christian religious themes. I will examine how the religious language in the leaflets articulates the political goals of the White Rose movement and creates a call to action for Germans. Closely examining the leaflets and understanding the members of the White Rose that the wrote them sheds new light on the rarely acknowledged works of the White Rose resistance movement. Introduction Political persuasion often comes with religious undertones. The story of the Third Reich is an example of this phenomenon. In the face of the devastation wrought by World War I and the penalties against Germany issued in the Treaty of Versailles, Germans struggled to rebuild their lives and their country. The Treaty threatened to divide the German people, creating conditions of poverty and large-scale starvation particularly for some marginalized groups like the Jews. -

Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies Legacy Theses 2012 Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film Fell, Hannelore E. Fell, H. E. (2012). Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/13369 http://hdl.handle.net/1880/50001 master thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film by Hannelore E. Fell A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS DEPARTMENT OF GERMANIC, SLAVIC AND EAST ASIAN STUDIES CALGARY, ALBERTA SEPTEMBER, 2012 © Hannelore E. Fell 2012 The author of this thesis has granted the University of Calgary a non-exclusive license to reproduce and distribute copies of this thesis to users of the University of Calgary Archives. Copyright remains with the author. Theses and dissertations available in the University of Calgary Institutional Repository are solely for the purpose of private study and research. They may not be copied or reproduced, except as permitted by copyright laws, without written authority of the copyright owner. Any commercial use or re-publication is strictly prohibited. -

C Given by Beate Ruhla Von Oppen at St. John's
. ..,. .. ,.. -D.t~ This mat · I . C ena may be prot opyright law (Title 11 u s·~a by · · Oda) STUDERT REBELLION .AID TSE NAZIS Two lee tu ... es given by Beate Ruhla von Oppen at St. John's College, Annapolis, on 18 and 25 Feb ~a ry 1972 STUDENT REBELLION AND THE NAZIS Two lectures·. given by·.-Beat~· Ruhm von Oppen at st. JbhnAs College, Annapolis, 18 and 25 February, 1972 I. The Rise and Rule of Hitler If someone were to ask why I am giving two lectures in a row instead of the traditional single lecture, I might give as reason an experience I had about a couple of years agoo It was at a university specializing in theology -- one that had theology as one of ·its three main divisions. It was in May 1970, just after the American incursion into Cam bodia. There was student unrest all over the country and talk of "revolution." There was something like that going on at that university on the day I spoke there. My subject was the relationship of the Nazis and the churches, a subject, I had been ~old~ of spec~al interest to the people there. But perhaps not on that disturbed .day. The question period was dismal, discussion i~possible. One questioner got up and asked1 ""What about studen_t protest?•• It was not a sly question; it was quite innocent and.proceeded from pure ignorance, such ignoranc·e as I was totally unprepared for .in a middle-aged questioner. So I gave' a brief and brutal answer on the history of stu~ent prot~st in Germanya that loud and massive and effective protest existed in the period before the Nazis came to power and the protesters ·were Nazis, or at any rate mil.itant natioJ'.lalists, who exercised considerable pres sure· on the academic establishment of the Weimar Republic - and even more, incidentally, in the Austrian Republicr that -2- once the Nazis were in power, there was hardly any open pro test a and that the first three of the famous group of Munich students who protested in pubiic against the Nazi regime and its war, were dead within a few days .of being caught, in 194Ja the rest following a few months later. -

Criticism of the Bauhaus Concept in the Ulm School of Design
Criticism of the Bauhaus Concept in the Ulm School of Design Keisuke Takayasu The Second Asian Conference of Design History and Theory —Design Education beyond Boundaries— ACDHT 2017 TOKYO 1-2 September 2017 Tsuda University Criticism of the Bauhaus Concept in the Ulm School of Design Keisuke Takayasu Osaka University [email protected] 9 Abstract In 1950, the Swiss designer Max Bill was invited to assist Inge Scholl in planning a new school of design in Ulm similar to the Bauhaus because of Bill’s experience at the Bauhaus and the modernist works he had developed from the 1930s to the 1940s in Switzerland. When the Ulm School of Design provisionally began its design courses in 1953, Max Bill became its first rector. When the new school building was officially opened on 2 October 1955, the school was expect- ed to be a successor to the Bauhaus school. However, in 1957, a conflict over educational principles became unavoidable; younger teachers, even Otl Aicher, the co-founder of the school, complained that Bill placed too much weight on art in the design education. In 1957, Bill left the school. New leaders such as Tomás Maldonado opposed certain Bauhaus concepts because they tended to believe more in the te- nets of traditional art training. Therefore, in accordance with the complex requirements of the industrial society, younger lecturers encouraged a design education based on the latest scientific knowledge. A similar reorientation was also seen in the Bauhaus. Hannes Meyer, the second rector, had attempted to exclude purpose-free art training so as to develop practical instruction using scientific approaches. -

German Resistance Against National Socialism and Its Legacies
John J. Michalczyk, ed.. Confront! Resistance in Nazi Germany. New York: Peter Lang, 2004. xiv + 251 pp. $39.95, paper, ISBN 978-0-8204-6317-9. Reviewed by Doris L. Bergen Published on H-German (August, 2006) These three books approach the topic of resis‐ before and during World War II. Informed by tance in National Socialist Germany in different decades of research and personal connections ways, but all raise questions familiar to historians with Stauffenberg's family and friends, this book of modern Germany and relevant to anyone con‐ is the product of a mature scholar at the peak of cerned with why and how individuals oppose his powers. It is at the same time a moving tribute state-sponsored violence. What enabled some to an extraordinary man whose intelligence, no‐ people not only to develop a critical stance to‐ bility of spirit and ability to withstand pain set ward the Nazi regime but to risk their lives to him apart from his peers long before his most fa‐ fight against it? How should such heroes be re‐ mous act of defiance against Nazi evil. membered and commemorated? What particular Tatjana Blaha's exploration of Willi Graf and challenges face scholars who try to write the his‐ his involvement with the "White Rose" in Munich tory of resistance? marks the beginning, rather than the culmination Peter Hoffmann's "family history" of Claus, of its author's career. A revised Ph.D. dissertation, Count Stauffenberg, is the second edition of his Blaha's study seeks to correct the widespread no‐ book Stauffenberg (1995), originally published in tion that the White Rose was essentially the work German in 1992 under the title Claus Schenk Graf of Hans and Sophie Scholl.