6880229525.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
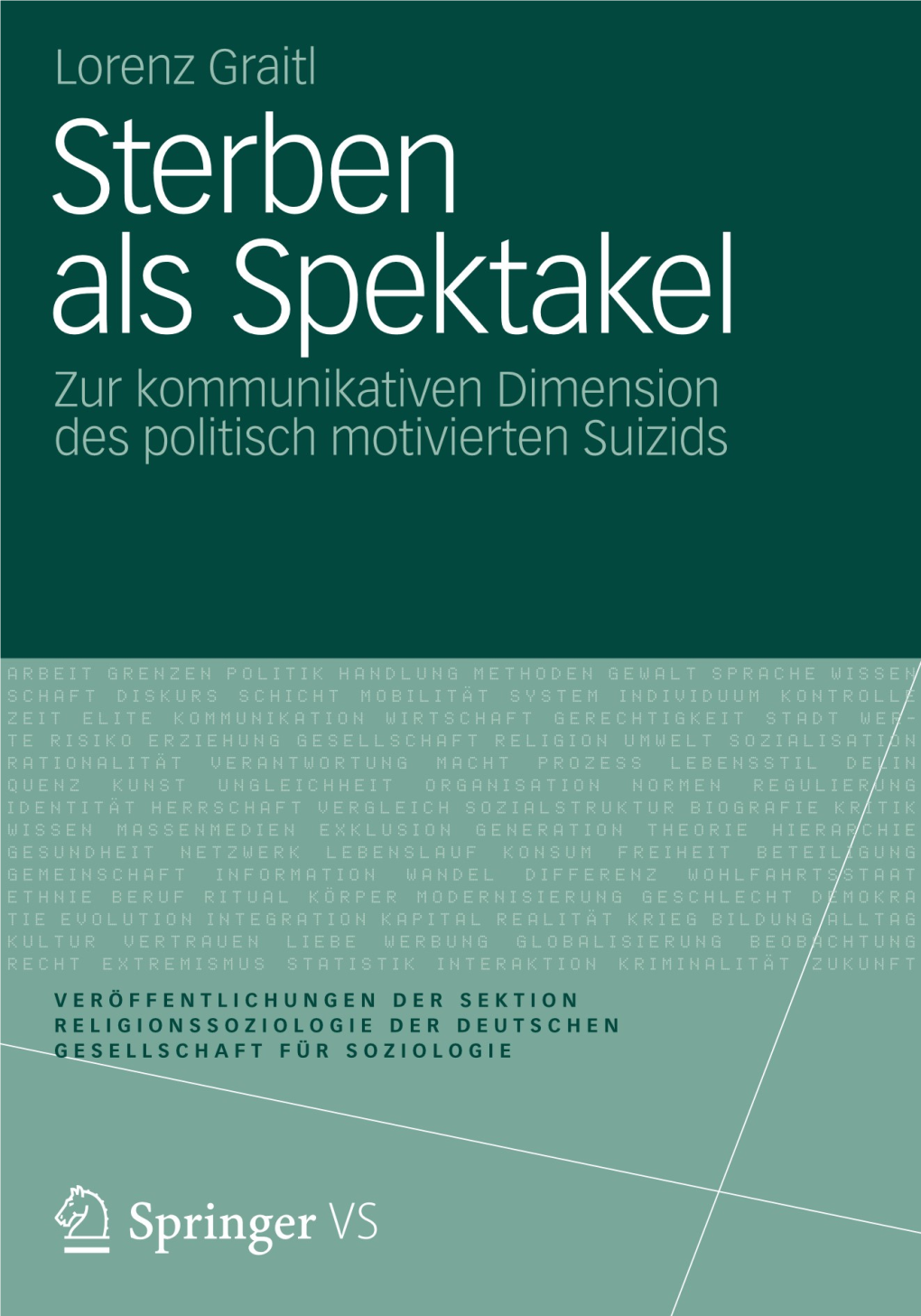
Load more
Recommended publications
-

Country of Origin Information Report Sri Lanka May 2007
COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION REPORT SRI LANKA 11 MAY 2007 Border & Immigration Agency COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION SERVICE 11 MAY 2007 SRI LANKA Contents PREFACE Latest News EVENTS IN SRI LANKA, FROM 1 APRIL 2007 TO 30 APRIL 2007 REPORTS ON SRI LANKA PUBLISHED OR ACCESSED BETWEEN 1 AND 30 APRIL 2007 Paragraphs Background Information 1. GEOGRAPHY........................................................................................ 1.01 Map ................................................................................................ 1.06 2. ECONOMY............................................................................................ 2.01 3. HISTORY.............................................................................................. 3.01 The Internal conflict and the peace process.............................. 3.13 4. RECENT DEVELOPMENTS...................................................................... 4.01 Useful sources.............................................................................. 4.21 5. CONSTITUTION..................................................................................... 5.01 6. POLITICAL SYSTEM .............................................................................. 6.01 Human Rights 7. INTRODUCTION..................................................................................... 7.01 8. SECURITY FORCES............................................................................... 8.01 Police............................................................................................ -

Report of the OHCHR Investigation on Sri Lanka (OISL)* **
A/HRC/30/CRP.2 Advance Version Distr.: Restricted 16 September 2015 English only Human Rights Council Thirtieth session Agenda item 2 Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General Report of the OHCHR Investigation on Sri Lanka (OISL)* ** * Reproduced as received ** The information contained in this document should be read in conjunction with the report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights- Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka (A/HRC/30/61). A/HRC/30/CRP.2 Contents Paragraphs Page Part 1 I. Introduction ............................................................................................................. 1–13 5 II. Establishment of the OHCHR Investigation on Sri Lanka (OISL), mandate and methodology ............................................................................................................. 14–46 7 III. Contextual background ........................................................................................... 47–103 12 IV. Overview of Government, LTTE and other armed groups...................................... 104–170 22 V. Legal framework ..................................................................................................... 171–208 36 Part 2– Thematic Chapters VI. Unlawful killings ..................................................................................................... 209–325 47 VII. Violations related to the -

Report of the Secretary-General's Panel Of
REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL’S PANEL OF EXPERTS ON ACCOUNTABILITY IN SRI LANKA 31 March 2011 REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL’S PANEL OF EXPERTS ON ACCOUNTABILITY IN SRI LANKA Executive Summary On 22 June 2010, the Secretary-General announced the appointment of a Panel of Experts to advise him on the implementation of the joint commitment included in the statement issued by the President of Sri Lanka and the Secretary-General at the conclusion of the Secretary-General’s visit to Sri Lanka on 23 March 2009. In the Joint Statement, the Secretary-General “underlined the importance of an accountability process”, and the Government of Sri Lanka agreed that it “will take measures to address those grievances”. The Panel’s mandate is to advise the Secretary- General regarding the modalities, applicable international standards and comparative experience relevant to an accountability process, having regard to the nature and scope of alleged violations of international humanitarian and human rights law during the final stages of the armed conflict in Sri Lanka. The Secretary-General appointed as members of the Panel Marzuki Darusman (Indonesia), Chair; Steven Ratner (United States); and Yasmin Sooka (South Africa). The Panel formally commenced its work on 16 September 2010 and was assisted throughout by a secretariat. Framework for the Panel’s work In order to understand the accountability obligations arising from the last stages of the war, the Panel undertook an assessment of the “nature and scope of alleged violations” as required by its Terms of Reference. The Panel’s mandate however does not extend to fact- finding or investigation. -

Tamil Eelam Struggle and Its Lessons
Tamil Eelam Struggle and its Lessons [From the Indian revolutionary magazine, People‟s Truth, #7, Sept. 2009, pp. 20-30 & p. 12.] By Ravindran ON 18th May 2009, the President of Sri Lanka Mahinda Rajapakshe declared that the three decades of war against the LTTE has come to an end. He declared that the Sri Lankan army won a final victory against the Tigers. The Sri Lankan army and the government also claimed that the LTTE leader, Prabhakaran, and many of his lieutenants were killed in the battle and showed the photographs of the dead body of Prabhakaran in the electronic and print media. On 20th, the Sri Lankan government declared a national holiday to „celebrate‟ this „victory‟. The timing of this declaration created suspicion amongst the people who are closely watching the developments in Sri Lanka, in India and all over the world. It appears that the Sri Lankan government deliberately spread this news after the announcement of parliament election results in India. While the Sri Lankan government and the UPA government led by the Congress party celebrated this, millions of sympathizers/supporters of Tigers and Eelam struggle all over the world were shocked in disbelief that the struggle for a separate Tamil Eelam would come to such an end. Within 24 hours, the Tigers rubbished the Srilankan government‟s claim and published that the Tiger‟s chief and many leaders of the LTTE are safe and the struggle for Tamil Eelam would continue until realizing its goal of achieving a separate homeland for the Eelam people. Tamils, all over the world held protest demonstrations and in Tamil Nadu (TN), some violent incidents also took place. -

Geneva's Human Rights Chameleons
Geneva’s Human Rights Chameleons: Geneva’s Human Rights Chameleons: Who Are They, How Do They Operate? 2 Geneva’s Human Rights Chameleons: Who Are They, How Do They Operate? Geneva’s Human Rights Chameleons: Geneva’s Human Rights Chameleons: Who Are They, How Do They Operate? First Published: February 2014 Published by: Research & Monitoring Division Department of Government Information, Sri Lanka Published by: Research & Monitoring Division Department of Government Information, Sri Lanka Design & Printing Layout by Media Tec Advertising & Printing Services Printed by: Department of Government Printing, Sri Lanka. 4 Who Are They, How Do They Operate? Contents Introduction 7 The Context 10 Background 15 LTTE’s New Networks 20 The Future 36 Conclusion 40 5 Geneva’s Human Rights Chameleons: Evolution of Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) International Network Source from: Ministry of Defence and Urban Development http://www.defence.lk/warcrimes/LTTE_international_network.html 6 Geneva’s Human Rights Chameleons: Who Are They, How Do They Operate? Introduction: The Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in Sri Lanka was militarily dismantled in the May of 2009. To survive and revive, the LTTE’s international network that supported the three-decade terrorist and guerrilla campaign was forced to transform. Throughout largely in the West, conducted a relentless campaign of propaganda the conflict years in Sri Lanka, the LTTE network operating overseas, and misinformation against the Sri Lankan state, and was involved in fundraising and the procurement and shipping of weapons and equipment for the terrorist movement in Sri Lanka. Today, the very same individuals and entities that supported the ruthless killing, maiming and injuring of civilians and security forces personnel in Sri Lanka, have reinvented themselves. -

Sri Lanka Assessment
SRI LANKA COUNTRY REPORT October 2004 Country Information & Policy Unit IMMIGRATION & NATIONALITY DIRECTORATE HOME OFFICE, UNITED KINGDOM Sri Lanka October 2004 CONTENTS 1. Scope of Document 1.1 - 1.7 2. Geography 2.1 - 2.4 3. Economy 3.1 - 3.3 4. History 4.1 – 4.139 - Independence to 1994 4.1 - 4.10 - 1994 to the present 4.11 – 4.81 - The Peace Process January 2000 – August 4.82 – 4.139 2004 5. State Structures 5.1 - 5.47 The Constitution 5.1 - 5.3 - Citizenship and Nationality 5.4 - 5.6 Political System 5.7. – 5.9 Judiciary 5.10 - 5.13 Legal Rights/Detention 5.14 - 5.21 - Death penalty 5.22 – 5.23 Internal Security 5.24 - 5.26 Prisons and Prison Conditions 5.27 - 5.29 Military Service 5.30 - 5.33 Medical Services 5.34 - 5.46 Educational System 5.47 6. Human Rights 6.1 - 6.232 6.A Human Rights Issues 6.1 - 6.73 Overview 6.1 - 6.8 Freedom of Speech and the Media 6.9 - 6.22 - Treatment of journalists 6.14 - 6.22 Freedom of Religion 6.23 - 6.35 - Introduction 6.23 – 6.27 - Buddhists 6.28 – 6.29 - Hindus 6.30 - Muslims 6.30 - 6.33 - Christians 6.34 – 6.35 Freedom of Assembly and Association 6.36 – 6.40 Employment Rights 6.41 - 6.50 Freedom of Movement 6.51 - 6.73 - Immigrants and Emigrants Act 6.68 - 6.73 6.B Human Rights - Specific Groups 6.74 - 6.182 Ethnic Groups 6.74 - 6.149 - Tamils and general Human Rights Issues 6.74 - 6.148 - Arrests of Tamils 6.78 - 6.86 - Disappearances and Extra-judicial 6.87 – 6.95 executions - Torture 6.96 – 6.104 - Government Action 6.105 – 6.124 - Prosecution of security force personnel 6.125 – 6.142 - Up-country -

Sri Lanka Tamil Separatism CPIN V6.0
Country Policy and Information Note Sri Lanka: Tamil Separatism Version 6.0 May 2020 Preface Purpose This note provides country of origin information (COI) and analysis of COI for use by Home Office decision makers handling particular types of protection and human rights claims (as set out in the Introduction section). It is not intended to be an exhaustive survey of a particular subject or theme. It is split into two main sections: (1) analysis and assessment of COI and other evidence; and (2) COI. These are explained in more detail below. Assessment This section analyses the evidence relevant to this note – i.e. the COI section; refugee/human rights laws and policies; and applicable caselaw – by describing this and its inter-relationships, and provides an assessment of, in general, whether one or more of the following applies: • A person is reasonably likely to face a real risk of persecution or serious harm • The general humanitarian situation is so severe as to breach Article 15(b) of European Council Directive 2004/83/EC (the Qualification Directive) / Article 3 of the European Convention on Human Rights as transposed in paragraph 339C and 339CA(iii) of the Immigration Rules • The security situation presents a real risk to a civilian’s life or person such that it would breach Article 15(c) of the Qualification Directive as transposed in paragraph 339C and 339CA(iv) of the Immigration Rules • A person is able to obtain protection from the state (or quasi state bodies) • A person is reasonably able to relocate within a country or territory • A claim is likely to justify granting asylum, humanitarian protection or other form of leave, and • If a claim is refused, it is likely or unlikely to be certifiable as ‘clearly unfounded’ under section 94 of the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. -

WHY INSURGENTS NEGOTIATE by Colin P
THROWING IN THE TOWEL: WHY INSURGENTS NEGOTIATE By Colin P. Clarke B.A., Loyola University Maryland, 2002 M.S., New York University, 2007 Submitted to the Graduate Faculty of The University of Pittsburgh in partial fulfillment Of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2012 i UNIVERSITY OF PITTSBURGH GRADUATE SCHOOL OF PUBLIC AND INTERNATIONAL AFFAIRS This dissertation was presented By Colin P. Clarke It was defended on 18 October 2012 and approved by Professor Dennis M. Gormley, Senior Lecturer, University of Pittsburgh (GSPIA) Dr. Donald M. Goldstein, Professor Emeritus, University of Pittsburgh (GSPIA) Dr. Forrest E. Morgan, Senior Political Scientist, RAND Corporation Dr. Phil Williams, Professor/Director of Ridgway Center, University of Pittsburgh (GSPIA) ii THROWING IN THE TOWEL: WHY INSURGENTS NEGOTIATE Colin P. Clarke, B.A., Loyola University (’02); M.S., New York University (’07) University of Pittsburgh, 2012 Copyright © by Colin P. Clarke 2012 iii TABLE OF CONTENTS 1.0 INTRODUCTION ........................................................................................................ 1 1.1 PURPOSE ............................................................................................................. 1 1.2 METHOD ............................................................................................................. 4 1.2.1 Case Selection ................................................................................................... 4 1.2.2 Analytic Framework....................................................................................... -

Sri Lanka – LTTE – Refugee Camps – Exit Procedures – Tamils – State Protection
Refugee Review Tribunal AUSTRALIA RRT RESEARCH RESPONSE Research Response Number: LKA17724 Country: Sri Lanka Date: 20 December 2005 Keywords: Sri Lanka – LTTE – Refugee camps – Exit Procedures – Tamils – State Protection This response was prepared by the Country Research Section of the Refugee Review Tribunal (RRT) after researching publicly accessible information currently available to the RRT within time constraints. This response is not, and does not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. Questions 1. Where is the LTTE camp, Puthukudiyiruppa, Killinocchil? 2. What and where is Vanni? 3. What are the procedures before someone can leave Sri Lanka, e.g. obtaining a passport and visa, going through customs, etc? Are the passports of LTTE members/sympathisers impounded by the government? 4 - 6 Questions deleted 7. Is there meaningful protection by the Sri Lankan government for young Tamils from the LTTE (see Human rights ‘Living in Fear: Child Soldiers and the Tamil Tigers in Sri Lanka – but also provide other information if available.) 8. Question deleted 9. Please provide information about the LTTE, particularly in Puthukudiyiruppa, Killinocchil and Vanni. 10. Is there a ceasefire at present, and if so how is it holding up? 11. Does the LTTE press-gang people to work as labourers for them? 12. Does the Sri Lankan government respect Human Rights? Does it operate according to the Rule of law? 13. Is it a democratic country? 14. What percentage of the population in Colombo is of Tamil ethnicity? 15. Is Colombo LTTE controlled? RESPONSE 1. Where is the LTTE camp, Puthukudiyiruppa, Killinocchil? No references were found to a particular LTTE camp in Puthukkudiyiruppu. -

Conflict in Sri Lanka: Ground Realities
The Confl ict in Sri Lanka: Ground Realities Edited by Ana Pararajasingham International Federation of Tamils (IFT) Geneva – New York 1 The Confl ict in Sri Lanka: Ground Realities All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission of the International Federation of Tamils (IFT), 18 Rue des Paquis, 1201 Geneva, Switzerland. ISBN: 0-9775092-0-6 Published in Australia by: MV Publications for The South Asian Studies Centre P O Box 5317 Chullora NSW 2190 AUSTRALIA Published in Canada by: Canadian Multimedia Publishers for University Scholars CAMPUS Publications 1277 York Mills Road P O Box 33516 Don Mills, ON M3A 1Z0 CANADA December 2005 ii This Publication is dedicated to the memory of Maamanithar Joseph Pararajasingham “There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintop of our desires.” Nelson Mandela “States that want to oppress a people do so by breaking their political will to resist injustice. To do this, oppressing states kill a society’s intellectuals and journalists who speak for the rights of their people. They want the Tamils to be intellectually rudderless. It is easier to enslave a people who have lost their ability to understand the nature of their oppression.” Dharmeratnam Sivaram (who was himself shot dead on 28 April 2005) speaking at Memorial Meeting for Slain Batticaloa Journalist, Aiyathurai Nadesan on 7 August 2004 v vi Contents Introduction ..................................................................... -

Tamil Tigers Mckay Peck Utah Valley University
Tamil Tigers McKay Peck Utah Valley University This paper takes you through the rise and fall of one of the most powerful terrorist organizations to have ever been formed: The Tamil Tigers. The Tamil Tigers were based in Sri Lanka and owned their own army, navy, and air force. Their fierce leader (Velupillai Prabhakaran) had a goal to give his people independence, but his never ending lust for power would lead to the group's downfall. elupillai Prabhakaran, later referred to by his Tamil nickname “Thamby” (which means “Little Brother”), was born on November 26, 1954 in the small coastal village of Velvettithurai in Sri VLanka. He was the youngest of four children. In his younger years, he was described as a shy student. Even though his father hated the Tamil politics, Prabhakaran became involved in activism at a young age after becoming angered by what he saw as discrimination against the Tamil people by Sri Lanka’s majority Sinhalese population. In one of only a few known interviews, Prabhakaran stated he was influenced by the lives of two Indian leaders: Subhash Chandra Bose (1897-1945) and Bhagat Singh (1907-1931), both of whom took part in the armed struggle for independence against the British that lasted from 1857 until 1947. He was equally intrigued by the lives and works of Alexander the Great and Napoleon, stating that he had studied and read many books on the two leaders.1 His goal was to get Tamil Eelam recognized as a nation. To his enemies, 1. “Obituary: Velupillai Prabhakaran,” BBC News, modified May 2009, http://news. -
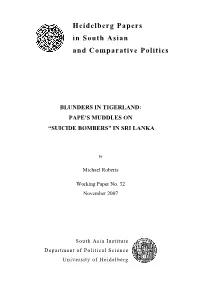
Michael Roberts Working Paper No. 32 November 2007
Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics BLUNDERS IN TIGERLAND: PAPE’S MUDDLES ON “SUICIDE BOMBERS” IN SRI LANKA by Michael Roberts Working Paper No. 32 November 2007 South Asia Institute Department of Political Science University of Heidelberg MICHAEL ROBERTS HEIDELBERG PAPERS IN SOUTH ASIAN AND COMPARATIVE POLITICS ISSN: 1617-5069 About HPSACP This occasional paper series is run by the Department of Political Science of the South Asia Institute at the University of Heidelberg. The main objective of the series is to publicise ongoing research on South Asian politics in the form of research papers, made accessible to the international community, policy makers and the general public. HPSACP is published only on the Internet. The papers are available in the electronic pdf-format and are designed to be downloaded at no cost to the user. The series draws on the research projects being conducted at the South Asia Institute in Heidelberg, senior seminars by visiting scholars and the world-wide network of South Asia scholarship. The opinions expressed in the series are those of the authors, and do not represent the views of the University of Heidelberg or the Editorial Staff. Potential authors should consult the style sheet and list of already published papers at the end of this article before making a submission. Editor Subrata K. Mitra Deputy Editors Clemens Spiess Malte Pehl Jivanta Schöttli Siegfried Wolf Editorial Assistant Anja Kluge Editorial Consultants Katharine Adeney Mike Enskat Alexander Fischer Karsten Frey Evelin Hust Karl-Heinz Krämer Apurba Kundu Peter Lehr Kenneth McPherson Marie-Thérèse O’Toole Matthias Paukert Christian Wagner Wolfgang-Peter Zingel HEIDELBERG PAPERS IN SOUTH ASIAN AND COMPARATIVE 2 POLITICS http://www.sai.uni-heidelberg.de/SAPOL/HPSACP.htm Working Paper No.