Magisterarbeit / Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tipsy Elves V. Ugly Christmas Sweater
Case 3:17-cv-00890-MMA-NLS Document 1 Filed 05/02/17 PageID.1 Page 1 of 14 1 SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP A Limited Liability Partnership 2 Including Professional Corporations MARTIN R. BADER, Cal. Bar No. 222865 3 WILLIAM J. BLONIGAN, Cal. Bar No. 250961 TRAVIS J. ANDERSON, Cal. Bar No. 265540 4 12275 El Camino Real, Suite 200 San Diego, California 92130-2006 5 Telephone: 858.720.8900 Facsimile: 858.509.3691 6 Attorneys for Plaintiff 7 8 UNITED STATES DISTRICT COURT 9 SOUTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA 10 11 Tipsy Elves LLC, Case No.: _________________________________'17CV0890 MMANLS 12 Plaintiff, COMPLAINT FOR: 13 v. (1) FEDERAL TRADEMARK 14 INFRINGEMENT (15 U.S.C. § 1114); Ugly Christmas Sweater, Inc. and (2) FALSE DESIGNATION OF 15 ORIGIN OR SPONSORSHIP AND UNFAIR COMPETITION (15 U.S.C. 16 DOES 1–10, § 1125(a)); (3) UNFAIR COMPETITION & 17 Defendants. FALSE ADVERTISING (CAL. BUS. & PROF. CODE §§ 17200 & 17500, 18 ET SEQ.); (4) COMMON LAW TRADEMARK 19 INFRINGEMENT; (5) CONTRIBUTORY 20 TRADEMARK INFRINGEMENT; AND 21 (6) VICARIOUS TRADEMARK INFRINGEMENT 22 23 Plaintiff Tipsy Elves LLC (“Tipsy Elves” or “Plaintiff”) alleges as follows in 24 this Complaint against Ugly Christmas Sweater, Inc. and DOES 1–10 (collectively 25 “Defendants”): 26 JURISDICTION AND VENUE 27 1. This is an action for infringement of a federally registered trademark in 28 violation of Section 32(1) of the Lanham Act (15 U.S.C. § 1114(1)), for unfair Case No. __________________________________ -1- Case 3:17-cv-00890-MMA-NLS Document 1 Filed 05/02/17 PageID.2 Page 2 of 14 1 competition and false designation of origin or sponsorship in violation of Section 2 43(a) of the Lanham Act (15 U.S.C. -
P Small and See a �Igger Communit
New toy hatches similar ‘must have’ fury Nineties parents were no much as 1,000 percent situation. The stuffed Heather stranger to the “hot toy” more than its purchase dolls were one of the most Harmon craze, after having lived price. popular toy fads of the Staff Reporter through “Elmo-mania” two Today, many of the parents decade, and at the toy’s years prior in 1996. There searching for a Hatchimal height in popularity, parents ne does not have were one millions units may have wanted Cabbage physically fought in stores, to look far to released during the holiday Patch Kids for themselves causing chaos over the find a frantic season, and at the end of in the 1980s, which put cherub-faced dolls. parent searching December the entire stock their parents in a similar The manufacturers of Ofor a Hatchimal for their has been sold-out. Due to Hatchimals have responded child for Christmas. The limited quantities of the to the limited supplies of toy is going for as much School board votes in product, stampedes and the toys and their resale as $500 on Ebay, and have fights broke out at retailers value. been seen on online local who sold the Elmos. The statement reads, swap social media sites for design for visitor stands Beanie babies “ This is a special $300, while they retail for hit the shelves in season and we don’t $59-$69. Heather Harmon 1995, and due to want anyone to be Staff Reporter Although the generation a particularly disappointed, nor of parents and the “hot clever marketing do we support uring their monthly board meeting, the toy of the season” may strategy, the inflated prices from Weatherford Public Schools Board of have changed over the stuffed animals non-authorized Education voted to approve an architect’s years, parents hunting for were highly resellers. -

Gender Match and the Gender Gap in Venture Capital Financing: Evidence from Shark Tank
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Jetter, Michael; Stockley, Kieran Working Paper Gender Match and the Gender Gap in Venture Capital Financing: Evidence from Shark Tank IZA Discussion Papers, No. 14069 Provided in Cooperation with: IZA – Institute of Labor Economics Suggested Citation: Jetter, Michael; Stockley, Kieran (2021) : Gender Match and the Gender Gap in Venture Capital Financing: Evidence from Shark Tank, IZA Discussion Papers, No. 14069, Institute of Labor Economics (IZA), Bonn This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/232821 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 14069 Gender Match and the Gender Gap in Venture Capital Financing: Evidence from Shark Tank Michael Jetter Kieran Stockley JANUARY 2021 DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. -

Alumni News, Winter 2019
WINTER 2019 IN THIS ISSUE GREETINGS FROM THE CHAIR Greetings From The Chair 1 We hope you had a joyous and peaceful holiday season. As we look to 2019, we are proud of what we accomplished in 2018, including: Alumni Spotlight 2 Alumni Moves and • Grew by 10%, now with 883 lawyers globally Notable Achievements 3 • Opened a Dallas office in April, now with 22 lawyers Ahead of the Curve 4 • Added 30 lateral partners, including a 7-lawyer NY real estate group • Elevated 16 attorneys to partnership in February In Memorium 5 • Achieved Mansfield Certification from Diversity Lab, one of only 27 firms • Launched new podcast series, Nota Bene, covering legal issues affecting Helping Clients Succeed 6 multinationals Upcoming Events 7 • Broadened innovative client solutions, such as our Gavelytics partnership We continue to be recognized for our growth, diversity and office-focused STATS AND FACTS achievements: • Ranked #55 in size among all U.S. law firms (up from #58) by The American Lawyer 883 • Recognized by Working Mother as one of the “Best Law firms for Women” Sheppard Mullin lawyers globally • Selected as a “California Powerhouse” by Law360 • Chicago, New York and San Diego/Del Mar offices selected as “Best Places to Work” Offices in 5 countries We are excited to launch a Clients First 2.0 initiative this year, underscoring our 16 commitment to client service as part of our strategic focus. We wish you a very Happy New Year and we look forward to catching up at alumni events and other New Lateral activities during the year. -

Inc. 5000 Profiles
REAL WISDOM of TALK OUR 2020 the CROWD Inc.’s favorite entrepreneurs offer the best of REAL TALK, their smartest advice on succeeding in the coming year. SPONSORED BY THE INC. 5000 HONOREES WHOSE PROFILES APPEAR IN THE FOLLOWING PAGES. When you speak to as many founders as Inc. does,does, you get expert insights into just about every issueissue crucial to building a breakout business. The most succesuccessfulssful of those folks can be found in Real Talk interviews, a showcase for hard-won wiwisdomsdom from people who have faced the punipunishingshing challenges of entrepreneentrepreneurshipurship and prevailed to become household namenames.s.• In the pagepagess that follow, you’ll find their their insights insights distilled distilled into into memorable memorable quotes quotes chosen chosen by our editors. You’ll also find profiles of ofa fewa few of ofour our 2020 2020 Inc. Inc. 5000 5000 honoree honorees,s, each one just a step away from that same kind of succesuccess.ss. In fact, don’t be surprisurprisedsed if you see one or two of them in these pagepagess next year.• Until then, it’s with their support that we’we’veve collected the best of this year’s Real Talk and prepresentsent it to you here. We hope you enjoy it—and that it offers just what you need to continue on the journey to your own seat at the Real Talk table. Inc.’s Real Talk video series features entre preneurial luminaries weighing in with advice and insights on everything from pitching investors to leading during a crisis. Watch them all at inc.com/ realtalk. -

Barbara Corcoran: a Shark’S Guide to Bouncing Back December 09, 2020 TRANSCRIPT
Barbara Corcoran: A Shark’s guide to bouncing back December 09, 2020 TRANSCRIPT SPEAKERS: Roger Hobby Barbara Corcoran Roger Hobby: Barbara, welcome. Barbara Corcoran: Thank you. ROGER: Welcome to everybody to the first ever Fidelity Rewards Event, and we’re very very fortunate to have Barbara Corcoran from The Corcoran Group here with us. I’ve had all sorts of wonderful people tell me that they’re super-excited about this opportunity to get to know you and to hear your story about resiliency. I should note, 2020 is kind of the poster child for resiliency, and we’re very fortunate to hear your perspective on it. But let’s kind of jump right into it, and talk a little bit about, you know, what has it meant. You’re the founder of The Corcoran Group, you’re on the Shark Tank. What has this been like for you, with COVID, and with this virus, and with working remotely? How has that gone for you? Tell us a little about your situation. BARBARA: I’d be happy to, and thanks for having me Roger, I enjoy being here. Number one, it changed everything. It changed my business, and the different pursuits that I have within the business context. It changed my personal life tremendously, and I’m sure I’m not alone on that. I think everybody would report the same. But to give you an example of how it affected us, and how quickly it affected me, was when March hit, New York City was hit very hard. We were the earliest city hit. -
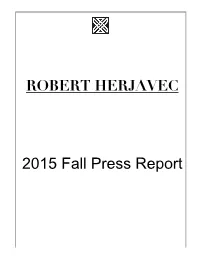
2015 Fall Press Report
ROBERT HERJAVEC 2015 Fall Press Report OUTLET: THE HOLLYWOOD REPORTER ISSUE: DECEMBER 4, 2015 CIRCULATION: 73,875 IMPRESSIONS: 221,625 OUTLET: RUNNERS WORLD ISSUE: NOVEMBER 6, 2015 IMPRESSIONS: 2,625,589 I got fired when I was younger, started an internet security business, and that was that. Some people have a vision to start a business. Others adapt because they’re forced to. I was the latter. I was a casual runner my whole life, but I got serious eight years ago when my mom became ill with cancer. My company was growing, my kids were littler, the days felt overwhelming. The only thing that made me forget about everything was running, so I started doing it every day. Most people think business is the fun, sexy stuff we see on TV, but success comes from the 22 things you have to do every day that nobody notices. That’s just like running. There are a lot of fans at the finish line of a marathon, but not as many between miles three and 26. My proudest running moment was my first marathon in Miami in 2009. I trained only for a few months, but I was really proud that I even finished (in 4:40). I run five miles daily, plus a long run of eight to 10 miles on Sunday. It’s hard to find the time but if I don’t, I’m more tired, I need to eat more – it affects me physically and mentally. I appeared on Dancing With the Stars this year and made it to week eight of 10 with no dance experience. -

Gender Match and the Gender Gap in Venture Capital Financing: Evidence from Shark Tank
DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 14069 Gender Match and the Gender Gap in Venture Capital Financing: Evidence from Shark Tank Michael Jetter Kieran Stockley JANUARY 2021 DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 14069 Gender Match and the Gender Gap in Venture Capital Financing: Evidence from Shark Tank Michael Jetter University of Western Australia, IZA and CESifo Kieran Stockley University of Western Australia JANUARY 2021 Any opinions expressed in this paper are those of the author(s) and not those of IZA. Research published in this series may include views on policy, but IZA takes no institutional policy positions. The IZA research network is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The IZA Institute of Labor Economics is an independent economic research institute that conducts research in labor economics and offers evidence-based policy advice on labor market issues. Supported by the Deutsche Post Foundation, IZA runs the world’s largest network of economists, whose research aims to provide answers to the global labor market challenges of our time. Our key objective is to build bridges between academic research, policymakers and society. IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be available directly from the author. ISSN: 2365-9793 IZA – Institute of Labor Economics Schaumburg-Lippe-Straße 5–9 Phone: +49-228-3894-0 53113 Bonn, Germany Email: [email protected] www.iza.org IZA DP No. 14069 JANUARY 2021 ABSTRACT Gender Match and the Gender Gap in Venture Capital Financing: Evidence from Shark Tank* Although the gender gap in entrepreneurs’ success rates to secure funding is staggering, we know little about its causes. -
Flying History Lands in Chehalis
Reaching 110,000 Readers in Print and Online — www.chronline.com $1 Seeking Youth Early Week Edition at the Toledo Tuesday, Threshing Bee / Sept. 1, 2015 Main 13 Love INC at 25 Port, Nonprofit Tangle Chehalis Nonprofit Delivers Furniture, Group Home Wants More Than Market Value as Money and Hope to the Needy / Main 3 Port of Centralia Plans Potential Purchase / Main 5 Alder Lake Fire Stalls, Crews Grow Containment Lines BATTLE: Fire Holds at 275 The weekend rain slowed morning and was expected to 15 percent. The fire continues to heavy equipment are combating the spread of the Alder Lake grow only by about 5 acres over smolder in the wooded debris the blaze. A type 3 fire fighting Acres Over Weekend; Fire and gave crews a window of the next day. Fire crews were on the forest floor. crew, the type that works fires More Rain Expected time to increase containment. able to take advantage of the A total of 154 personnel, two that are under control or in the The fire held at about 275 precipitation by growing their bulldozers, five fire engines By The Chronicle acres from Saturday to Tuesday containment from 10 percent to and a handful of other pieces of please see FIRE, page Main 11 Commissioners Flying History Lands in Chehalis Approve Firm B-17 Bomber on Display at Chehalis-Centralia Airport for $138,000 North Lewis County Industrial Access Study By Kaylee Osowski [email protected] A 2009 study done by the state determined that a new interchange on Interstate 5 in North Lewis County is feasible and needed. -

OLD GIRLS' NETWORK This Page Intentionally Left Blank the OLD GIRLS' NETWORK
THE OLD GIRLS' NETWORK This page intentionally left blank THE OLD GIRLS' NETWORK Insider Advice for Women Building Businesses in a Man's World Sharon Whiteley Kathy Elliott Connie Duckworth A Member of the Perseus Books Group New York Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book and Basic Books was aware of a trademark claim, those designations have been printed with initial capital letters. Copyright 2003 © by Sharon Whiteley, Kathy Elliott, and Connie Duckworth All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the Publisher. Printed in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data The old girls' network : insider advice for women building businesses in a man's world / Sharon Whiteley . [et al.]. p. cm. ISBN 0-7382-0806-X 1. Women-owned business enterprises. 2. Businesswomen. I. Whiteley, Sharon. HD2341.O426 2003 658.4'21'082—dc21 2003011635 Basic Books is a member of the Perseus Books Group Text design by Brent Wilcox Set in 11-point Sabon Visit us on the World Wide Web at http://www.perseusbooks.com Basic books are available at special discounts for bulk purchases in the U.S. by corporations, institutions, and other organizations. For more information, please contact the Special Markets Department at the Perseus Books Group, 11 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, or call (617) 252-5298. -

Gender Differences in Venture Capital Funding on ABC's Shark Tank THESIS Presented in Partial Fulfillment of the Requirements
Gender Differences in Venture Capital Funding on ABC’s Shark Tank THESIS Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Bachelor of Science in Business Administration with Honors Research Distinction Degree in the Max M. Fisher College of Business of The Ohio State University By Tyler Jordon Hunt Finance Specialization in Business Administration The Ohio State University 2016 Dissertation Committee: Patricia West Ralph Greco Copyrighted by Tyler Jordon Hunt 2016 Abstract ABC Network’s reality television show “Shark Tank” gives entrepreneurs the opportunity to pitch their ideas to a panel of investors for the chance to receive funding. Each season more than 35,000 entrepreneurs apply to be on the show. Whether they receive an offer for funding or not, they still stand to gain the free advertising that comes with appearing on a show with more than seven million average viewers per episode. Although there are abundant resources for knowledge on Shark Tank, women in venture capital, and behavioral gender differences, sources are lacking on gender differences in venture capital funding on Shark Tank. The purpose of this research is to determine if differences exist in how entrepreneurs receive funding based on their gender. To analyze this, I utilized two publicly available datasets containing information on the pitches aired on the show. These datasets were cleansed and merged to form one data set with thirty- five variables spanning across four seasons and 235 pitches. I found that despite having comparable or better businesses than their male counterparts, women ask for lower valuations and accept deals at a lesser percentage of what they asked for compared to men. -

Shark Tank Share Some Exclusive Business Advice
edition 4 • october 2016 • vol. 3 • no. 2 Made possible by the PwC Charitable ® Foundation original fully vector logo, restored 2/2015 (Old embedded letter “S” that we created as ver 7, we decided was NG. This is now version 8) FINANCIAL LITERACY FOR KIDS In this special issue, the experts from ABC’s hit show Shark Tank share some exclusive business advice. timeforkids.com turned $1,000 into a $5 billion real-estate empire. She struggled through middle school and sees herself as Barbaraproof that youcorcoran don’t have to get straight As to build a multibillion-dollar business. She says that learning how to read people and focusing on the kind of person she wanted to be were Want to swim with the sharks? key to her success. TThisHE special SHARKS edition OF features aBc ’s hIT Her advice: “It’s smart to sit down as a exclusiveSHOW businessSHARK tips Ta andNk OFFER TIPS kid and think of the peer you admire most advice from the self-made and make a list of his or her best qualities. You can decide right then and there to build multimillionaire (and billionaire!) those same qualities in yourself through investors on Shark Tank. practice, and then grow up to be a person others admire.” (Do the same exercise for the On each episode, the sharks mark cuban hear about new and growing Barbara corcoran negative qualities you want to avoid.) businesses from the entrepreneurs Thewho started them. After scoopa hard from The sharkskevin o’Leary sell, the sharks decide whether or Lori Greiner not to invest their own money— made his fortune by starting an educational software company and act as advisers—to help the that he eventually sold to Mattel.