Sendtnera = Vorm
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mayors for Peace Member Cities 2021/10/01 平和首長会議 加盟都市リスト
Mayors for Peace Member Cities 2021/10/01 平和首長会議 加盟都市リスト ● Asia 4 Bangladesh 7 China アジア バングラデシュ 中国 1 Afghanistan 9 Khulna 6 Hangzhou アフガニスタン クルナ 杭州(ハンチォウ) 1 Herat 10 Kotwalipara 7 Wuhan ヘラート コタリパラ 武漢(ウハン) 2 Kabul 11 Meherpur 8 Cyprus カブール メヘルプール キプロス 3 Nili 12 Moulvibazar 1 Aglantzia ニリ モウロビバザール アグランツィア 2 Armenia 13 Narayanganj 2 Ammochostos (Famagusta) アルメニア ナラヤンガンジ アモコストス(ファマグスタ) 1 Yerevan 14 Narsingdi 3 Kyrenia エレバン ナールシンジ キレニア 3 Azerbaijan 15 Noapara 4 Kythrea アゼルバイジャン ノアパラ キシレア 1 Agdam 16 Patuakhali 5 Morphou アグダム(県) パトゥアカリ モルフー 2 Fuzuli 17 Rajshahi 9 Georgia フュズリ(県) ラージシャヒ ジョージア 3 Gubadli 18 Rangpur 1 Kutaisi クバドリ(県) ラングプール クタイシ 4 Jabrail Region 19 Swarupkati 2 Tbilisi ジャブライル(県) サルプカティ トビリシ 5 Kalbajar 20 Sylhet 10 India カルバジャル(県) シルヘット インド 6 Khocali 21 Tangail 1 Ahmedabad ホジャリ(県) タンガイル アーメダバード 7 Khojavend 22 Tongi 2 Bhopal ホジャヴェンド(県) トンギ ボパール 8 Lachin 5 Bhutan 3 Chandernagore ラチン(県) ブータン チャンダルナゴール 9 Shusha Region 1 Thimphu 4 Chandigarh シュシャ(県) ティンプー チャンディーガル 10 Zangilan Region 6 Cambodia 5 Chennai ザンギラン(県) カンボジア チェンナイ 4 Bangladesh 1 Ba Phnom 6 Cochin バングラデシュ バプノム コーチ(コーチン) 1 Bera 2 Phnom Penh 7 Delhi ベラ プノンペン デリー 2 Chapai Nawabganj 3 Siem Reap Province 8 Imphal チャパイ・ナワブガンジ シェムリアップ州 インパール 3 Chittagong 7 China 9 Kolkata チッタゴン 中国 コルカタ 4 Comilla 1 Beijing 10 Lucknow コミラ 北京(ペイチン) ラクノウ 5 Cox's Bazar 2 Chengdu 11 Mallappuzhassery コックスバザール 成都(チォントゥ) マラパザーサリー 6 Dhaka 3 Chongqing 12 Meerut ダッカ 重慶(チョンチン) メーラト 7 Gazipur 4 Dalian 13 Mumbai (Bombay) ガジプール 大連(タァリィェン) ムンバイ(旧ボンベイ) 8 Gopalpur 5 Fuzhou 14 Nagpur ゴパルプール 福州(フゥチォウ) ナーグプル 1/108 Pages -

Original Article Potentially Toxic Element Concentration in Fruits
Biomed Environ Sci, 2019; 32(11): 839-853 839 Original Article Potentially Toxic Element Concentration in Fruits Collected from Markazi Province (Iran): A Probabilistic Health Risk Assessment Mohammad Rezaei1,2, Bahareh Ghasemidehkordi3, Babak Peykarestan4, Nabi Shariatifar2, Maryam Jafari2, Yadolah Fakhri5, Maryam Jabbari6, and Amin Mousavi Khaneghah7,# 1. Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran; 2. Department of Food Safety and Hygiene, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; 3. Department of Biochemistry, Payame Noor University, Isfahan, Iran; 4. Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran; 5. Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health and Safety, Student Research Committee, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; 6. Department of Public Health, School of Paramedical and Health, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran; 7. Department of Food Science, Faculty of Food Engineering, University of Campinas (UNICAMP), Rua Monteiro Lobato, 80. Caixa Postal: 6121.CEP: 13083-862. Campinas. São Paulo. Brazil Abstract Objective This study was conducted to evaluate the concentration of potentially toxic elements (PTEs) such as arsenic (As), cadmium (Cd), mercury (Hg), and lead (Pb) in fruit samples collected from Markazi Province, Iran. A probabilistic health risk assessment due to ingestion of PTEs through the consumption of these fruits was also conducted. Methods The concentration of PTEs in 90 samples of five types of fruits (n = 3) collected from six geographic regions in Markazi Province was measured. The potential health risk was evaluated using a Monte Carlo simulation model. Results A significant difference was observed in the concentration of PTEs between fruits as well as soil and water samples collected from different regions in Markazi Province. -

Systematics, Phylogeny and Biogeography of Cousinia (Asteraceae)
SYSTEMATICS, PHYLOGENY AND BIOGEOGRAPHY OF COUSINIA (ASTERACEAE) Dissertation Zur Erlangung des Grades Doktor der Naturwissenschaften am Fachbereich Biologie der Johannes Gutenberg‐Universität Mainz Iraj Mehregan geb. in Gachsaran, Iran Mainz, 2008 Dekan: 1. Berichterstatter: 2. Berichterstatter: Tag der mündlichen Prüfung: 10. 07. 2008 II Kapitel 2 (chapter 2) dieser Arbeit ist im Druck bei “Taxon“: López‐Vinyallonga, S., Mehregan, I.*, Garcia‐Jacas, N., Tscherneva, O., Susanna, A. & Kadereit, J. W.*: Phylogeny and evolution of the Arctium‐Cousinia complex (Compositae, Cardueae‐Carduinae). * Von den Autoren Mehregan, I und Kadereit, J. W.: Die Generation der ITS‐Sequenzen von 113 Taxa (Appendix 1), die Bayesische Analyse der ITS‐ und rpS4‐trnT‐trnL‐Sequenzen, das Rechnen der Molekularen Uhr sowie der Partition‐Hemogenity Test und die Analyse des Cousinioid Clade wurde in Rahmen dieser Dissertation ausgeführt. Das Manuskript wurde in Zusammenarbeit aller Autoren geschrieben. Kapitel 3 (chapter 3) diese Arbeit wird bei “Willdenowia” eingereicht: Mehregan, I. & Kadereit, J. W.: The role of hybridization in the evolution of Cousinia s.s. (Asteraceae). Kapitel 4 (chapter 4) dieser Arbeit ist im Druck bei “Willdenowia“: Mehregan, I. & Kadereit, J. W.: Taxonomic revision of Cousinia sect. Cynaroideae. III Contents SUMMARY............................................................................................................................................................................1 ZUSAMMENFASSUNG .....................................................................................................................................................2 -

The Challenges and Considerations of Community-Based Preparedness at the Onset Cambridge.Org/Hyg of COVID-19 Outbreak in Iran, 2020
Epidemiology and Infection The challenges and considerations of community-based preparedness at the onset cambridge.org/hyg of COVID-19 outbreak in Iran, 2020 From the Field Rahmatollah Moradzadeh Cite this article: Moradzadeh R (2020). The Department of Epidemiology, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran challenges and considerations of community- based preparedness at the onset of COVID-19 Abstract outbreak in Iran, 2020. Epidemiology and Infection 148, e82, 1–3. https://doi.org/ COVID-19 as an emerging disease has spread to 183 countries and territories worldwide as of 10.1017/S0950268820000783 20 March 2020. The first COVID-19 case (i.e. the index case) in Iran was observed in the city of Qom on 19 February 2020. One of the cities of Markazi Province is Delijan, which shares a Received: 6 March 2020 border with Qom. Consequently, COVID-19 has quickly spread in this city because a large Revised: 24 March 2020 Accepted: 31 March 2020 population commutes daily between the two cities. This study aimed to report the challenges and considerations of community-based preparedness at the onset of COVID-19 outbreak in a Key words: city of Iran in 2020. COVID-19; epidemics; epidemiology; Iran; outbreak Author for correspondence: Introduction Rahmatollah Moradzadeh, E-mail: [email protected] COVID-19 as an emerging disease has spread to 183 countries and territories worldwide as of 20 March 2020. The total number of COVID-19 cases has been 266 073 across the world [1] and 19 644 cases in Iran [1–4] at the time of writing this report (20 March 2020). -

Selenium and Iodine Status of Sheep in the Markazi Province, Iran
Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 11, No. 1, Ser. No. 30, 2010 Short Paper Selenium and iodine status of sheep in the Markazi province, Iran Talebian Masoudi, A. R.1*; Azizi, F.2 and Zahedipour, H.1 1Agriculture and Natural Resource Research Center of Markazi Province, Arak, Iran; 2Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University (M.C), Tehran, Iran *Correspondence: A. R. Talebian Masoudi, Agriculture and Natural Resource Research Center of Markazi Province, Arak, Iran. E-mail: [email protected] (Received 21 Oct 2008; revised version 11 Jul 2009; accepted 18 Jul 2009) Summary The aim of this study was to provide preliminary quantitative information on selenium and iodine status of sheep in Markazi province, Iran. Selenium and iodine status of grazing sheep were measured for 57 different flocks in 14 regions over one year. The districts were selected to represent major sheep growing areas in the province. Blood samples were collected from 2 to 3-year-old ewes during summer, autumn and winter. Samples were analyzed for blood glutathione peroxidase (GSHpx) activity and plasma inorganic iodine. There were significant differences between regions and seasonal differences in terms of blood GSHpx activity and plasma inorganic iodine concentration (P<0.01). Low levels of GSHpx activity (<60 IU/gHb) and plasma inorganic iodine (<5 µg/dl) in some regions or some seasons indicated the need for dietary supplementation of these minerals. Key words: Sheep, Nutrition, Mineral, Selenium, Iodine Introduction of insufficient iodine intake (Bobek, 1998). A primary reason for determining the Living organisms depend on minerals selenium (Se) and iodine (I) status of an for proper function and structure. -

Islamic Republic of Iran As Affected Country Party
United Nations Convention to Combat Desertification Performance Review and Assessment of Implementation System Fifth reporting cycle, 2014-2015 leg Report from Islamic Republic of Iran as affected country Party July 25, 2014 Contents I. Performance indicators A. Operational objective 1: Advocacy, awareness raising and education Indicator CONS-O-1 Indicator CONS-O-3 Indicator CONS-O-4 B. Operational objective 2: Policy framework Indicator CONS-O-5 Indicator CONS-O-7 C. Operational objective 3: Science, technology and knowledge Indicator CONS-O-8 Indicator CONS-O-10 D. Operational objective 4: Capacity-building Indicator CONS-O-13 E. Operational objective 5: Financing and technology transfer Indicator CONS-O-14 Indicator CONS-O-16 Indicator CONS-O-18 II. Financial flows Unified Financial Annex III. Additional information IV. Submission Islamic Republic of Iran 2/225 Performance indicators Operational objective 1: Advocacy, awareness raising and education Number and size of information events organized on the subject of desertification, land degradation CONS-O-1 and drought (DLDD) and/or DLDD synergies with climate change and biodiversity, and audience reached by media addressing DLDD and DLDD synergies Percentage of population informed about DLDD and/or DLDD synergies 30 % 2018 Global target with climate change and biodiversity National contribution Percentage of national population informed about DLDD and/or DLDD 2011 to the global target synergies with climate change and biodiversity 27 2013 2015 2017 2019 % Year Voluntary national Percentage -

From the Qazvin Province, Iran
©Biologiezentrum Linz, Austria; download unter www.biologiezentrum.at Linzer biol. Beitr. 44/1 855-862 31.7.2012 A study of the Ichneumonidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) from the Qazvin province, Iran H. GHAHARI & M. SCHWARZ A b s t r a c t : In this paper the species and their collecting data of Ichneumonidae collected in 2007 - 2009 in the Qazvin province are listed. The material belongs to the following 10 subfamilies: Anomaloninae, Campopleginae, Cryptinae, Ctenopelmatinae, Diplazontinae, Ichneumoninae, Metopiinae, Ophioninae, Pimplinae and Tryphoninae. Totally 63 species from 49 genera were collected. Key words: Hymenoptera, Ichneumonidae, Fauna, Qazvin, Iran. Introduction The Ichneumonidae (Hymenoptera) is one of the largest families of all organisms with an estimated 60.000 species in the world (TOWNES 1969; GAULD 1991). Ichneumonids use a diverse assemblage of holometabolous insects and arachnids as their hosts and play an essential role in the normal functioning of most ecosystems, underlining the need to inventory their diversity. Ichneumonids have been used successfully as biocontrol agents and given the largely undocumented fauna there is a huge potential for their utilization in managed biocontrol programs (GUPTA 1991; WAHL & SHARKEY 1993; AUSTIN & DOWTON 2001). The objective of this paper is studying the fauna of Ichneumonidae from the Qazvin province. The province Qazvin is in the north-west of Iran and covers 15.821 km² between 48°45’ to 50°50’ E and 35°37’ to 36°45’ N. The province is bounded in the north by Mazandaran and Guilan, in the west by Hamadan and Zanjan, in the south by Markazi and in the east by Tehran provinces. -

The Challenges and Considerations of Community-Based Preparedness at the Onset Cambridge.Org/Hyg of COVID-19 Outbreak in Iran, 2020
Epidemiology and Infection The challenges and considerations of community-based preparedness at the onset cambridge.org/hyg of COVID-19 outbreak in Iran, 2020 From the Field Rahmatollah Moradzadeh Cite this article: Moradzadeh R (2020). The Department of Epidemiology, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran challenges and considerations of community- based preparedness at the onset of COVID-19 Abstract outbreak in Iran, 2020. Epidemiology and Infection 148, e82, 1–3. https://doi.org/ COVID-19 as an emerging disease has spread to 183 countries and territories worldwide as of 10.1017/S0950268820000783 20 March 2020. The first COVID-19 case (i.e. the index case) in Iran was observed in the city of Qom on 19 February 2020. One of the cities of Markazi Province is Delijan, which shares a Received: 6 March 2020 border with Qom. Consequently, COVID-19 has quickly spread in this city because a large Revised: 24 March 2020 Accepted: 31 March 2020 population commutes daily between the two cities. This study aimed to report the challenges and considerations of community-based preparedness at the onset of COVID-19 outbreak in a Key words: city of Iran in 2020. COVID-19; epidemics; epidemiology; Iran; outbreak Author for correspondence: Introduction Rahmatollah Moradzadeh, E-mail: [email protected] COVID-19 as an emerging disease has spread to 183 countries and territories worldwide as of 20 March 2020. The total number of COVID-19 cases has been 266 073 across the world [1] and 19 644 cases in Iran [1–4] at the time of writing this report (20 March 2020). -

Evaluation of Toxoplasma Gondii Infection in Western Iran: Seroepidemiology and Risk Factors Analysis
Mousavi-Hasanzadeh et al. Tropical Medicine and Health (2020) 48:35 Tropical Medicine https://doi.org/10.1186/s41182-020-00222-x and Health RESEARCH Open Access Evaluation of Toxoplasma gondii infection in western Iran: seroepidemiology and risk factors analysis Morteza Mousavi-Hasanzadeh1, Hossein Sarmadian2, Reza Ghasemikhah3* , Mojtaba Didehdar3, Maryam Shahdoust4, Mahshid Maleki5 and Mahdieh Taheri6 Abstract Background: Toxoplasmosis is a parasitic infectious disease, and Toxoplasma gondii is the causative factor of this intracellular protozoan disease. Due to the lack of information about the rate of T. gondii in general papulation of Markazi Province in Iran, the current study was conducted to determine the prevalence of toxoplasmosis and the related risk factor analysis in the general population of Markazi Province. Methods: This cross-sectional study was performed within 6 months on individuals who were referred to diagnostic laboratories in Markazi Province. The demographic and background information of the subjects were collected using a questionnaire. Three milliliters of blood samples was collected from the participants under sterile conditions. The sera were separated and evaluated for levels of anti-Toxoplasma IgG antibody using a commercial enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. The collected data were analyzed by the SPSS software using descriptive statistics and chi-square test. Results: Out of 824 people from the general population of Markazi Province who were investigated in this study, 276 (33.5%) had anti-Toxoplasma antibodies in their blood. According to the logistic regression model, gender variables, location, marital status, and having a cat at home do not affect the chances of contracting the parasite. Furthermore, the chance of contracting the parasite in 41- to 50-year-olds is 0.85 times the one in the 20- to 30- year-olds. -

Time Evaluating of Dust Phenomenon in Alborz and Qazvin Provinces
Journal of Environmental Studies 17 Vol. 44, No. 2, Summer 2018 Time evaluating of dust phenomenon in Alborz and Qazvin provinces 1∗ 2 3 4 5 Tayebe Mesbahzadeh , Nahid Alipour , Hasan Ahmadi , Arash Malekian , Mohammad Jafari 1. Assistant professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 2. Ph.D. Student in Management and Control of Desert, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran ([email protected]) 3. Professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran ([email protected]) 4. Associate Professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran ([email protected]) 5. Professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran ([email protected]) Received: November 13, 2018 Accepted: October 21, 2018 Expanded Abstract Introduction Dust is a phenomenon that mainly occurs on arid and semiarid regions due to the high wind speed and its turbulence on soil surface without any cover and talent to erosion (Khoshhal Dastjerdi et al ., 2012). In recent years, dust of deserts has increasingly grown and has played an important role in climate change in the world (Yarahmadi & Khoshkish, 2013). Today pollution from dust particles has converted to one of the environmental problems, especially in developing countries (Aliabadi et al ., 2015). Dust, as a phenomenon of desert areas, disrupts human activities, agriculture, social infrastructure, transportation, and industry (Takemi & Seino, 2005). -

Language Shift in the Central Iranian Plateau
Journal of Persianate Studies 2 (2009) 62-87 brill.nl/jps Median Succumbs to Persian after Th ree Millennia of Coexistence: Language Shift in the Central Iranian Plateau Habib Borjian Abstract Th e so-called Central Plateau Dialects or simply Central Dialects belong to the South Median group of Northwest Iranian languages and are spoken in central Iran, where the prevailing lan- guage is Persian. Currently, vestiges of these dialects are limited to several dozen remote villages as well as to the older generation of the Jewish and Zoroastrian communities living in the cities and in diaspora. Th e dominant infl uence of Persian for more than a millennium has resulted in the ousting of the vernaculars not only in major towns but also in a majority of villages. His- torical evidence suggests that Central Dialects were native to the entire central Iranian Plateau, larger towns included, until the late medieval period. Th e big shift may have taken place during and after the Safavid dynastic rule, perhaps as a result of forceful propagation of Shiʿism, among other economic and socio-political vicissitudes of those days. Concrete evidence becomes avail- able only in the later nineteenth century when European travelers and local geographers began to report on the language situation of the area. Th ese documents enable us to speculate on the patterns and rates of language shift in various regions speaking Central Dialects. Th is trend has been accelerating parallel with the enormous socio-economic changes in the last half century. In many villages the local dialect is moribund and becoming increasingly limited to the elders, and the extinction will be the inevitable result of the forces of modernization and globalization in general and the rapid expansion of Persian education and mass media in particular. -
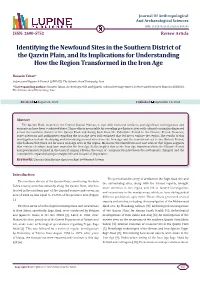
Identifying the Newfound Sites in the Southern District of the Qazvin Plain, and Its Implications for Understanding How the Region Transformed in the Iron Age
Journal Of Anthropological And Archaeological Sciences DOI: 10.32474/JAAS.2020.02.000146 ISSN: 2690-5752 Review Article Identifying the Newfound Sites in the Southern District of the Qazvin Plain, and Its Implications for Understanding How the Region Transformed in the Iron Age Hossein Tahan* Science and Research Branch (SRBIAU), The Islamic Azad University, Iran *Corresponding author: Hossein Tahan, Archeology PhD, and Qazvin cultural heritage expert, Science and Research Branch (SRBIAU), The Islamic Azad University, Iran Received: August 26, 2020 Published: September 10, 2020 Abstract excavations have been conducted there. Those efforts are notable for revealing pre-historic sites with cultural continuity, dispersed acrossThe the Qazvin southern Plain, district located of in the the Qazvin Central Plain Iranian and Plateau, dating backis ripe from with the historical Paleolithic artifacts, Period and to thesignificant Historic investigations Period. However, and some questions and ambiguities regarding the Iron Age sites still remained that led me to explore the region. The results of this investigation include identifying and introducing several sites from the Iron Age and the transitional era to the Historic Period, that centers of culture may have moved in the Iron Age. It also implies that as the Iron Age transitioned into the Historic Period andwhich governments shows that thereformed are in far the more Central Iron Iranian Age sites Plateau, in the theregion. ways Moreover, of communication the identification between of the vast